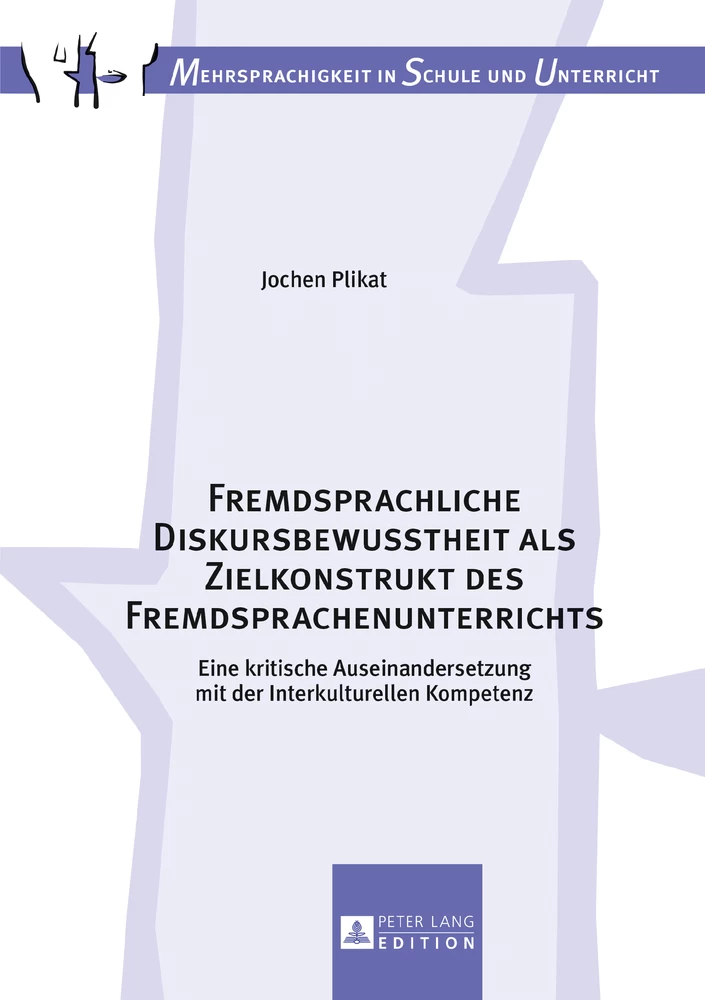Fremdsprachliche Diskursbewusstheit als Zielkonstrukt des Fremdsprachenunterrichts
Eine kritische Auseinandersetzung mit der Interkulturellen Kompetenz
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Danksagung
- Inhalt
- Vorbemerkungen und Einleitung
- Kapitel 1: Problemstellung
- 1.1 Rückblick: Landeskunde als Wissensvermittlung über Nationalkulturen
- 1.2 Aufstieg des Kulturbegriffs zur Leitkategorie der Humanwissenschaften
- 1.3 Pluralisierung von Gesellschaften als Folge der Globalisierung
- 1.4 Interkulturelle Fremdsprachendidaktik als Reaktion auf den ‚Cultural turn‘ und die Globalisierung
- 1.5 Terminologischer Exkurs: Interkulturelle Bildung, interkulturelles Lernen oder interkulturelle Kompetenz?
- 1.6 Unbehagen angesichts des Interkulturalitätsbegriffs in der Fremdsprachendidaktik
- 1.7 Unbehagen angesichts kulturrelativistischer Tendenzen in der Fremdsprachendidaktik
- 1.8 Arbeitshypothese und Forschungsfragen
- 1.9 Methodisches Vorgehen
- Kapitel 2: Kulturwissenschaftliche Grundlagen
- 2.1 Zur Frage der Kulturbegriffe
- 2.1.1 Der normative Kulturbegriff
- 2.1.2 Der totalitätsorientierte Kulturbegriff
- 2.1.3 Der differenzierungstheoretische Kulturbegriff
- 2.1.4 Der bedeutungs- und wissensorientierte Kulturbegriff
- 2.1.5 Exkurs: Das Konzept der ‚Transkulturalität‘
- 2.1.6 Kulturbegriffe: Zusammenfassung
- 2.2 Zum Dilemma von Universalismus und Kulturrelativismus
- 2.2.1 Kulturrelativismus als Reaktion auf Rassismus und Kolonialismus
- 2.2.2 Selbstwidersprüche und Fehlschlüsse des Kulturrelativismus
- 2.2.3 Historisch-philosophische Einwände gegen den Kulturrelativismus
- 2.2.4 Rechtlich-politische Einwände gegen den Kulturrelativismus
- 2.2.5 Bildungs- und demokratietheoretische Einwände gegen den Kulturrelativismus
- 2.2.6 ‚Aufgeklärter Eurozentrismus‘ als Versuch der Versöhnung von Universalismus und Kulturrelativismus
- Kapitel 3: Ansätze interkultureller Fremdsprachendidaktik in der Diskussion
- 3.1 Einleitende Überlegungen
- 3.2 Vom Verstehen zur Verständigung: Der hermeneutische Ansatz des Gießener Kollegs
- 3.2.1 Problemstellung der Didaktik des Fremdverstehens
- 3.2.2 Von Lothar Bredella diskutierte Ansätze zur Dichotomie des Eigenen und Fremden
- 3.2.3 Exkurs: Diskussion der von Bredella referierten Ansätze
- 3.2.4 Grundzüge der Didaktik des Fremdverstehens
- 3.2.5 Die Didaktik des Fremdverstehens im Licht der Forschungsfragen
- 3.3 Interkulturalität als ‚Dritter Ort‘: Claire Kramschs Konstrukt der ‚Thirdness‘
- 3.3.1 Problemstellung der ‚Thirdness‘
- 3.3.2 Grundzüge der ‚Thirdness‘
- 3.3.3 ‚Thirdness‘ im Licht der Forschungsfragen
- 3.4 Umgang mit Komplexität und Mehrdeutigkeit: Claire Kramschs ‚symbolic competence‘
- 3.4.1 Problemstellung der ‚symbolic competence‘
- 3.4.2 Gründzüge der ‚symbolic competence‘
- 3.4.3 ‚Symbolic competence‘ im Licht der Forschungsfragen
- 3.5 Schwerpunkte interkultureller Kompetenz: Michael Byrams fünf ‚savoirs‘
- 3.5.1 Problemstellung der ‚Intercultural communicative competence‘
- 3.5.2 Grundzüge der ‚Intercultural communicative competence‘
- 3.5.3 ‚Intercultural communicative competence‘ im Licht der Forschungsfragen
- 3.6 Fazit: Problemfelder der interkulturellen Fremdsprachendidaktik
- Kapitel 4: Theoriebildung: Umrisse des Konstruktes ‚Fremdsprachliche Diskursbewusstheit‘
- 4.1 Einleitende Überlegungen
- 4.2 Zum Diskursbegriff
- 4.2.1 Vorüberlegungen zum Diskursbegriff
- 4.2.2 Klärung des Diskursbegriffs
- 4.2.3 Zur Verwendung des Diskursbegriffs in fremdsprachendidaktischen Beiträgen
- 4.2.4 Zur Bedeutung des Diskursbegriffs für die Fremdsprachliche Diskursbewusstheit
- 4.3 Zum Konzept der ‚language awareness‘/Sprachbewusstheit
- 4.3.1 Bewusstsein als philosophisches Rätsel
- 4.3.2 Grundzüge des Konstruktes ‚language awareness‘/Sprachbewusstheit
- 4.3.3 Zur Bedeutung der Sprachbewusstheit für die Fremdsprachliche Diskursbewusstheit
- 4.4 Zur Theorie transformatorischer Bildungsprozesse
- 4.4.1 Problemstellung der Theorie transformatorischer Bildungsprozesse
- 4.4.2 Grundzüge der Theorie transformatorischer Bildungsprozesse
- 4.4.3 Zur Bedeutung der Theorie transformatorischer Bildungsprozesse für die Fremdsprachliche Diskursbewusstheit
- 4.5 Didaktische Prinzipien zur Anbahnung Fremdsprachlicher Diskursbewusstheit
- Fazit und Ausblick
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Literatur
Man muß sich das vorstellen: Ein Gläubiger kniet nieder und beginnt ein Gebet. Ein Intellektueller stellt sich neben ihn und sagt: „Wie interessant! Weißt du, daß andere Völker an ganz andere Götter glauben?“ Wie kann der Gläubige, der an seinen Gott glaubt, darauf reagieren? Natürlich lehnt er die Zumutung des Vergleichs ab, hält den Intellektuellen für einen Neunmalklugen und die anderen Völker für ungläubig. Aber in Wahrheit ist er bereits erschüttert. In Wahrheit hat ihn bereits eine Unruhe erfaßt. Wie kann er glauben, wenn andere anders glauben? Was kann er wissen, wenn andere anderes wissen? Wer ist sein Gott, wenn andere ihn nicht kennen? Wie weit reicht die Macht seines Gottes, wenn andere ungestraft ihren Götzen huldigen dürfen? (Baecker 2001: 48)
Interkulturelle Kompetenz, interkulturelles Lernen, interkulturelle fremdsprachige Handlungsfähigkeit – ohne Zweifel nimmt der Interkulturalitätsgedanke in der aktuellen Fremdsprachendidaktik einen zentralen Platz ein. Seit das Prinzip der Interkulturalität in den 1990er-Jahren zu seiner aktuellen Bedeutung aufgestiegen ist, geht es nach anfänglich noch grundlegenden Diskussionen (vgl. Hu 1999) inzwischen weniger um die Frage, ob interkulturelle Kompetenz ein Ziel fremdsprachlichen Lernens sein sollte, sondern vielmehr darum, wie sie angebahnt und möglicherweise auch gestuft und evaluiert werden kann. Innerhalb weniger Jahre wurde es zu einer Selbstverständlichkeit, dass Lehrkräfte fremder Sprachen in Deutschland neben sprachlichen Kompetenzen auch interkulturelle Kompetenzen in den Fokus ihrer unterrichtlichen Arbeit stellen sollen. Sie haben seither gewissermaßen den Auftrag, ihren Lernenden im Umgang mit ‚fremden Kulturen‘ eine Haltung zu vermitteln, die der Soziologe Dirk Baecker im Eingangszitat mit den Worten „Wie interessant!“ zuspitzt. Dieses „Wie interessant!“ hat jedoch auf fast unvermeidliche Weise zur Folge, dass auch der Blick auf die ‚eigene Kultur‘ sich verändert, und auch dies ist ein Anliegen interkultureller Didaktik.
Als ich ab 2003 im Rahmen meines Referendariats in den Fächern Französisch und Spanisch damit begann, mich mit fremdsprachendidaktischen Problemstellungen zu beschäftigen, leuchtete es auch mir zunächst ein, sprachliches und ‚interkulturelles‘ Lernen zu verbinden. Das klang nach Völkerverständigung, Toleranz, Offenheit und Empathie – wer hätte also etwas dagegen einwenden können, dass ein Begriff1, mit dem man so hehre Ziele verbindet, im Mittelpunkt ← 13 | 14 → des Lehrens und Lernens fremder Sprachen stehen sollte? Und schien nicht der Fremdsprachenunterricht mehr als alle anderen schulischen Fächer geeignet, ja geradezu prädestiniert, den Interkulturalitätsgedanken tief in den Köpfen der Lernenden zu verankern?
Zwei Fragen ließen mich jedoch nicht los. Die eine wurde zumindest im wissenschaftlichen Kontext bisweilen gestellt. Sie lautet: Was genau ist eigentlich ‚Kultur‘?2 Vordergründig eine banale Frage – durch die feste Verankerung des Begriffs in der Alltagssprache hatte ich zunächst das sichere Gefühl zu wissen, was darunter zu verstehen sei. Diese Sicherheit wurde jedoch allmählich brüchig. Mir fiel auf, dass wir meist ohne zu zögern von der lateinamerikanischen Kultur, der spanischen Kultur, der russischen Kultur und der italienischen Kultur sprechen, dass mir (und vielen anderen) die Rede von der ‚deutschen Kultur‘ dagegen weniger leicht oder gar nicht über die Lippen gehen wollte. Hierzu dürfte auch die damals öffentlich geführte Debatte um die ‚deutsche Leitkultur‘ beigetragen haben. Wann immer jemand versuchte, den Kern, die Essenz der ‚deutschen Kultur‘ zu beschreiben, beschlich mich der teils amüsante, teils irritierende Eindruck, dass er oder sie mit einem aussichtslosen Vorhaben beschäftigt war – nämlich, man gestatte mir die saloppe Formulierung, einen Pudding an eine Wand zu nageln. 2008 wurde sogar ein Test eingeführt, den Kandidat_innen für Einbürgerungen seither ablegen müssen und der im Grunde nichts anderes als ein Sprach- und ‚Kulturtest‘ ist. Kritiker wiesen damals darauf hin, dass auch viele gebürtige Deutsche bei diesen Tests Schwierigkeiten hätten (vgl. Haimerl 2010).
Zeitgleich mit meiner Sensibilisierung durch eine gesellschaftliche Debatte nahm auch meine Empfindlichkeit zu, wenn ich mit Stereotypen über ‚die Deutschen‘ oder ‚die deutsche Kultur‘ konfrontiert wurde, unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ waren, ob sie in den Medien oder in persönlichen Begegnungen wiederholt wurden, ob ich in die jeweilige Schublade passte oder eher als Ausnahme galt, welche die Regel angeblich bestätigte. Was bedeutete all dies für die Rede von interkulturellem Lernen und interkultureller Kompetenz, die ← 14 | 15 → meinem Eindruck nach zumindest in Lehrwerken und didaktischen Publikationen für Lehrkräfte ziemlich sorglos geführt wurde? Welches Kulturverständnis dominierte die fremdsprachendidaktische Diskussion?
Eine Durchsicht verschiedener unterrichtspraktischer Publikationen unter diesem Aspekt bestätigte erste Befürchtungen. Dort wurde häufig mit Kulturverständnissen operiert, die sich näher an homogenisierenden und simplifizierenden Alltagstheorien als an der differenzierten Begriffsbildung der Kulturwissenschaften bewegten. Insbesondere war in didaktischen Materialien immer wieder ein Kulturverständnis zu erkennen, welches auf der Vorstellung von mehr oder weniger klar voneinander abgegrenzten Nationalkulturen basierte. Zwar wurde in fremdsprachendidaktischen Diskussionsbeiträgen mit einer gewissen Regelmäßigkeit angemahnt, den Kulturbegriff zu reflektieren und diese problematischen Kulturverständnisse zu vermeiden. Jedoch schienen weder diese Mahnungen noch die deutlichen Worte, die auch aus benachbarten Disziplinen zu hören waren – etwa von dem Philosophen Wolfgang Welsch (1994, 1999, 2010) – auf allen Ebenen der Fremdsprachendidaktik ernst genommen zu werden. Dass es sich dabei, zumindest was didaktische Materialien angeht, nicht nur um meine für dieses Problem inzwischen vielleicht besonders geschärfte Wahrnehmung handelte, belegt eine zur Zeit in Dresden entstehende Dissertation.3
Da didaktische Materialien für die Qualität des tatsächlich stattfindenden interkulturellen Lernens eine wichtige Rolle spielen dürften, halte ich deren kritische Analyse für einen wichtigen Beitrag zur fachdidaktischen Forschung. Nur so lässt sich überprüfen, inwieweit und in welcher Form Beiträge der Theorieebene in Unterrichtsmaterialien tatsächlich aufgegriffen werden und inwieweit sich damit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese theoretischen Überlegungen auch in der Schule rezipiert werden. Mich interessiert dagegen die Frage Was ist Kultur? auf der Ebene der fremdsprachendidaktischen Theoriebildung selbst. Welche Kulturvorstellungen sind in breit rezipierten Grundlagenkonzepten zu Interkulturalität zu finden, auf welche sich alle nachgeordneten Ebenen zumindest mutmaßlich beziehen? Dies zu klären ist eines der Anliegen dieser Arbeit.
Die zweite Frage, die ich mir immer häufiger privat, verstärkt aber auch bei der Beschäftigung mit fremdsprachendidaktischen Themen stellte, ist pädagogisch und politisch mindestens ebenso brisant wie das Denken in den Kategorien homogener Gruppen, denen bestimmte gemeinsame, ‚kulturelle‘ ← 15 | 16 → Charaktereigenschaften zugeschrieben werden. Diese Frage wurde und wird in öffentlichen Debatten teils leidenschaftlich diskutiert, ist jedoch, so scheint mir, in fremdsprachendidaktischen Kontexten kaum präsent. Sie ergibt sich aus der These, dass alle Kulturen, alle Lebensweisen und Vorstellungen in gleichem Maße zu tolerieren und zu schützen seien. Diese These, so mein Eindruck, bildete und bildet die unausgesprochene Prämisse zahlreicher Beiträge zur interkulturellen Fremdsprachendidaktik. Gleichzeitig herrschen jedoch ein großer gesellschaftlicher Konsens und, zumindest auf den Gebieten der sogenannten westlichen Industrienationen, auch rechtliche Verbindlichkeit über die genau entgegengesetzte Haltung, die darin besteht, dass eben nicht jede Art zu sprechen oder zu Handeln akzeptabel ist, auch wenn dies Individuen oder Gruppen möglicherweise als Teil ihrer jeweiligen kulturellen Identität verstehen mögen.
Die zweite Frage lautet somit, wie die interkulturelle Fremdsprachendidaktik zu Weltansichten und Lebensweisen steht, die mit jenen Prinzipien kollidieren, welche aktuell als unverzichtbare Grundlage des friedlichen Zusammenlebens in einer pluralen Gesellschaft angenommen werden. Der Europarat etwa sieht diese Grundlage in den Prinzipien Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und empfiehlt sie allen Bildungseinrichtungen der Europäischen Union als normativen Rahmen ihrer Arbeit (vgl. Council of Europe 2010).
An Konflikten, die sich aus den partikularen Vorstellungen gesellschaftlicher Gruppen und den genannten Prinzipien ergeben, herrscht bekanntlich kein Mangel. Wie ist etwa die Entscheidung von Eltern zu sehen, ihrem Kind auf Grundlage religiöser Überzeugungen die Verabreichung einer Bluttransfusion zu verweigern, auch wenn es dann stirbt? Greift in diesem Fall das Gebot, eine abweichende Weltansicht zu tolerieren (vgl. Dettmeyer 2006: 217–223)? Wie steht es dagegen mit der Zwangsverheiratung von Mädchen – ebenfalls eine kulturelle Praxis, die es als solche zu schützen gilt (vgl. Mirbach et al. 2011)? Und wenn Eltern ihre Kinder ausschließlich streng religiös und fern staatlicher Schulen unterrichten möchten und dabei den Brauch pflegen, ihnen bei Bedarf mit Hilfe einer 30 cm langen Rute Gehorsam zu vermitteln (vgl. Mayr 2013) – handelt es sich dann ebenfalls um eine Gelegenheit für Lernende, „[…] kulturelle Besonderheiten als Bereicherung zu empfinden und sich daran zu erfreuen“ (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin 2006: 11), wie es im Berliner Rahmenlehrplan Spanisch für die Sekundarstufe I heißt?
Auch wenn ich zu Illustrationszwecken plakative Beispiele wähle – wenn die Antwort auf diese Fragen jeweils lautet, dass das mit interkultureller Toleranz natürlich nicht gemeint ist, liegt die Vermutung nahe, dass sich interkulturelles ← 16 | 17 → Lernen eben doch nur auf den Umgang mit harmloser Folklore bezieht, dass man sich ansonsten aus ethisch und politisch relevanten und damit komplizierten Diskussionen aber lieber heraushalten möchte.4
Wohlgemerkt vertrete ich hier keineswegs die Position, dass gesellschaftliche, ‚kulturelle‘ Minderheiten sich eben an die Regeln der dominierenden Mehrheit anpassen müssen. Vielmehr halte ich auch bei den Angehörigen gesellschaftlicher Mehrheiten die Anbahnung der Fähigkeit und der Bereitschaft, das ‚Eigene‘ zu hinterfragen und zu kritisieren, für eine zentrale Aufgabe schulischer Bildung, und diese Aufgabe findet sich auch in fast allen Ansätzen interkulturellen Lernens und Modellen interkultureller Kompetenz (vgl. Byram 1997: 45). Es ist jedoch fraglich, wie genau das ‚Eigene‘ und ‚Fremde‘ in der Arbeit mit einer heterogenen Schülerschaft überhaupt bestimmt werden kann. Ebenso fraglich ist, ob eine ‚interkulturelle‘ Kritikfähigkeit ethisch-politisch neutral sein kann, oder ob sie nicht vielmehr einen normativen, gleichzeitig aber reflexiv erschließbaren Rahmen benötigt. Aktuell verfügt die Fremdsprachendidaktik jedoch – so zumindest mein Eindruck – weder über die für nicht-triviale ethisch-politische Fragen unabdingbaren normativen Setzungen noch reflektiert sie diesen Zustand in angemessener Weise. Der Umgang mit sogenannten ‚kulturellen‘ Konflikten bleibt somit in letzter Konsequenz sowohl für Lehrkräfte als auch für Lernende eine individuelle Entscheidung (vgl. Europarat 20015: 107).
Die vorliegende Arbeit beginnt in den Kapiteln 1.1.–1.7. mit einer ausführlichen Problemstellung in Bezug auf das oben umrissene Kernkonzept fremdsprachendidaktischer Theorie, die Interkulturalität. Diese Problemstellung mündet in die Formulierung von Arbeitshypothesen und Forschungsfragen (Kap. 1.8.). Anschließend folgen methodologische Überlegungen zum Aufbau der Arbeit (Kap. 1.9.). Im daran anschließenden Kapitel 2 werden die kulturwissenschaftlichen Grundlagen gelegt, die zur Bearbeitung der Forschungsfragen benötigt werden. Dabei werden zum einen verschiedene Kulturverständnisse dargestellt (Kap. 2.1.), zum anderen wird das Dilemma von Universalismus und Kulturrelativismus ausführlich erörtert (Kap. 2.2.). Auf dieser Grundlage werden in Kapitel ← 17 | 18 → 3 ausgewählte theoretische Ansätze zum interkulturellen Fremdsprachenunterricht untersucht. Hierdurch wird der Bedarf an einem Zielkonstrukt festgestellt, das zu einer Lösung der zuvor festgestellten zentralen Probleme interkultureller Fremdsprachendidaktik beitragen könnte. Im daran anschließenden theoriebildenden Kapitel 4 werden die Umrisse eines solchen neuen Konstruktes erarbeitet, das als Fremdsprachliche Diskursbewusstheit bezeichnet wird. Der unterrichtspraktische Bezug wird in Form von didaktischen Prinzipien hergestellt, deren Berücksichtigung im Fremdsprachenunterricht zur Anbahnung Fremdsprachlicher Diskursbewusstheit beitragen kann (Kap. 4.5.). Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Ausblick auf Forschungsdesiderata.
1 Wenn ich in dieser Arbeit von ‚Begriff‘ spreche, dann ist der jeweilige Terminus gemeint; ‚Verständnis‘ bezieht sich dagegen auf die jeweilige Bedeutung. Dies geschieht in Analogie zu Ferdinand de Saussures Unterscheidung zwischen signifiant und signifié. Wenn es in dieser Arbeit um einen bestimmten Terminus in einem bestimmten Verständnis geht, dann wird mit dem Ziel besserer Lesbarkeit häufig von einem ‚Begriff‘ gesprochen, während sich das jeweilige Verständnis in einem Adjektivattribut findet, z. B. der „normative Kulturbegriff“ oder der „linguistische Diskursbegriff“ (vgl. v. a. Kap. 2.1. und 4.2.).
2 Auch in der deutschen Medienöffentlichkeit wurde in den Nullerjahren leidenschaftlich über die Begriffe ‚deutsche Leitkultur‘ bzw. ‚europäische Leitkultur‘ diskutiert.
3 Vgl. Klöppner (in Vorbereitung). Bei den untersuchten Lehrwerken handelt es sich nach Auskunft der Autorin um Línea verde, Encuentros Edición 3000, RUTAS Uno und A_tope.com.
4 Der Philosoph Slavoj Žižek sieht den Toleranzbegriff gar als Teil einer neoliberalen kapitalistischen Ideologie. Ich teile seine Einschätzung nicht, sehe aber wie er die Gefahr, dass der Kulturbegriff zur Entpolitisierung von Konflikten eingesetzt werden kann: „Political differences, differences conditioned by political inequality, economic exploitation, etc., are naturalized/neutralized into ‚cultural‘ differences, different ‚ways of life‘, which are something given, something that cannot be overcome, but merely ‚tolerated.‘“ (Žižek 2009: 119)
5 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen, im Folgenden abgekürzt mit GeR.
1.1 Rückblick: Landeskunde als Wissensvermittlung über Nationalkulturen
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielte in der Fremdsprachendidaktik der Begriff der Landeskunde eine wichtige Rolle (vgl. Schumann 2010). Das Konzept der Landeskunde beruhte auf der Grundidee, dass Lernende neben den sprachlichen Fertigkeiten (Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen, Schreiben, sowie Wortschatz und Grammatik) auch ein Grundwissen über das Land, dessen (National-)Sprache sie lernten, und über die „Kultur, Geschichte, Geographie, Politik, dann das Wissen um Alltagssituationen“ (Bischof et al. 1999: 7) vermittelt werden sollte. Im Unterricht für Deutsch als Fremdsprache ging es daher vorwiegend um (West-)Deutschland (manchmal auch um die Schweiz, Österreich oder die DDR), im Englischunterricht um Großbritannien und die USA (Nebenschauplätze stellten Irland, Kanada, Australien und Neuseeland dar), im Französischunterricht ging es um Frankreich (und ein wenig um Québec und den Maghreb), und im Spanischunterricht um Spanien und ausgewählte Länder Lateinamerikas. Dabei wurde durchaus berücksichtigt, dass im Unterricht nicht nur „Faktisches der Zielkultur“ (ebd.) behandelt werden sollte, sondern es sollte auch Wissen über „Wertvorstellungen, Glauben, Konzepte von Raum und Zeit“ (ebd.) vermittelt werden. Trotz dieser Erweiterung der Perspektive wurde die Ausrichtung auf Nationalkulturen im Laufe der 1990er-Jahre immer stärker in Frage gestellt, setzte sie doch einerseits voraus, dass es in sich homogene Zielkulturen gebe, die man durch das Erlernen einer bestimmten Sprache erschließen und verstehen könne, und andererseits, dass die Beschäftigung mit einer bestimmten Sprache zu einem Wissenserwerb über bestimmte Staaten und über die in ihnen als dominant angenommenen Lebensentwürfe verpflichte. Im Fremdsprachenunterricht überwog dabei die Bedeutung der EU-Partner England, Frankreich und Spanien. Dies ließ sich zwar einerseits durch die geographische und politische Nähe zu Deutschland rechtfertigen. Andererseits wurde es immer mehr als problematisch empfunden, das Übergewicht der alten Kolonialmächte unhinterfragt fortzuschreiben.
Details
- Seiten
- 336
- Jahr
- 2017
- ISBN (PDF)
- 9783631703632
- ISBN (ePUB)
- 9783631703649
- ISBN (MOBI)
- 9783631703656
- ISBN (Hardcover)
- 9783631703625
- DOI
- 10.3726/b10728
- Open Access
- CC-BY-NC-ND
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Dezember)
- Schlagworte
- Diskurstheorie Fremdsprachliche Bildung Sprachbewusstheit Kulturrelativismus Universalismus Menschenrechte
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. 336 S., 1 farb. Abb., 3 Tab.