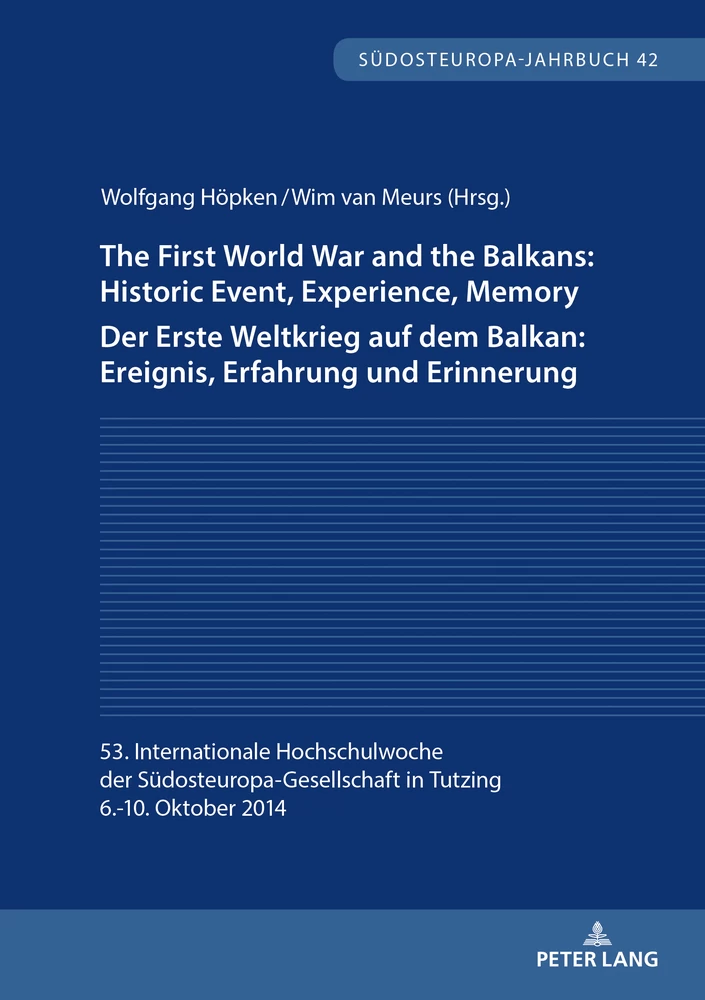The First World War and the Balkans: Historic Event, Experience, Memory Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan: Ereignis, Erfahrung und Erinnerung
53. Internationale Hochschulwoche der Südosteuropa-Gesellschaft in Tutzing 6.-10. Oktober 2014
Zusammenfassung
Die 100-jährige Wiederkehr des Ersten Weltkriegs hat nicht nur die Erinnerung an diese „Urkatastrophe" des 20. Jahrhunderts beflügelt, sondern auch scheinbar ausdiskutierte Fragen seiner Beschreibung und Deutung neuerlich belebt. Dabei hat mit dem Balkan auch derjenige Raum an Bedeutung gewonnen, von dem der Krieg seinen Ausgangspunkt genommen hat. Der Band beleuchtet „Ereignis, Erfahrung und Erinnerung" an den Krieg der Jahre 1914 bis 1918 auf dem Balkan und trägt damit zu einer noch stärkeren Integration Südosteuropas in das Bild des „Großen Krieges" bei.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Über die Autoren
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Contents
- Sarajewo und das Kriegsjahrzehnt auf dem Balkan, 1908-1918 (Wolfgang Höpken, Wim van Meurs)
- Regimes
- Similarities and Particularities of Habsburg Occupation Regimes during the First World War (with a special reference to Serbia) (Tamara Scheer)
- Vereinigung und/oder Besatzung: Bulgariens Kriegsherrschaft in Makedonien 1915–1918 (Björn Opfer-Klinger)
- Italian Plans for the Eastern Adriatic (Vicko Marelić)
- Warfare, experience and society
- Hunger, Diseases, and Bulgarian Women’s Revolts (1916-1918) (Snezhana Dimitrova)
- Political Ideas of Young Bosnia: Between Anarchism, Socialism, and Nationalism (Miloš Vojinović)
- Remembering, memory and history
- “From a People in Ourselves We Become a People for Ourselves” (The Post-war Crisis in Bulgaria—Diagnosis, Criticism, Resolution) (Evelina Kelbecheva)
- Remembering Victory: The Case of Serbia/Yugoslavia (Danilo Šarenac)
- Heroes and Victims: Commemorating the Great War in Romania (Maria Bucur)
- The Three Faces of Gavrilo Princip: Representation of Princip in Yugoslav Cinema (Ivan Velisavljević)
- About the authors
Sarajewo und das Kriegsjahrzehnt auf dem Balkan, 1908-1918.
Zum Stand der Forschung
Wolfgang Höpken, Wim van Meurs
Geschichtsschreibung nach einem Jahrhundert
Die „historische Großoffensive“ 1 aus Anlass der 100-jährigen Wiederkehr des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs ist verklungen. Nach einer beispiellosen, viele Beobachter überraschenden Welle von Publikationen und wissenschaftlichen Konferenzen, an medialer Berichterstattung und Gedenkveranstaltungen, an filmischen und digitalen Popularisierungen, Ausstellungen und Museumsneugründungen scheint wieder „Normalität“ eingekehrt zu sein – in der akademischen Debatte ebenso wie in der Öffentlichkeit. Zwar richtet sich der Blick bereits auf das nächste große, mit dem Ersten Weltkrieg verbundene Zentenarium, das Ende des nämlichen Krieges 19182. Ob diese Jahreszahl zu ähnlichen, vor allem auch zu ähnlich geschichtspolitisch und emotiv aufgeladenen Erinnerungsinszenierungen und Debatten führen wird wie im Falle des Kriegsausbruchs, dürfte allerdings fraglich sein. Bei aller unbestrittenen zäsuralen Bedeutung des Kriegsendes und der damit verbundenen europäischen Neuordnung, so ist zu vermuten, wird dieses Ereignis wohl eher ein Thema für Wissenschaft und Feuilletons bleiben. Unterdessen ist das Jubiläumsjahr 2014 bereits selbst zum Gegenstand erinnerungskultureller Aufarbeitung geworden3. Es sei, so hat Stig Förster angemerkt, „nicht ganz klar, welche Mechanismen eigentlich dazu führen, dass ein bestimmtes historisches Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Mittelpunkt medialer und wissenschaftlicher Aufmerksamkeit rückt“4. Jenseits vermeintlich tagesaktueller Analogien zwischen den Weltlagen von 1914 und 2014 ist in der Beantwortung dieser Frage unter anderem das zeitklimatische Bedürfnis nach einem „europäischen ← 7 | 8 → Gedächtnis“ ausgemacht worden, welches den Weltkrieg in Zeiten wachsenden Euroskeptizismus zum Beleg einer gemeinsamen transnationalen „europäischen Schmerzkultur“ habe werden lassen, auf die sich „europäische Identität“ aufbauen lasse5. Eine derartige erinnerungstheoretische Verortung der Jubiläumseuphorie mag einiges für sich haben; sie ist jedoch stark durch den Blick auf Westeuropa konturiert und sie überschätzt vielleicht auch die transnationalen Aneignungsmodi dieses Ereignisses in den einzelnen europäischen Regionen und Gesellschaften. In Osteuropa, Ostmitteleuropa und nicht zuletzt auf dem Balkan nämlich sind Intensität und Machart der Erinnerung auch im Umfeld des Jubiläumsjahrs 2014 ausgesprochen divergent ausgefallen und auch durchaus nicht vorrangig vom Impetus eines solchen opferzentrierten, europäischen Erinnerungsbedürfnisses geprägt gewesen. In den ostmitteleuropäischen Staaten, wo der Krieg in der Zeit des Sozialismus und der sowjetischen Dominanz ohnehin nur dosiert im Narrativ der eigenen Nationalgeschichte verankert werden konnte, tut man sich bis heute schwer, den Krieg anders denn in seiner die eigene Nationalstaatlichkeit generierenden Rolle zu verorten. Ihn als gemeinsame europäische „Urkatastrophe“ zu deuten, kollidiert hier mit dem Umstand, dass es eben dieser Krieg war, der die ungeliebte Zugehörigkeit zu multinationalen Imperien beendete und die lange erhoffte nationale Eigenstaatlichkeit Wirklichkeit werden ließ6. „Peoples“, so John Horne, „that joined the war as part of multi-national empires, and only formed nation-states as a consequence of the war, found it hard to construct a national history from the conflict itself”7. Das Jahr 1918 bleibt hier denn auch wichtiger für das kollektive Gedächtnis als das Jahr 1914. Mehr noch stoßen die narrativen Bewältigungsstrategien des Krieges dort an ihre Grenzen, wo dieser, wie etwa in Kroatien, nicht nur aus der Perspektive der Zugehörigkeit zu einem „fremden“ Imperium zu beschreiben ist, sondern wo selbst die am Ende des Krieges stehende, neue jugoslawische Staatlichkeit negativ besetzt ist. Nicht einmal als Auftakt zur „nationalen Befreiung“ vermag man dem Krieg daher hier einen Platz im Gedächtnispantheon der Nation einzuräumen. Der Zagreber ← 8 | 9 → Zeithistoriker Tvrtko Jakovina hat denn auch von einer „100 years long Croatian silence on the Great War“ gesprochen8. Nicht nur in Ostmitteleuropa, sondern auch in Ländern wie Bulgarien oder Rumänien hat die Jubiläumseuphorie verglichen mit Westeuropa nur verhaltenen Widerhall gefunden. Dies dürfte nicht nur damit zu tun haben, dass beide erst ein bzw. zwei Jahre später in den Krieg eingetreten sind, sondern auch hier verweigern sich vor allem nationale Lesarten einer gesamt-europäischen, transnationalen Ausdeutung des Ereignisses. Rumänien, das dem Krieg seine bis heute glorifizierte Verwirklichung des nationalen Traums eines „Groß-Rumänien“ verdankt, dürfte wenig Veranlassung sehen, diesen als eine „europäische Tragödie“ zu beschreiben9. In Bulgarien wiederum werden Krieg und Niederlage bis heute vor allem als „nationale Katastrophe“ erinnert, mit der die ungebrochen als nationalstaatliches Ideal hochgehaltenen Einigungsvisionen eines „San-Stefano-Bulgarien“ ein weiteres Mal gescheitert seien. Weit entfernt von jeder opferzentrierten und transnationalen Geschichtsperspektive ist das Jubiläumsbild des Krieges allemal in Ländern wie Russland oder Serbien. Im ersteren Fall, wo der Erste Weltkrieg zu Zeiten der Sowjetunion zwar nicht völlig aus dem Gedächtnis verschwunden war, die Erinnerung an ihn sich zumindest im öffentlichen Raum jedoch nie gegen die dominante Erinnerungs-figur des „Großen Vaterländischen Krieges“ zur Geltung bringen konnte10, ist er seit dem Ende der UdSSR und gerade auch im Jubiläumsjahr 2014 zwar ins öffentliche Gedächtnis zurückgekehrt; auch hier jedoch nicht aus einer transnationalen „Schmerzkultur“ heraus, sondern als Teil einer neo-imperialen Geschichtspolitik11. Nicht weniger hat auch in Serbien, in den öffentlichen Gedenkinszenierungen wie im akademischen und publizistischen Diskurs, die ← 9 | 10 → auch hier exzessive Erinnerungskonjunktur des Jahres 2014 fast völlig im Zeichen einer Reifizierung eines nationalen Helden- und Viktimisierungsmythos gestanden, gegen den sich die wenigen Gegentendenzen eines kritisch selbstreflexiven Blicks auf die eigene Geschichte kaum haben zur Geltung bringen können12. Wer in diesem Festhalten an primär nationalen Lesarten des Krieges einen „balkanischen Sonderweg“ entdecken möchte, der sei daran erinnert, dass auch in Westeuropa das Bemühen, dem Ereignis eine transnationale und europäische Erinnerungsdimension zu geben, nicht ohne Brüche geblieben ist. Schon für Österreich ist auch im Jubiläumsjahr, jenseits der auch hier Auftrieb gewinnenden akademischen Produktion und abgesehen von dem emotiv besonders aufgeladenen Krieg in den Alpen, nur eine relativ geringe Erinnerungsbereitschaft in der Gesellschaft diagnostiziert worden13. Und die deutsch-französischen Bemühungen um ein prononciert transnationales Gedenken trafen schon in Großbritannien auf keine vergleichbare, zumindest keine ungeteilte Zustimmung, mochte man sich doch hier auch 100 Jahre nach dem „Großen Krieg“ nicht völlig vom Gedenken des Sieges zugunsten eines allgemeinen und transnationalen Trauerns verabschieden14. Jay Winters und Antoine Prosts Bilanz aus Anlass des 90. Jahrestags des Kriegsausbruchs 2004, wonach die „Macht der nationalen Rahmung“ der Erinnerung an den Krieg immer noch stark sei15, hat jedenfalls, so scheint es, auch ein Jahrzehnt und einen runden Kalendertag später ihre Gültigkeit noch kaum eingebüßt.
In der Erinnerungseuphorie des Jubiläums, die der ohnehin schon kaum mehr zu überblickenden Literatur einen weiteren Schub hinzugefügt hat16, ist überdies ← 10 | 11 → verloren gegangen, dass der Erste Weltkrieg nie verschwunden war - aus dem kulturellen Gedächtnis nicht, auch wenn er hier gelegentlich von der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg überlagert wurde, und schon gar nicht aus der Forschung. Vor allem in der Geschichtswissenschaft war er und blieb er trotz allen Forschungsaufwands ein immer wieder aufs Neue aufgegriffenes Thema, bei dem „at no time there has been a consensus that the history of the Great War has been written once and for all“17. Und er war und blieb auch stets ein umstrittener Gegenstand, „with each consensus proving fragile and short-lived“18. Die Geschichte der Geschichtsschreibung zum Ersten Weltkrieg ist mittlerweile gut aufgearbeitet und die Autoren haben dabei in weitgehender Übereinstimmung, zumindest mit Blick auf Westeuropa und wenn auch mit unterschiedlichen zeitlichen und inhaltlichen Ausprägungen, einen Wandel dreier paradigmatischer „Konfigurationen“ ausgemacht19. ← 11 | 12 →
Eine erste Konfiguration begann schon im Kriege selbst und unmittelbar nach seinem Ende. „From the start“, wie John Horne es rückschauend bilanziert hat, „the Great War had commemorative power“20. Es war dies die Zeit der „Farbbücher“, der großen Akteneditionen und Dokumentensammlungen, deren ganz vorrangiges Ziel die Legitimierung der Politik der beteiligten Staaten vor und nach dem Kriege war21. Auch wenn professionelle Historiker nur selten Teil dieser Aktivitäten waren, so brachen sie, sofern sie sich daran beteiligten, auch nur selten aus dieser nationalen Selbstverpflichtung aus. Zu einer akademischen Standards genügenden Darstellung des Krieges gelangte man so kaum, nicht nur in Deutschland nicht, wo der Legitimationsdruck im Angesicht der Kriegsniederlage und des Versailler Friedensvertrags besonders groß war. Methodisch kamen diese frühen Arbeiten nur selten über einen „view from ← 12 | 13 → above“ hinaus, der ganz auf die Entscheidungsträger und die „große Politik“ gerichtet war22, und von ihren Zielsetzungen her standen sie fast durchgängig, vor allem in Deutschland, aber nicht nur hier, ganz im Zeichen der „Kriegsschuldfrage“. Erst in den 1930er Jahren fand man in Lloyd Georges Diktum vom „Hineingeschlittert sein“ in den Krieg einen stillschweigenden Konsens, hinter dem freilich die Grundauffassungen über die jeweilige Verantwortlichkeit des Anderen zwischen den Regierungen ebenso wie zwischen den jeweiligen Nationalhistoriographien erhalten blieben.
Es war dies eine Selbstverständigung, die in (West-)Deutschland auch das Ende des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges „nahtlos“ überstand. In den politisch nunmehr im Zeichen der Westintegration gebotenen Aussöhnungsbemühungen mit Frankreich wurde sie sogar, z. B. in den frühen deutsch-französischen Schulbuchgesprächen, affirmiert und erodierte erst seit den frühen 1960er Jahren durch die „Fischer-Kontroverse“. Die Debatte und politische Auseinandersetzung um Fritz Fischer und seine Thesen sind oft beschrieben und mittlerweile selbst Gegenstand historiographiegeschichtlicher Diskussionen geworden; sie sollen daher an dieser Stelle nicht erneut aufgerollt werden23. Fischers Arbeiten brachen bekanntlich mit zwei Prämissen eines auch über die Zäsur des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs hinaus „zementierten Deutungsparadigmas“ (Krumeich) der deutschen Geschichte: der These vom Verteidigungskrieg, der dem Deutschen Reich aufgezwungen worden sei sowie dem „Versöhnungskonsens“ eines allgemeinen „Hineingeschlittert sein“ in den Krieg. Dagegen setzte Fischer die These einer von deutscher Seite systematisch geplanten Kriegsauslösung zum Zwecke eines deutschen „Griffs nach der Weltmacht“24. In diesem Weltmachtstreben, und darin gewannen Fischers Arbeiten den Charakter einer über die Detailfrage der Kriegsursache hinausgehenden Revision der gültigen bundesdeutschen „Meistererzählung“ der deutschen Geschichte, verband sich für ihn die Politik ← 13 | 14 → des späten Kaiserreiches mit jener Hitlers, der nun nicht mehr als „Betriebsunfall“ erschien, sondern am radikalisierten Ende einer Kontinuität deutscher Machtpolitik stand. Der deutschen Seite kam so für Fischer zwar nicht, wie ihm bis heute immer wieder unterstellt wird, die „Alleinschuld“ am Kriegsausbruch zu, wohl aber ein „erheblicher Anteil“, den Fischer in späteren Arbeiten zu einem „entscheidenden Anteil“ aufwertete25. Die aus der Rückschau hysterischen Debatten, welche Fischer nicht nur in der Historiker-Zunft, sondern auch in der Öffentlichkeit und der Politik auslösten und welche die „Fischer-Kontroverse“ für manche zur einflussreichsten zeitgeschichtlichen Kontroverse der Bundesrepublik überhaupt machen, sind nur aus den zeitklimatischen Umständen der 1960er Jahre heraus zu verstehen, erschütterten seine Thesen doch eine in der Zeit des Frankfurter Ausschwitz-Prozesses, des Mauer-Baus und der „Spiegel-Affäre“ ins Wanken geratene Selbstvergewisserung der jungen Bundesrepublik. Darin lag ihre über alles Wissenschaftliche hinausgehende Bedeutung für die Entwicklung eines selbstreflexiven Verhältnisses zur jüngeren Geschichte und eine liberale Erneuerung der politischen Kultur der bundesdeutschen Gesellschaft26. Für die Zunft der Historiker wiederum war Fischers Wirkung auch deswegen so verstörend, weil er nicht nur mit den eingeschliffenen Interpretamenten der jüngeren deutschen Geschichte brach, sondern weil er, wie es Konrad Jarausch formuliert hat, ein „unerwarteter Rebell“ war27. Nicht mehr der Generation der Ersten Weltkriegsteilnehmer angehörend, wie seine Opponenten Ritter und Zechlin, methodisch aber von gleichem, durchaus konventionell diplomatiegeschichtlichem Schlage, politisch zudem wie so viele andere seiner Zeit mit dem Gepäck eigener Anpassung an die NS-Herrschaft behaftet28, erfolgte dieser Angriff gewissermaßen aus dem inneren Kreise der etablierten Zunft heraus.
Der Bruch mit der überkommenen Deutung eines ungewollten „Verteidigungskrieges“, an dem man nicht mehr Verantwortung getragen habe als andere, bedeutete zwar die überfällige Überwindung wissenschaftlich fragwürdiger Sichtweisen, die sich nie aus der politisch motivierten Verteidigungssemantik des „Kampfes gegen die Kriegsschuldlüge“ der ← 14 | 15 → Zwischenkriegszeit befreit hatten. In dem Maße, in dem sich Fischer mit seinen Thesen in der Zunft und in der Gesellschaft etablieren konnte, etablierte sich aber zugleich auch eine interpretatorisch „neue Orthodoxie“29, deren wissenschaftliche Grenzen schon bald erkennbar wurden. Blieb die von Fischer ins Spiel gebrachte These von der besonderen deutschen Verantwortung nicht nur als akademischer Deutungskonsens, sondern auch als Teil einer politischkulturellen Selbstverortung der Bundesrepublik der 1970er Jahre dabei auch erhalten, so gerieten seine Thesen eines systematisch vom Deutschen Reich ausgelösten Krieges und einem dahinter stehenden „Griff nach der Weltmacht“ zunehmend unter Druck30. In dem Maße, in dem - anders als bei Fischer, der ganz auf Berlin geschaut hatte - auch andere Staaten und ihre Akteure in den Blick genommen wurden, differenzierte sich auch das Bild der Kriegsauslösung deutlich aus. Österreich-Ungarn, bei Fischer nur "willenloser Arm Berliner Politik“, etwa geriet, zunächst in den Arbeiten Rauchensteiners, dann vor allem Kronenbitters, als eigenständiger Akteur in den Blick, von dem die Dynamik der Kriegsauslösung ganz maßgeblich mit beeinflusst worden war. In den Arbeiten Mommsens, Jolls, Krumeichs, Afflerbachs oder auch Wehlers erschien die durchaus als aggressiv gewertete Politik des Reiches nicht als Ausdruck eines offensiven und selbstbewussten Weltmachtstrebens, sondern eher als ein aus dem Gefühl der Defensive heraus erfolgter, ebenso „rücksichtsloser wie desperater Abwehrkampf“ eines Reichs in der Krise31. Damit geriet, schon lange vor den jüngsten Forschungen Cristopher Clarks, die Kontingenz des Kriegsausbruchs stärker in den Blick und „die zunehmende Kenntnis der Wechselseitigkeit der Verantwortlichkeiten [begann] die … von der Fischer-Schule scheinbar gewonnenen eindeutigen Einsichten wieder aufzulösen“32. Fischers Thesen verloren so schon bald einen Teil ihrer Geltungskraft in der Historiker-Zunft, ohne dass dadurch der Kern seiner Deutung, die besondere deutsche Verantwortung für den Krieg, im Grundsatz bestritten worden wäre.
Der dominant diplomatiegeschichtliche Blick auf den Krieg, der selbst die Fischer-Kontroverse noch bis in die 1960er Jahre bestimmte, wich in Ländern wie Frankreich und England schon früher einer „zweiten Konfiguration“, die den Blick nunmehr weg von den großen Akteuren und Entscheidungsträgern und hin ← 15 | 16 → zu den sozialen Gruppen, von der Politikgeschichte hin zur Sozialgeschichte, lenkte33. In der deutschen Forschung kam dieser Paradigmenwechsel erst im Nachgang zur Fischer-Kontroverse zum Tragen, und er war auch nur sehr bedingt durch die Arbeiten Fischers (und seiner Schüler) angeregt, auch wenn diese zum Zwecke der Fundierung ihrer Kontinuitätsthesen zunehmend den Blick über das Politische hinaus zu richten begannen34. In Arbeiten wie Jürgen Kockas „Klassengesellschaft im Krieg“ wurde der Blick jetzt auch hier stärker auf die sozialen Gruppen und die sozialgeschichtlichen Rahmenbedingungen des Krieges gerichtet. Allerdings, und dies war der Preis für die Überwindung der früheren Dominanz einer politikgeschichtlichen Betrachtung, geriet mit dem damit einhergehenden strukturgeschichtlichen Zugang auch das eigentliche Kriegsgeschehen, das schon im politikgeschichtlichen Paradigma hinter der Bühne der großen Politik verloren gegangen war, aus dem Blick.
Dieses elementare Kriegsgeschehen gewann erst mit dem Übergang zu einer „dritten Konfiguration“ Konturen, die nun, vor allem mit den 1980er und 1990er Jahren, ganz im Zeichen einer Kulturgeschichte des Krieges stand. Nach den „großen Akteuren“ und Entscheidungsträgern und den sozialen Gruppen gerieten jetzt die Subjekte und ihre Erfahrungen in den Blick35. Die „Suche nach dem Alltag“ (Hirschfeld/Krumeich) brachte die Kriegserfahrungen der Soldaten und Zivilisten ans Licht, fragte nach den Emotionen im Angesicht des Schreckens, nach Trauer, Erinnerung und Verarbeitung. Frauen- und geschlechterspezifische Erfahrungen des Krieges, bis dahin weithin ignoriert, wurden zum Gegenstand. Im Blick auf die unmittelbare Konfrontation mit dem Tod und dem Töten lenkte die Kriegshistoriographie als eine „Kriegsgeschichte, die vom Tode spricht"36, ← 16 | 17 → die Aufmerksamkeit auf das Elementare des Krieges37. Die immer schon etablierte, jedoch vor allem im deutschsprachigen Raum nach 1945 marginalisierte Militärgeschichte des Ersten Weltkriegs fand so als „Militärgeschichte in der Erweiterung“ zurück in die Debatten38. Anders als bei Fischers Suche nach Kontinuitäten der Weltmachtpolitik zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus rückte aus dieser Perspektive die Frage der Kontinuitäten von Gewalthandeln zwischen Erstem und Zweitem Weltkrieg in den Blick. Der Erste Weltkrieg erschien dabei als „Laboratorium“ und „testing ground“ radikalisierter Gewaltpraktiken des Zweiten39, auch wenn anfängliche „Brutalisierungsthesen“, welche den Nexus zwischen den beiden Gewaltexzessen eng gezogen hatten, dabei zunehmend widerlegt wurden. „Erinnerung“ war zwar in Gestalt von Paul Fussels Pionierarbeit40 schon vor dem „memory Boom“ der 1990er Jahre ein Thema der Historiographie des Ersten Weltkriegs gewesen. Neben Ereignis und Erfahrung wurde sie aber im Kontext des Aufschwungs des Erinnerungsparadigmas nunmehr zum integralen Aspekt jeder Kriegsgeschichte. Beginnend mit Jay Winters westeuropäischem Vergleich des Kriegsgedenkens schloss sich daran für fast alle Länder und alle medialen Ausdrucksformen des Gedenkens eine umfassende Aufarbeitung der Verarbeitung und der Repräsentation des Krieges in den Nachkriegsgesellschaften an41, die, worauf zurückzukommen sein wird, auch den Südosten Europas nicht aussparte. In Gesamtdarstellungen des Krieges haben derartige kultur- und erfahrungsgeschichtlichen Zugänge auch auf der Ebene der „großen Synthesen“ die Literatur zum Weltkrieg über die politikgeschichtliche Ebene hinausgeführt42. Die kulturgeschichtliche Wende hat zweifelsohne zu einer erheblichen Perspektiverweiterung des Kriegsbildes beigetragen und die Diskussion über den sich erschöpfenden Blick auf die Frage nach Kriegsschuld, den Primat der Außenpolitik, aber auch über die innergesellschaftlichen strukturgeschichtlichen Rahmenbedingungen und ← 17 | 18 → Konsequenzen des Krieges hinausgelenkt. Es war dies jedoch eine paradigmatische Erweiterung, die weithin im innerakademischen Bereich verblieb und die, anders als die Fischer-Kontroverse, die Öffentlichkeit wenig beeinflusste43.
Das Zentenarium hat dieser Forschungsbilanz quantitativ vieles hinzugefügt, es hat auch Deutungsperspektiven neu justiert; eine neue, „vierte Konfiguration“ der Weltkriegsgeschichtsschreibung aber hat das Jubiläum wohl nicht eingeläutet. Fragt man nach paradigmatischen Neuerungen in der jüngsten Konjunktur der Kriegshistoriographie, so dürften sie am ehesten noch in der mittlerweile nachdrücklichen Betonung der Transnationalität und Globalität des Ereignisses zu erkennen sein, in der sich der generelle „turn“ hin zu globalgeschichtlichen Fragestellungen in der Geschichtswissenschaft abbildet. Eine stärker transnationale und globale Perspektive war zwar auch schon zuvor angemahnt worden. So hatte Hew Strachan 2008 auf die „perverse Reaktion“ der Historiker aufmerksam gemacht, auf ein Ereignis elementar globalen Charakters mit einem „narrowing (of) their perspectives“ im nationalstaatlichen Rahmen reagiert zu haben und mehr „Transnationalität“ der Analyse eingefordert44. Insbesondere dort, wo man sich der erfahrungsgeschichtlichen Dimension des Krieges zugewandt hatte, war dies auch durchaus bereits in die Forschungen eingeflossen, waren doch Mentalitäten und Kriegserfahrungen in den „nationalen frames“ einer nationalstaatlichen Betrachtung kaum sinnvoll zu verankern. Erst im Umfeld der Jubiläumskonjunktur des Kriegsausbruches aber haben globalgeschichtliche Zugänge und Fragestellungen an Fahrt gewonnen45. Stig Förster hat gar bilanziert, dass „die Entdeckung der globalen Dimension des ersten Weltkrieges die vielleicht wichtigste Neuerung in der Erforschung des Konfliktes“ darstelle46. Die selbst noch im Jubiläumsjahr verfochtene These, dass die Weltkriegsforschung immer noch dominant auf Deutschland und Westeuropa ausgerichtet sei47, wird man daher in dieser Form kaum mehr aufrechterhalten können. Oliver Janz und andere haben dabei auf den geradezu ← 18 | 19 → inhärent globalen Charakter des Weltkrieges verwiesen – als Krieg, der nicht nur militärisch auf verschiedenen Kontinenten ausgetragen worden ist, der in der Rekrutierung seiner Kombattanten und der Mobilisierung von Ressourcen global war, der elementare Auswirkungen auch auf jene Regionen hatte, in denen nicht gekämpft wurde und der nicht zuletzt auch in seiner medialen Repräsentation globale Ausmaße erreichte48.
Die Leistungsfähigkeit einer solchen „globalisierten“ Weltkriegsgeschichte sind dabei gleichwohl noch offen. Vor überzogenen Erwartungen haben Winter und Prost gewarnt, nicht nur weil die Macht nationaler Narrative für einen Krieg, der eben ein Krieg der Nationalstaaten war, immer noch stark sei, sondern weil es auch strukturelle Grenzen einer solchen „Globalgeschichte“ des Weltkrieges gebe. „It may be possible“, so die Autoren, „to configure some kind of global history about particular subjects […] but these histories are not histories of the war itself, as a global phenomenon“49. Ob sich eine derartige Skepsis gegenüber einer allenthalben an Selbstbewusstsein gewinnenden Globalgeschichte bewahrheitet, bleibt abzuwarten. Dass von globalgeschichtlichen Zugängen nicht nur ein „broadening the geographical view“50, sondern eine deutlich differenziertere Wahrnehmung des Krieges jenseits eines lange dominierenden (West-)Eurozentrismus ausgegangen ist, ist kaum zu übersehen.
Wird man die Globalisierung des Kriegsereignisses als Schritt zu einer auch methodischen Erweiterung historiographischer Betrachtungen des Weltkrieges werten dürfen, so stand das Zentenarium ansonsten im Zeichen einer Rückkehr zu methodisch wie von der Fragestellung her eher konventionellen Zugängen. Vor allem dort, wo die Geschichte des Krieges öffentliche Debatten auslöste, war es die Revitalisierung einer alten Frage, nämlich jener der „Kriegsschuld“, welche die meiste Aufmerksamkeit erregte. Hatte Gerd Krumeich 1996 noch bilanzieren können, dass nach der „Fischer-Kontroverse“, ungeachtet manch berechtigter Kritik an seinen Thesen, die „überwiegende Verantwortung“ Deutschlands am Ausbruch des Weltkrieges anerkannt sei und „diese Forschungsfrage nicht mehr besteht"51, so geriet eben diese Verantwortung Deutschlands 50 Jahre nach Fischers „Kriegsschuld-These“ neuerlich in die ← 19 | 20 → Diskussion. Christopher Clarks große und (vor allem in Deutschland) öffentlichkeitswirksame Neujustierung des Bildes des Kriegsausbruchs hat dazu zweifelsohne Entscheidendes beigetragen. Auch wenn Clark sich von einer Wiederauflage des „blame game“ um die Verantwortlichkeit für den Krieg distanzierte, so war es gleichwohl gerade diese Frage, die in den Vordergrund beinahe aller Debatten rückte. Und damit gewann auch eine wieder stark am Primat des Außenpolitischen und des „großen politischen Handelns“ ausgerichtete Betrachtungsweise des Weltkriegs neuerlich an Resonanz. Jene Fragen der „Kriegskultur“ und des „Kriegsalltags“, von der im Jahrzehnt zuvor die produktivsten Erweiterungen der Erforschung des Krieges ausgegangen waren, mögen nicht verloren gegangen sein52, wurden in der Jubiläumskonjunktur demgegenüber wieder deutlich in den Hintergrund gedrängt53.
Die mittlerweile selbst kaum mehr zu überblickende Debatte um Clarks Werk ist sich, ungeachtet aller Bewertungen im Einzelnen, dabei in der Würdigung zweier Leistungen des Autors einig: zum einen darin, dass der Autor wie kaum jemand vor ihm die nationalstaatliche Verengung der Perspektiven, die Fischers Arbeiten dominierte und die auch von der nachfolgenden Forschung nicht wirklich überwunden worden sei, durch einen multilateralen Ansatz ersetzt habe, der das Wechselspiel der internationalen Akteure zur zentralen Achse der Ausdeutung des Kriegsausbruchs macht. Hatten andere schon vor ihm Fischers Fixiertheit auf Deutschland aufgebrochen, indem sie die Rolle der anderen Akteure ins Licht rückten, so ist es doch Clark gewesen, der dies im Sinne einer multilateralen Perspektive zusammengeführt hat. Als zweiter Gewinn der Clarkschen Arbeit wird zumeist hervorgehoben, dass er mit dem von ihm an den Anfang gestellten Blick auf Serbien den balkanpolitischen Ursprungskontext des Weltkrieges in die Betrachtung zurückgeholt habe. Südosteuropa-Historiker wie Holm Sundhaussen hatten die zum Teil völlige Ausblendung Serbiens in der Weltkriegsforschung schon lange vor Clark angemerkt und beklagt, dass der Name des Attentäters des 28. Juni Gavrilo Princip in Fritz Fischers Werken kein einziges Mal, der des serbischen Ministerpräsidenten Pašić nur beiläufig ← 20 | 21 → Erwähnung gefunden habe54. Dies ist mit Clark korrigiert, der Serbien zu einem der zentralen Akteure der Juli-Krise des Jahres 1914 aufgewertet hat.
Gerade jene beiden Aspekte haben freilich auch die Kritik an Clarks Neudeutung provoziert. Die Multilateralisierung der analytischen Perspektive, so ist zum einen eingewandt worden, führe zu einer Nivellierung der Verantwortung, die letztlich in einem „step back towards Lloyd George“ ende55. Widerspruch hat dabei vor allem die Neugewichtung der Rolle Deutschlands hervorgerufen. Auch wenn Clark die deutsche Rolle dabei „nicht kleinreden“ will, so läuft seine Schlussfolgerung vom Krieg als „Tragödie“, die durch eine von allen Mächten geteilte politische Kultur der „Paranoia des Krieges“ ausgelöst worden sei56, letztlich auf eine Entlastung der Rolle Deutschlands hinaus, mit der er nicht nur die (vermeintliche) „Alleinschuld-These“ Fischers korrigiert, sondern auch hinter jene zurückfällt, die in dieser Hinsicht selbst schon längst über Fischer hinausgegangen waren. Stig Förster sah denn auch in Clarks Neubewertung der Rolle Deutschlands eine gravierende Unterbewertung der aggressiven Politik Deutschlands57; Gerd Krumeich, der selbst Fischers Thesen als „schrecklich veraltet“ und „wirklich überholt“ ad acta gelegt hatte, wollte sich von der besonderen Verantwortung Deutschlands (und Österreichs) nicht verabschieden. Wenn auch andere geholfen hätten, den „Brennstoff“ anzusammeln, der das Pulverfass in Brand steckte, so bleibt es auch für Krumeich dabei, dass die Mittelmächte hierfür die „Hauptverantwortung“ tragen58. Annika Mombauer schließlich, hier wohl noch am dichtesten an Fischers Deutung, sah auch in Clarks Quellen keine hinreichenden Belege dafür, von der besonderen Rolle Deutschlands Abstand zu nehmen. Mochten Petersburg und Paris auch „bereit und vielleicht sogar erfreut (gewesen sein), die Gunst der Stunde zu nutzen“, so seien es letztlich doch eben Berlin und Wien gewesen, welche den „Hauptteil der Verantwortung“ für den Kriegsausbruch trügen, weil allein sie es „auf den Krieg abgesehen“ und „an einer friedlichen Lösung von vornherein nicht das geringste Interesse (gezeigt hätten)“59. Wenn Herfried Münkler im Jubiläumsjahr 2014 meinte, die Thesen Fischers noch einmal dadurch entsorgen zu müssen, dass er ← 21 | 22 → sie für nicht einmal mehr „proseminarfähig“ erklärte60, so spricht daraus nicht nur die unangebrachte Überheblichkeit desjenigen, der das Privileg hat, seine eigenen Arbeiten zum Thema auf den Schultern einer fünfzig Jahre fortgeschrittenen Forschung zu verfassen. Es ignoriert auch die zeitklimatischen Rahmenbedingungen, unter denen Fischer seinen Angriff auf ein überholtes und ideologisch kontaminiertes Nationalnarrativ der jüngeren deutschen Geschichte verfasste, und es übersieht, dass allen Revisionstendenzen zum Trotz, auch heute noch ein Kern der Fischerschen Argumentation, nämlich jener einer besonderen deutschen Verantwortung für den Kriegsausbruch, von einem bedeutenden Teil der Historiker offenbar weiterhin geteilt wird61.
Auch die Neuvermessung anderer Akteure in Clarks großem Interpretament ist nicht unwidersprochen geblieben. Die Rolle Österreichs, auch sie war bei Fischer weithin auf die Rolle eines Juniorpartners des Reiches reduziert worden, war bereits vor Clarks Buch stärker in ihrer Verantwortung für den Kriegsausbruch gewichtet worden62. Gegen Clarks weitgehende Entlastung Wiens hat nun auch die zum Jubiläum erschienene monumentale Gesamtschau Manfried Rauchensteiners auf die den Krieg herbeihandelnde Rolle Wiens verwiesen. Wenngleich auch Russland „sein gerüttelt Maß zur Entfesselung (des Krieges) beitrug", und auch die anderen wenig taten, um dies zu verhindern, so sei es doch „Österreich-Ungarn (gewesen), das die Fesseln löste“ und das Deutsche Reich habe ihm dabei „immer dann die Hand geführt, wenn diese zittrig zu werden drohte“63. In eine ähnliche Richtung wie Rauchensteiner gehend hat auch Marvin Fried dabei gerade auf die balkanpolitischen Kriegsziele Wiens als die stabilen Motive eines aktiv vorangetriebenen österreichisch-ungarischen Kriegsinteresses verwiesen64. Russlands Aufwertung zu einer kriegstreibenden Macht, ← 22 | 23 → mit der Clark weithin dem von Sean McMeekin vorgezeichneten Bild folgt, das in Russlands Streben nach den Meerengen den Hintergrund für die Bereitschaft zum Krieg sieht, hat demgegenüber weniger Gegenrede hervorgerufen. Während Österreich einen lokal gedachten Krieg gegen Serbien gewollt habe, Deutschlands „Schuld“ darin liege, Wien mit seinem „Blankoscheck“ ermutigt zu haben, Großbritanniens Politik von „Blindheit und Fehlern“ geprägt gewesen sei, so war es schon für McMeekin vor allem Russland, das, hierin unterstützt durch Frankreich, mit seiner frühen Mobilmachung „die Entscheidung für einen europäischen Krieg“ getroffen habe65. Auch an dieser Deutung der russischen Politik aber sind Zweifel angemeldet worden, so vor allem bei Dominic Lieven, bei dem Akteure, Entscheidungsprozesse, ideologische Hintergründe und Motive der russischen Politik ungleich widersprüchlicher erscheinen als es das Bild einer präzisen imperialen Plänen folgenden und zielgerichteten Kriegsauslösung im Juli 1914 suggeriert. Auch Clarks Neudeutung dürfte die Frage der „Kriegsschuld“ damit wohl keineswegs so eindeutig geklärt haben, wie es ihm mancher Rezensent im Überschwang über seine vor allem auf Deutschland bezogenen Revisionismen attestiert hat. Sie bleibt auch weiterhin wohl nur eine mögliche Antwort und bestätigt die eingangs dieses Beitrags referierte Behauptung William Mulligans, dass eben jeder scheinbare Konsens über die Ausdeutung des Krieges sich als fragil erwiesen habe.
Zumindest in der deutschen Resonanz lag die eigentliche Bedeutung der „Schlafwandler“ wohl auch weniger in den akademischen Thesen des Autors denn in seiner geschichtspolitischen Wirkung. Nicht ohne Grund ist die öffentliche Reaktion auf den Clarkschen Bestseller als „geschichtspolitische Weichenstellung“ gedeutet worden, hinter der, so Volker Ulrich, auch das „Entlastungsbedürfnis“ stecke, wenigstens nicht auch noch am Ersten Weltkrieg schuld sein zu müssen. Es tue, so ergänzt Annika Mombauer, „dem deutschen Nationalgefühl sichtbar gut, von der Kriegsschuld befreit zu sein“66. Aus geschichtspolitischer Sicht wird man die neuerliche Debatte um die Kriegsschuld wohl in der Tat nicht völlig von anderen Versuchen in den vergangenen Jahren lösen können, etablierte geschichtskulturelle Selbstverortungen der bundesdeutschen Gesellschaft infrage zu stellen. Wenn Dominik Geppert und andere in einer Art programmatischen Stellungnahme zum Kriegsausbruch 1914 Russland eine expansionistische Kriegstreiberei unterstellen, Frankreich die ← 23 | 24 → Bereitschaft zum Waffengang zuweisen, Englands Politik und Kriegseintritt als entscheidenden Schritt zum „europäischen Kriegsdesaster“ werten und Österreich nicht als willenlosen Juniorpartner Berlins abtun, so mag sich diese holzschnittartige Verantwortungsnivellierung noch im Einklang befinden mit vielen der auf Fischer folgenden Forschungen. Deutschland demgegenüber das „defensive Ziel“ der Wiederherstellung einer „prekären“ und begrenzten Hegemonie zuzuschreiben67, lässt sich allerdings kaum anders denn als eine Entlastungsrhetorik lesen. Sie ist nicht nur, wie die oben referierten Literaturmeinungen namhafter Weltkriegsforscher zeigen, von der Forschung nach Fischer in dieser Form kaum wirklich gedeckt. Auch ist geschichtspolitisch nicht unbedingt zu erwarten, dass eine solche Nivellierung von Verantwortlichkeit, die alle europäischen Mächte gleichermaßen zu Schuldigen erklärt, auch zu einer transnationalen und europäischen Geschichtskultur beiträgt. Der Verdacht liegt vielmehr nahe, dass dadurch nationale Perspektivverengungen revitalisiert werden, denen es nicht um die Gemeinsamkeit eines „europäischen“, sondern vor allem um die Entlastung des „nationalen“ Gedächtnisses geht. Auch wenn die zuletzt genannten Autoren gesinnungsethisch über jeden Verdacht erhaben sind, so verlieren Worte wie die eines der deutschen Geschichtskultur innewohnenden „Schuldstolzes“68, für den die Deutung des Ersten Weltkriegs keinen Anlass biete, zumindest vor dem Hintergrund heutiger neo-nationalistischer Geschichtsklitterungen ihren scheinbar unbekümmerten Charakter. Es ist auch nur schwer einzusehen, was daran identitätsschädigend sein soll, wenn eine Gesellschaft und ihre Erinnerungskultur sich auch über den Zivilisationsbruch des Holocaust hinaus in kritisch reflexiver Absicht der Verantwortung für die Verwerfungen der eigenen Geschichte stellen, und eine solche Verwerfung war der Erste Weltkrieg und auch der deutsche Anteil daran allemal.
Auch Clarks Verdienst, Serbien und den balkanpolitischen Kontext wieder in das Bild des Krieges zurückgeholt zu haben, ist, bei aller grundsätzlichen Zustimmung, nicht ohne Widerspruch geblieben, und dies nicht nur in Serbien selbst. Nicht nur im Ton und in der narrativen Dramaturgie seiner Beschreibung der serbischen Geschichte, angefangen von der voyeuristischen Illustration des Attentats von 1903 bis hin zur Darstellung einer von notorischem Nationalismus und Gewaltbereitschaft durchdrungenen serbischen Gesellschaft, sondern auch hinsichtlich der Gewichtung der serbischen Politik in der Juli-Krise wirft Clarks ← 24 | 25 → umfangreiches und deutungskonzeptionell nicht ohne Grund an den Beginn gestelltes „Serbien-Kapitel“ in der Tat manche Fragen auf. Dabei ist der reflexhaft erhobene Vorwurf eines pathologischen „westlichen“ Balkanismus69 weniger von Gewicht, auch wenn Clarks Darstellung sich des Vorwurfs kaum erwehren kann, aus dem Wissen um die Ereignisse der 1990er Jahre auf die serbische Politik des Jahres 1914 geblickt zu haben. Auch die gelegentlich geradezu hysterisch ausgefallene serbische Reaktion, die das Clarksche Bild als Teil einer „westlichen Stigmatisierung“ Serbiens als „Schurkenstaat“ von 1914 bis 1990 sieht70, kann hier in ihrer tagespolitischen Motivation übergangen werden. Gewichtiger hingegen ist, dass die bisherigen Forschungen zur serbischen Politik im Vorwege und in der Juli-Krise, nicht zuletzt aufgrund einer in vielem desolaten Quellenlage, jene Eindeutigkeit und Linearität kaum hergeben, die Clark dieser Politik unterstellt. Der Einwand einer „überzogenen Interpretation“ (Alan Kramer), die nicht in jedem Falle durch die einschlägige Literatur gedeckt ist, ist daher nicht ohne Grund. Clarks Literatur- und Quellenbasis ist nicht nur, wie ihm vorgeworfen ist, selektiv71. Gelegentlich passt auch die von ihm zum Beleg herangezogene (serbische) Literatur nicht immer zu seiner eigenen Deutung. Anders als dort, wo er den Motiven der anderen Akteure nachspürt und sich dabei quellennah gibt, gleitet seine Darstellung im Zusammenhang mit Serbien immer wieder auch in vage, nicht selten stereotype Formulierungen ab, so, wenn er den Serben „eine Vorliebe für verdeckte Operationen“ unterstellt72. Es sind denn auch nicht wenige der interpretatorischen Schlüsselbehauptungen Clarks, die im wahrsten Sinne des Wortes „frag-würdig“ sind: Die serbische Politik des Jahres 1914 linear aus der „Blaupause“ der Programmschrift des „načertanije“ des Jahres 1844 abzuleiten, die man allenfalls mit „opportunistischen“ Modifikationen konsequent bis zum Ersten Weltkrieg umgesetzt habe73, übersieht die vielen Wandlungen serbischer Politik in diesem halben Jahrhundert und fällt daher zu kurzschlüssig aus. Auch die Kriegsmüdigkeit und fiskalische Auszehrung Serbiens nach den Kriegen von 1912/13, welche nicht nur den Haushalt, sondern auch die Armee und ihre ← 25 | 26 → Ressourcen völlig erschöpft hatten, wird von Clark nicht in Abrede gestellt, relativiert sein Interpretament einer den Krieg im Wissen um vermeintliche russische Unterstützung bereitwillig hinnehmenden serbischen Politik aber nicht. Mit nicht weniger Plausibilität haben Andere denn auch darauf verwiesen, dass „in spite of long-term national aims Serbia´s official policy in 1914 was avoidance of war at all costs“74. Hinsichtlich der Beziehungen zwischen der in das Attentat involvierten Militärvereinigung “Ujedinjenje ili smrt” (Schwarze Hand/Crna Ruka) und der Regierung kommt Clark nicht über vage Formulierungen eines “stillschweigenden Einverständnisses zwischen dem serbischen Staat und den an der Verschwörung beteiligten Netzwerken“ hinaus75. Serbische Historiker, aber nicht nur sie, haben demgegenüber auf die tiefen Konflikte zwischen der in das Attentat involvierten Geheimorganisation “Crna Ruka“ und der serbischen Regierung unter Nikola Pašić verwiesen, die Clark nicht verschweigt, aber vom gemeinsamen Ziel eines irredentistischen Nationalismus überwölbt sieht76. Die Suche nach einem entlastenden „Verstehen“, die Clarks Darstellung Österreich-Ungarns und seiner Politik gegenüber Serbien in der Juli-Krise prägt, vermisst man im Umgang mit der serbischen Politik jedenfalls. Arndt Weinrich hat denn auch nicht zu Unrecht darauf aufmerksam gemacht, dass Clarks „virulente Kritik des serbischen Nationalismus und der serbischen Führung… nicht recht zu seiner Forderung (passt), das ´blame game` sein zu lassen“77. Das komplizierte Geflecht einer in der Tat nicht erst seit 1903 von einem virulenten Nationalismus durchdrungenen serbischen Gesellschaft, gewaltbereiter militärischer Akteure, aber auch „jugendbewegter“ jugoslawischer Nationalisten und einer Regierung, die zwischen dem auch von ihr geteilten Ziel einer Vereinigung aller Serben auf der einen und den zur Realpolitik zwingenden desaströsen finanziellen und militärischen Rahmenbedingungen auf der anderen Seite zu lavieren hatte, scheint jedenfalls doch komplexer zu sein als es das allzu hermetische Bild Clarks suggeriert. ← 26 | 27 →
Südosteuropa in der Weltkriegsforschung
Vom „broadening the geographical view“ (Michael Egger u. a.) der jüngeren Weltkriegsforschung hat auch Südosteuropa profitiert. Zwar sind Arbeiten, die sich ausschließlich und vor allem in regional vergleichender Absicht mit dem Kriegsgeschehen auf dem Balkan befassen, immer noch eine Ausnahme78. Transnational angelegte Analysen des Weltkriegsgeschehens beziehen jedoch immer häufiger auch den südosteuropäischen Kriegsschauplatz mit ein. Zumindest gilt dies für einzelne Themenkomplexe, während andere, welche die internationale Weltkriegsforschung in den letzten zwei Jahrzehnten bestimmt haben, für den Balkan nach wie vor weithin unerforscht sind. Militärhistorische Arbeiten etwa haben, nachdem sie den ursprünglich dominierenden Blick auf die Westfront mit einem gewissen time-lag auch auf die Ostfront ausgedehnt haben, mittlerweile auch den Südosten erreicht, sind dabei allerdings häufig im Rahmen einer eher „konventionellen Militärgeschichte“ geblieben, ohne sich jenen Zugangsweisen und Fragestellungen zu nähern, die aus der Perspektive einer „Militärgeschichte in der Erweiterung“ behandelt worden sind79. Auch für das Problem der Besatzungsherrschaften liegen mittlerweile sowohl länderspezifische wie auch vergleichende Studien zum Balkan vor80. Sie ← 27 | 28 → bereichern nicht nur das Bild hochgradig heterogener Besatzungsformen in den einzelnen europäischen Kriegsregionen, sondern tragen auch zu einer Differenzierung des oftmals noch stark aus einer Viktimisierungsperspektive beschriebenen Bildes in den einzelnen südosteuropäischen Nationalhistoriographien bei. Ganz besonders gilt dies für den serbischen Fall, wo die serbische Geschichtswissenschaft nach wie vor am Bild einer auf Vernichtung des serbischen Staates, rücksichtsloser Ausbeutung und einer durchgängig auf Terror fußenden österreichisch-ungarischen Besatzungsherrschaft festhält81. Auch das verstärkte gewaltgeschichtliche Interesse der Forschung am Ersten Weltkrieg hat mittlerweile Niederschlag in der auf Südosteuropa bezogenen Literatur gefunden. Hier ist es die lange Zeit übergangene radikalisierte Kriegsgewalt der österreichischen Armee im ersten und zweiten Kriegsjahr in Serbien, die von der Forschung in den Blick genommen worden ist82. Sie war schon im und unmittelbar nach dem Kriege, vor allem durch die Untersuchungen und journalistischen Reportagen von Archibald Reis, John Reed oder Henry Barby einer europäischen Öffentlichkeit bekannt gemacht worden, ohne dass dies freilich größere Aufmerksamkeit gefunden hätte. Auch nach Kriegsende blieb historiographisch wie auch juristisch eine ← 28 | 29 → angemessene Aufarbeitung aus83. Während die spätere „westliche“ Historiographie das Thema weithin ausklammerte, kam auch die serbische Geschichtswissenschaft kaum einmal über die Reproduktion der zeitgenössischen Anklageschriften hinaus84. Trotz der genannten jüngeren Ansätze, fehlt es aber, so hat Alan Kramer konstatiert85, nach wie vor an einer systematischen Aufarbeitung dieses Themas, vergleichbar jener von Horne und Kramer für Belgien und Frankreich vorgelegten Untersuchung deutscher Kriegsgräuel86. Dabei scheint auch auf dem südosteuropäischen Kriegsschauplatz die enthegte Kriegsgewalt gegenüber der Zivilbevölkerung von ähnlichen Faktoren begünstigt worden zu sein wie im Westen. War es dort die irrationale Angst vor belgischen und französischen franc-tireurs, welche die deutschen Armeen zu Gewaltexzessen veranlasste, so ist auch mit Blick auf die österreichische Kriegsführung darauf verwiesen worden, dass die österreichische Armee sich mit einem Gegner konfrontiert fühlte, dessen Kriegführung angeblich intentional auf der Verwischung aller Grenzen zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten aufbaue. Nicht zuletzt mitgeprägt durch die Wahrnehmung der Balkan-Kriege 1912/13 und durch ein sich seit 1908 verstärkendes antiserbisches Bild der Presse verfestigt, galten „die Serben“ als ein Kriegsgegner, der sich gleichsam aus einer tief verankerten Gewaltkultur heraus allen Regeln „geordneter“ Kriegsführung verweigere und dem man daher auch nur mit einer auch auf Zivilisten auszudehnenden Repressionsgewalt begegnen könne87. Während für den österreichisch-serbischen Krieg somit wenigstens erste Befunde vorliegen, sieht es für die Frage der Kriegsgewalt in der serbisch-bulgarischen Konfrontation hingegen deutlich schlechter aus. Die bulgarische Historiographie schweigt hierzu weitestgehend, und auch die serbische kommt bis heute über einen auch hier schon auf die Kriegszeit selbst ← 29 | 30 → zurückgehenden Anklagegestus nicht hinaus88. Auch außerhalb der südosteuropäischen Forschung liegen hierzu bestenfalls erste Ansätze vor89.
Anderes, was in der vergleichenden Weltkriegshistoriographie in jüngerer Zeit auch über den westlichen Kriegsschauplatz hinaus Berücksichtigung gefunden hat, ist bislang hingegen noch kaum auf den Südosten ausgedehnt worden. Die Erforschung von Kriegsgefangenen in Südosteuropa etwa bleibt nicht nur weit hinter jener Dichte zurück, mit der man sich dem Thema für die westlichen Länder gewidmet hat, sondern auch hinter der in jüngerer Zeit sich auch für die Ostfront verdichtenden Forschungen90. Nur wenige Arbeiten haben sich in einer eher punktuellen Weise diesem Thema explizit zugewandt91, und vergleichende Betrachtungen sparen die Kriegsgefangenen auf dem Balkan entweder aus oder behandeln sie nur beiläufig92. Überraschen muss auch, dass die Tätigkeit paramilitärischer Akteure, obwohl diese insbesondere für den serbischen Kriegsschauplatz von Bedeutung geworden ist, bislang kaum untersucht wurde und selbst in komparativen Betrachtungsweisen ausgeklammert wurde93.
Auch für eine mentalitäts- und erfahrungsgeschichtliche Betrachtung des Krieges auf dem Balkan liegen bislang nur Bausteine vor. Kriegstod, Verwundungen und medizinische Versorgung sind nur selten zum Gegenstand ← 30 | 31 → gemacht worden94. Das für den westlichen Kriegsschauplatz bearbeitete Feld der mentalen Kriegsmobilisierung und der Beweggründe des „Durchhaltens“ im Angesicht des Schreckens des Krieges, das vor allem in der französischen Forschung zu vielen Kontroversen geführt hat95, wird von der südosteuropäischen Geschichtswissenschaft immer noch vorwiegend aus der Perspektive eines bedingungslosen Aufopferungswillens im Dienste der Nation beantwortet; nur selten wird dabei die auch unter den südosteuropäischen Soldaten anzutreffende Gemengelage der Motive in den Blick genommen, welche die Kämpfenden auch hier, jenseits aller nationalistischen Euphorie, zwischen „consens“ und „coercion“ dazu veranlasste, die Kriegsstrapazen auf sich zu nehmen96. Auch geschlechtergeschichtliche Aspekte des Krieges, die seit der alltagsgeschichtlichen Wende der Weltkriegsforschung zu einem gewichtigen Forschungsfeld geworden sind, kommen für den Balkan bislang nicht über punktuelle Forschungen hinaus und bleiben nach wie vor auch in transnational angelegten Sammelbänden eher unterbelichtet97. Deutlich mehr Resonanz hat hingegen im Zuge des allgemeinen „memory-booms“ die ← 31 | 32 → erinnerungskulturelle Verarbeitung des Krieges gefunden, die mittlerweile für fast alle südosteuropäischen Kriegsteilnehmer aus verschiedenen Perspektiven zum Thema gemacht worden ist 98. In ihrer Summe ergeben diese Studien dabei ähnlich wie in anderen Kriegsregionen auch für den Balkan einen doppelten Befund: zum einen haben auch hier die Gesellschaften trotz vergleichbarer Kriegserfahrungen zu keinem gemeinsamen Erinnern gefunden, sondern „Sieger- und Verlierergedächtnisse“ standen sich in der öffentlichen Repräsentation des Krieges zumeist inkompatibel gegenüber. Zum zweiten waren jenseits eines scheinbar homogenen nationalen Gedächtnisses auch in den Balkan-Gesellschaften die Erinnerungen an den Krieg im Inneren vielfach fragmentiert, nach Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, aber auch individueller Kriegserfahrung99.
Details
- Seiten
- 282
- Jahr
- 2018
- ISBN (PDF)
- 9783631739143
- ISBN (ePUB)
- 9783631739150
- ISBN (MOBI)
- 9783631739167
- ISBN (Paperback)
- 9783631739136
- DOI
- 10.3726/b12661
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (November)
- Schlagworte
- Geschichte des Ersten Weltkriegs Kriegsgeschichte Erinnerungskultur
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2018. , 281 S., 50 s/w Abb.