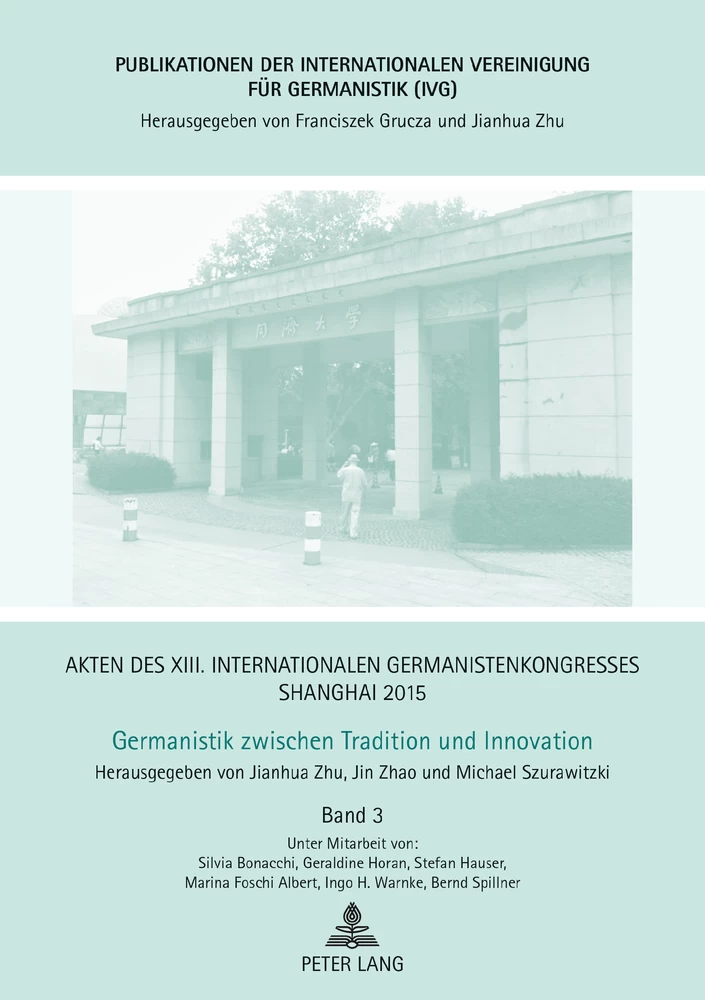Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 – Germanistik zwischen Tradition und Innovation
Band 3
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort der Herausgeber
- Beziehungsgestaltung durch Sprache – betreut und bearbeitet von Silvia Bonacchi, Susanne Günthner, Beata Mikolajczyk, Claudia Wich-Reif, Britt-Marie Schuster und Qiang Zhu
- Illokutionen am Beispiel des Arbeitszeugnisses
- Evaluative Sprache am Beispiel deutsch- und englischsprachiger Blogs zu Richard Wagner
- Partnerorientierung im unhöflichen Miteinander: Adressatenzuschnitt oder Akkommodationsprozesse?
- Sprachliche Beziehungsgestaltung in den deutsch-polnischen Relationen. Eine linguistische Analyse des Briefes der polnischen Bischöfe an die deutschen Bischöfe aus dem Jahre 1965
- Zur kommunikativen Konstruktion sozialer Beziehungen in SMS-Interaktionen: kontrastive Analysen chinesischer und deutscher Anredepraktiken
- Rekonstruieren – involvieren – solidarisieren. Multimodale Praktiken der Beziehungsgestaltung
- Bitte: Allgemeine Charakteristik des Sprachhandlungsmusters
- Tendenzen in den Höflichkeitsinventionen anhand einer exemplarischen Untersuchung von Internetforen und -blogs
- Reflexionen chinesischer Studierender über ihr Anredeverhalten im interkulturellen Milieu: eine kognitive Progression
- Beziehungsgestaltung durch Grüsse. Eine theoretische Skizze
- Wie geht’s (dir)? Zur diachronen Entwicklung pragmatischer Phraseme im kontrastiven Vergleich
- Vom Sie zum Du – und oft auch wieder zurück. Beobachtungen zur Pragmatik des temporären Anredewechsels im älteren Deutsch
- Deutsche Abtönungspartikeln in rhetorischen Fragen und ihre polnischen Äquivalente
- Hetereogenität und Synergie in (chinesisch-deutschen) interkulturellen Teams
- Interkulturelle Analyse der beziehungsgestaltenden Sprechhandlungen in der deutsch-chinesischen Lehrer-Studenten-Kommunikation durch E-Mail
- Diskurs und Politik – betreut und bearbeitet von Geraldine Horan, Thomas Niehr, Felicity Rash, Kersten Sven Roth und Melani Schröter
- Kontrastive Untersuchung zum Metapherngebrauch in der politischen Kommunikation – eine Projektskizze
- Der Konzeptbegriff in der linguistischen Diskursanalyse. Ein Plädoyer
- Wirtschaftskräfte, Soziallasten und der drohende Kollaps. Das Verhältnis von Staat und Wirtschaft – ein diachroner Vergleich von Krisen-Metaphorik
- Argumentation in politischen Texten – Neuere Formen ihrer Erforschung
- Heia Safari! Ein Beispiel der kolonialistischen Propaganda nach dem Ersten Weltkrieg
- Analyse von Metakommunikation und Metadiskurs im öffentlichen Diskurs am Beispiel von Schweigen und Tabu
- Konzeptualisierung und Versprachlichung der Migration im dt. und ital. politischen Diskurs: erste überlegungen
- Welche Mündlichkeit, welche Schriftlichkeit? Sprache unter medialen Bedingungen – betreut und bearbeitet von Stefan Hauser, Erika Linz, Martin Luginbühl und Daniel Perrin
- Diskutieren vor Publikum
- Zur Operativität von Schriftzeichen in digitalen Medien
- Überlegungen zur (didaktischen) Relevanz der Medialität am Beispiel des mündlichen Argumentierens
- Lesen und gelesen werden – Lesepräsenz in schriftlicher Kommunikation
- Zur Medialität kommunikativer Praktiken im Theater
- Beiläufiges Schreiben: Sprachgebrauchswandel im Journalismus
- „On dit bonjour à la caméra.“ Zum Spiel beobachteter Kinder mit der Aufnahmesituation in institutionellen Lernkontexten
- Zwischen Lesen und Schauen: Schriftbildlichkeit am Beispiel der Timeline
- Die Poetizität der Sprache – betreut von Paulo Astor Soethe, Ludwig M. Eichinger und Marina Foschi Albert
- Literarische Texte als Stoff zur Beschreibung der sprachlichen Kreativität. Das Beispiel also
- Überlegungen zur Poetizität in Kurzprosatexten Franz Kafkas
- Dichtung und Wahrheit sind nicht zu vermengen. Überlegungen zur linguistischen Perspektive auf die Poetik
- Stefan Georges Ein Knabe der mir von Herbst und Knabe sang I: die Poetizität der verwendeten Sprache
- Literarizität – eine fremdsprachendidaktische Kategorie?
- Überraschende Wendungen. Oder: Verse sind die Kommata der Dichter
- Die Problematik der Übersetzung von Stilelementen zwischen dem Sprachenpaar Deutsch-Arabisch
- Ambiguität sprachlicher Mittel als poetische Qualität
- Übersetzung in der chinesischen Germanistik
- Revolution durch Sprache. Überlegungen zur Ästhetik expressionistischer Theatertexte
- Gebrauch und Verständnis von fremdsprachlichen Ausdrücken im gegenwärtigen Aserbaidschanischen (am Beispiel von englischen Entlehnungen)
- Sprachform in Robert Müllers Tropen
- Poetische Sprache zur Darstellung von Verräumlichungs- und Verzeitigungsprozessen in Theatertexten
- Diskursbedeutung und Grammatik – Transtextuelle und gesprächsübergreifende Aspekte grammatischer Inventare – betreut und bearbeitet von Ingo H. Warnke, Martin Reisigl und Wei Han
- Diskursbedeutung und Grammatik – Transtextuelle und gesprächsübergreifende Aspekte grammatischer Inventare: Einleitung zur Sektion
- Das Prädikationspotenzial von Schreckbildern – am Beispiel von Bildern in der Islam-Debatte
- Zum kollektivitätskonstitutiven Potenzial von Personalpronomen. Wir-Gruppen-Konstruktionen am Beispiel global wirkmächtiger Identitätszuschreibungen
- Generische Konditionale und Faktizität
- Diskursgrammatik als Grammatik indexikalischer Ordnungen
- Der Artikel unter dem „synthetischen“ Aspekt – T. Sekiguchis Beitrag zur Diskurslinguistik
- Der Imperativ in deutschen, englischen und spanischen Werbespots: Formen, Funktionen, Ersatzformen
- Kontrastive Textologie – betreut und bearbeitet von Bernd Spillner und Chen Qi
- Das Bild des ‚Kaisers der Reportage‘ im deutschen und polnischen Pressediskurs. Versuch einer diskursanalytischen Untersuchung
- Kontrastiver Vergleich der Kohärenz sowie Kohäsion deutscher und chinesischer Texte am Beispiel der Neujahrsansprachen 2015 der Staatsoberhäupter Deutschlands und Chinas
- Emotionales Bewerten in wissenschaftlichen Rezensionen: Ein kontrastiver Vergleich Deutsch-Bulgarisch
- Anklageschriften und Strafbefehle im deutsch-brasilianischen Vergleich
- Kontrastive Textologie: Methoden und Methodenkritik
- Besonderheiten der Bibelübersetzung in der Epoche der „Political Correctness“
- Evidentialitätsmarker in deutschen und englischen wissenschaftlichen Texten der (frühen) Neuzeit
- Eine linguistisch-translatorische Studie zur Liedtextübersetzung Deutsch-Chinesisch aus funktionaler Perspektive
- Reihenübersicht
Der vorliegende Band ist der dritte in der Dokumentation des XIII. Kongresses der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), der vom 23. bis zum 30. August 2015 an der Tongji-Universität Shanghai stattfand. Mit diesem Band wird die Dokumentation der sprachwissenschaftlichen Sektionen abgeschlossen, die in Band 2 begonnen hatte. Es werden hier folgende Sektionen in der genannten Reihenfolge dokumentiert: Der Band beginnt mit der Sektion Beziehungsgestaltung durch Sprache, darauf folgt die Sektion Diskurs und Politik. Daran schließt sich die Sektion Welche Mündlichkeit, welche Schriftlichkeit? Sprache unter medialen Bedingungen an. Es folgt dann die Sektion Die Poetizität der Sprache, nach der die Sektion Diskursbedeutung und Grammatik – Transtextuelle und gesprächsübergreifende Aspekte grammatischer Inventare dokumentiert ist. Die Sektion Kontrastive Textologie beschließt den Band.
Wir danken allen Sektionsleiterinnen und -leitern sowie ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern für die große geleistete Arbeit, sowohl während der Organisation und Durchführung der Sektionen sowie bei der Herausgabe der Sektionsbeiträge. Unser Dank gilt wiederum auch Dr. Agnieszka Bitner-Szurawitzki und Dr. Kerstin-Salewski-Teßmann, die uns redaktionell bei der formalen Überprüfung und Vereinheitlichung der Beiträge sowie dem Korrekturlesen der Manuskripte tatkräftig unterstützt haben.
Shanghai, im April 2016
Jianhua Zhu
Jin Zhao
Michael Szurawitzki ← 11 | 12 → ← 12 | 13 →
Beziehungsgestaltung durch Sprache – betreut und bearbeitet von Silvia Bonacchi, Beata Mikołajczyk, Susanne Günthner, Britt-Marie Schuster, Claudia Wich-Reif und Qiang Zhu
Illokutionen am Beispiel des Arbeitszeugnisses
Anlass zur Bildung und Verwendung von Euphemismen ist – der einschlägigen Literatur zufolge – das Tabu (cf. u. a. Reutner 2009). Als Kategorie außersprachlichen Charakters werden Tabus verschiedener Art des Öfteren jedoch oft vereinfachend zusammengefasst.1 Euphemismen „entstehen“ jedoch in verschiedenen Situationen unter diversen Bedingungen. Die Motivation zum euphemistischen Sprachgebrauch ist unterschiedlich. Beispielsweise hat das Tabu beim interessenabhängigen Sprachgebrauch (Verschleierung) eine andere Dimension als bei den verhüllenden Höflichkeits-Euphemismen oder beim Understatement. Im Folgenden wird kurz die Illokution angesprochen, die dem euphemistischen Gebrauch von Sprache in den deutschen qualifizierten Arbeitszeugnissen zugrunde liegt. Die nachstehende Reflexion stellt einen Ausgangspunkt zu einer breiter angelegten Betrachtung der Textsorte in einer umfangreicheren Untersuchung dar.
1. Konversationelle Implikatur und Präsupposition als Euphemismen
Neben Ersatzlexemen, die als die wichtigsten Realisierungsmittel der Euphemismen gelten (cf. Zöllner 1997: 129, Reutner 2009: 121), sind – und zwar nicht nur im Falle der nachstehend angesprochenen Textsorte – auch andere Ausdrucksweisen zu beachten, die man als euphemistisch betrachten kann. Hierunter sind Äußerungen zu erwähnen, die konversationelle Implikaturen auslösen (cf. Grice 1975), und die Präsupposition (cf. u. a. Levinson 1994: 169–225). Diese beiden zentralen Kategorien der Pragmalinguistik können aufgrund der folgenden Charakteristika voneinander unterschieden werden: Während die konversationelle Implikatur (1) gelöscht werden kann, wenn z. B. die Äußerung einer „Reparatur“2 unterzogen wird (1‘), besteht bei der Präsupposition keine Möglichkeit der Annullierung (2):3 ← 15 | 16 →
| (1) | Allein der Blick auf den Aktienkurs zeigt: Viel macht Microsoft derzeit nicht falsch. (FTD) |
| (1’) | Vieles meistert Microsoft (sehr) gut.* |
| (3) | Die KfW-Ökonomen erwarten in diesem Jahr insgesamt eine „leichte Belebung des Wohnungsbaus.“ (WW) |
2. Ursachen und Funktionen des Euphemismus
In der deutschsprachigen Literatur wird seit Luchtenberg (1985) zwischen zwei euphemistischen Hauptfunktionen unterschieden: der Verhüllung und Verschleierung (cf. Luchtenberg 1985: 152, 157). Dabei handelt es sich nicht um Lexeme, die per se als „verhüllend“ oder „verschleiernd“ zu betrachten sind.4 Vielmehr ist hier die Intention entscheidend, die dem jeweiligen Sprachgebrauch zugrundeliegt und aufgrund einer individuellen Betrachtung als solche interpretiert werden kann. Bei der Bildung und Verwendung von Euphemismen spielen verschiedene Motivationen mit. Dies betrifft auch Fälle, in denen durch indirekte Sprechakte Aggression realisiert werden kann. Um an dieser Stelle die Worte Heinrich Bölls zu zitieren, auch Höflichkeit kann „die sicherste Form der Verachtung“ sein (Böll 1959: 229). Dem Euphemismus kann sogar eine feindliche Intention zugrundeliegen (cf. Bonacchi 2013: 160).
In der traditionellen Literatur wurde auf verschiedene Weisen versucht, diesem Phänomen gerecht zu werden. Zöllner (1997: 402) unterscheidet in Anlehnung an Allan/Burrige (1991: 7) dysphemistische Euphemismen (d. h. dysphemistische Lokutionen mit euphemistischer Illokution) und euphemistische Dysphemismen (euphemistische Oberflächenstruktur und dysphemistische Illokution). In der Unterscheidung, die (zumindest auf den ersten Blick) kompliziert erscheinen mag, steht jeweils das Bezugswort („Euphemismus“ oder „Dysphemismus“) für die Illokution. Diese Auffassung kann nicht vollständig auf die Realisierung von Sprechhandlungen in Arbeitszeugnissen übertragen werden. Das Modell vermag es beispielsweise nicht, die Intention zur Verhüllung und Verschleierung differenziert anzusprechen. Dennoch können unter Zuhilfenahme dieses Modells wichtige Aspekte der Euphemisierung aufgedeckt werden: Unter anderem wird hierbei aufgezeigt, dass die euphemistische Form von Kritik dem Anstand geschuldet ist. Der Sprecher will von der Außenwelt als nichtaggressiver, zurückhaltender Interaktant wahrgenommen werden. ← 16 | 17 →
3. Die Euphemisierung in den Arbeitszeugnissen
Die Erkenntnisse Zöllners (1997) treffen auf die Ergebnisse der Untersuchung der Arbeitszeugnisse zu, zumindest hinsichtlich der Feststellung, dass der euphemistische Sprachgebrauch den Sprachbenutzern zur Absicherung ihrer Teilnahme am Diskurs dient. Anders gesagt, im verhüllenden Sprachgebrauch sehen die Diskursteilnehmer die Möglichkeit, sich nicht angreifbar zu machen (cf. Bonacchi 2013: 218). Wie aus der Reflexion von Zöllner und aus der Analyse hervorgeht, die den vorliegenden Überlegungen zugrundeliegt, agieren die Autoren von verhüllenden Euphemismen bewusst in einem sozial sanktionierten Rahmen. Im Fall der Arbeitszeugnisse ist hinzuzufügen, dass die analysierten Texte in einem juristisch geregelten Rahmen entstehen.5 In den Texten müssen bestimmte kritische Punkte angesprochen werden, die mit der Bewertung von Mitarbeitern verbunden sind.6 Dabei muss gleichzeitig das Gesicht der bewerteten Person gewahrt bleiben. Die Notwendigkeit einer Bewertung von Mitarbeitern, die ohne Verletzung ihrer Würde erfolgt, zwingt den Autor zur Verwendung von konventionalisierten Euphemismen, eines Geheimcodes, wie es von Huesmann (2008: 61–62, 79–84) bezeichnet wird. Letzteres manifestiert sich auf sprachlicher Ebene u. a. in der Präsenz der zuvor angesprochenen Erscheinung der Präsupposition. Hier seien zwei Belege für die kritische Bewertung in Arbeitszeugnissen angeführt:
| (3) | Herr X besuchte eine Fachfortbildung und konnte dadurch aktuelle Kenntnisse erwerben. (= Er verfügte über keine entsprechenden Kenntnisse.) |
| (4) | Bei der Bearbeitung der wesentlichen Aufgaben ging Herr X planvoll und systematisch vor. Er erreichte meist praktikable Lösungen. (= Es gab jedoch auch Ausnahmen.) |
Mit ähnlichen konventionalisierten verhüllenden Euphemismen wird eine Bewertung realisiert, wobei dem Adressaten des Textes der Modus der Kommunikation mitgeteilt wird. Es wird dem Adressaten, der den „Geheimcode“ beherrscht, explizit verbalisiert, dass der Autor professionell vorgeht („negatives Gesicht“) und nicht in die Würde des bewerteten Mitarbeiters eingreifen will („positives Gesicht“) (cf. Goffman 1967, Brown/Levinson 1987). Hierbei bleiben das positive Gesicht des Rezipienten und das negative Gesicht des Sprechers gewahrt. Dies ← 17 | 18 → entspricht weitgehend dem Konzept des positiven und negativen Gesichts (cf. Goffman 1967, Mikołajczyk 2008: 186–197, Bonacchi 2013: 97, 243).7
4. Abschließende Bemerkungen und Ausblick
Der Konvention des verhüllenden Sprachgebrauchs in den deutschen qualifizierten Arbeitszeugnissen liegt ein (hier juristisch festgelegtes) Ideal zugrunde, das auf Goffmans Paradigma zurückgeht (cf. Goffman 1967). Im Falle der Textsorte Arbeitszeugnis muss deutlich zwischen den Kategorien „Adressat“ (z. B. Mitarbeiter) und „Rezipient“ (neuer Arbeitgeber oder Personalchef) unterschieden werden. Die Euphemismen in der besprochenen Textsorte können vom Leser (z. B. dem betroffenen Mitarbeiter) aufgrund seiner Erfahrung des Geheimcodes in den bisher rezipierten Arbeitszeugnissen als verschleiernd interpretiert werden. Die Erfahrung des – aus seiner Perspektive gesehen – instrumentalisierenden Sprachgebrauchs in Textsorten und Diskursen prägt die zukünftige Betrachtung dieses Sprachgebrauchs. Die Erfahrung der mit einer bestimmten Illokution realisierten Äußerung prägt die zukünftigen Erkenntnisakte. Aufgrund der bisherigen Erfahrung kann somit auch die euphemistische Sprache, der Geheimcode der Arbeitszeugnisse, nicht als kooperativ-verhüllend, sondern als raffinierter juristischer Trick und als Verschleierung empfunden werden (cf. aber Huesmann 2008). Diese Erfahrung prägt die Erwartungen eines deutschen Lesers, der in Zukunft ähnlichen Dokumenten (auch in anderen Sprachen) mit einer ähnlichen Erwartung begegnen wird.
Diese Probleme wurden in einer kontrastiven Analyse untersucht, der das deutsche qualifizierte Arbeitszeugnis und das ihm funktional-pragmatisch äquivalente polnische Gutachten („opinia“) unterzogen werden.8 Diese Aspekte werden in weiteren kontrastiv angelegten Studien in einem größeren Zusammenhang diskutiert, in denen auf den Frame-Ansatz von Fillmore (1982) und die epistemischen Semantik von Busse (2012) zurückgegriffen werden sollte. ← 18 | 19 →
Bibliographie
Adamzik, Kirsten: „Grundfragen einer kontrastiven Textologie“. In: Adamzik, Kirsten (Hrsg.): Kontrastive Textologie. Untersuchungen zur deutschen und französischen Sprach- und Literaturwissenschaft. Stauffenburg: Tübingen 2001, S. 13–48.
Allan, Keith / Burridge, Kate: Euphemism & Dysphemism. Language Used as Shield and Weapon. OUP: New York et al. 1991.
Bąk, Paweł: Euphemismen des Wirtschaftsdeutschen aus Sicht der anthropozentrischen Linguistik. Peter Lang: Frankfurt a. M. et al. 2012.
Bilut-Homplewicz, Zofia: „Was kontrastieren wir heute in der Linguistik?“ In: Olpińska-Szkiełko, Magdalena et al. (Hrsg.): Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza. Peter Lang: Frankfurt a. M. et al. 2012, S. 101–110.
Bonacchi, Silvia: (Un)Höflichkeit. Eine kulturologische Analyse Deutsch-Italienisch-Polnisch. Peter Lang: Frankfurt a. M. et al. 2013.
Böll, Heinrich: Billard um halbzehn. Kiepenheuer & Witsch: Köln und Berlin 1959.
Brown, Penelope / Levinson, Stephen C.: Politeness: some universals in language usage. Cambridge University Press: Cambridge et al. 1987.
Busse, Dietrich: Frame-Semantik. Ein Kompendium. De Gruyter: Berlin et al. 2012.
Czachur, Waldemar: „Was kontrastieren wir in der kontrastiven Diskurslinguistik?“. Studia Niemcoznawcze 44, 2010, S. 433–443.
Fillmore, Charles J.: „Frame semantics.” In: The Linguistic Society of Korea (Hrsg.): Linguistics in the Morning Calm. Hanshin: Seoul 1982, S. 111–37.
Goffman, Erving: Interaction Rituals. Pantheon Books: New York 1967.
Grice, Herbert Paul: „Logic and Conversation”. In: Cole, Peter / Morgan, Jerry (Hrsg.): Syntax and Semantics. 3: Speech Acts. Academic Press: New York 1975, S. 41–58.
Huesmann, Monika: Arbeitszeugnisse aus personalpolitischer Perspektive. Gestaltung, Einsatz und Wahrnehmungen. Gabler: Wiesbaden 2008.
Levinson, Stephen C.: Pragmatik. Niemeyer: Tübingen 1994.
Luchtenberg, Sigrid: Euphemismen im heutigen Deutsch. Mit einem Beitrag zu Deutsch als Fremdsprache. Peter Lang: Frankfurt a. M. et al. 1985.
Mikołajczyk, Beata: „Wyrażenia znieważające jako leksykalne środki realizacji aktów zagrażających twarzy na przykładzie języka niemieckiego i polskiego”. In: Kątny, Andrzej (Hrsg.): Kontakty językowe i kulturowe w Europie. WUG: Gdańsk 2008, S. 186–197. ← 19 | 20 →
Reutner, Ursula: Sprache und Tabu: Interpretationen zu französischen und italienischen Euphemismen. Niemeyer: Tübingen 2009.
Zöllner, Nicole: Der Euphemismus im alltäglichen und politischen Sprachgebrauch des Englischen. Peter Lang: Frankfurt a. M. et al. 1997.
Quellen:
Financial Times Deutschland online 16.2.2010 (FTD)
Wirtschaftswoche 14/2010 (WW) ← 20 | 21 →
1 Cf. dazu Bąk (2012: 31–32).
2 Zum Reparativ als Mittel der Entschärfung von kritischen Sprechakten cf. Bonacchi 2013: 134–136.
3 Zu weiteren Merkmalen, die eine Unterscheidung der beiden Erscheinungen ermöglichen, gehören die beiden folgenden Charakteristika: Die Implikatur bleibt unter Negation, bei modifizierter Modalität und in Fragesätzen erhalten (cf. Levinson 1994: 118–119). Bei der Präsupposition besteht dagegen keine Möglichkeit, das Präsupponierte – in (2) sind es: Stagnation, Rezession oder Stillstand – zu explizieren, weil sonst eine mehr oder weniger redundante Äußerung entstünde.
Details
- Seiten
- 375
- Jahr
- 2016
- ISBN (ePUB)
- 9783631695593
- ISBN (PDF)
- 9783653062175
- ISBN (MOBI)
- 9783631695609
- ISBN (Hardcover)
- 9783631668658
- DOI
- 10.3726/978-3-653-06217-5
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (März)
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. 375 S., 25 s/w Abb., 9 s/w Tab.