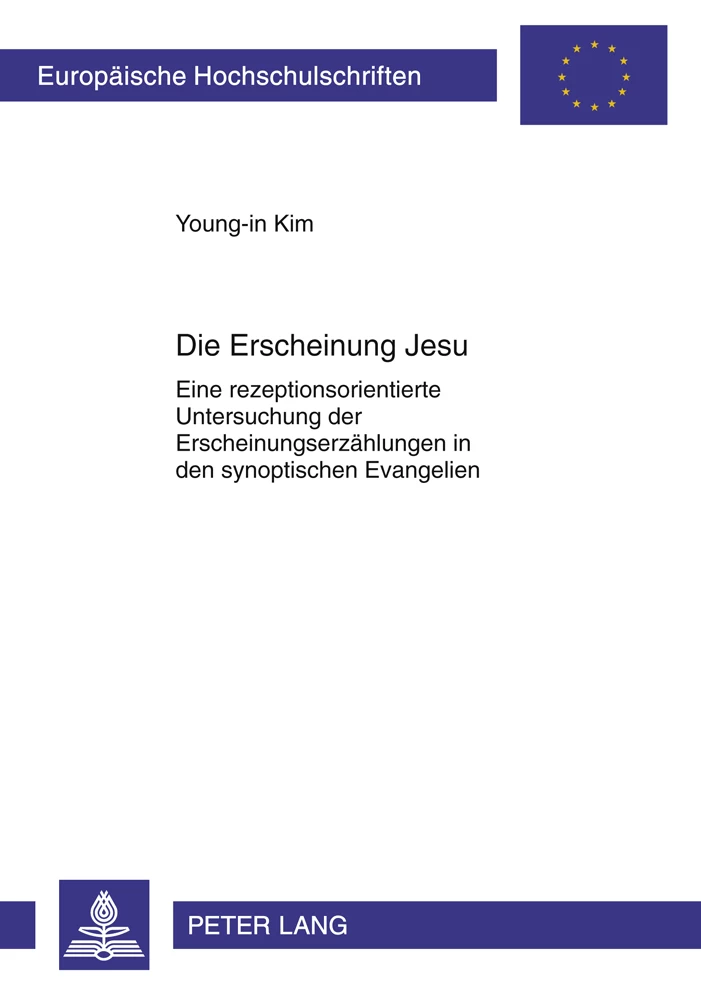Die Erscheinung Jesu
Eine rezeptionsorientierte Untersuchung der Erscheinungserzählungen in den synoptischen Evangelien
©2011
Dissertation
XIV,
233 Seiten
Zusammenfassung
Untersuchungen zu den Erzählungen von der Erscheinung des Auferstandenen in den synoptischen Evangelien sind in der exegetischen Forschung vielfach vertreten. Gleichwohl ist es dem Autor gelungen, mit einer neuen Fragestellung und unter einer neuen Perspektive neue Einsichten für die Exegese und die Theologie in den wissenschaftlichen Diskurs einzubringen. Die Arbeit nimmt die erzähltheoretischen Aspekte auf und verbindet sie mit den traditionellen exegetischen Methoden. Die exegetische und die literaturwissenschaftliche Literatur wird in großer Breite behandelt und kritisch diskutiert, wobei sowohl ältere wie auch neueste Publikationen Berücksichtigung finden. Der methodische Ansatz der Rezeptionsorientierung trägt ganz wesentlich zum besseren Verstehen der Texte bei.
Details
- Seiten
- XIV, 233
- Jahr
- 2011
- ISBN (PDF)
- 9783653046588
- ISBN (Paperback)
- 9783631618035
- DOI
- 10.3726/978-3-653-04658-8
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Schlagworte
- Neutestamentliche Exegese Auferstehung Jesu Juden Griechisch
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2011. XIV, 233 S., zahlr. Graf.