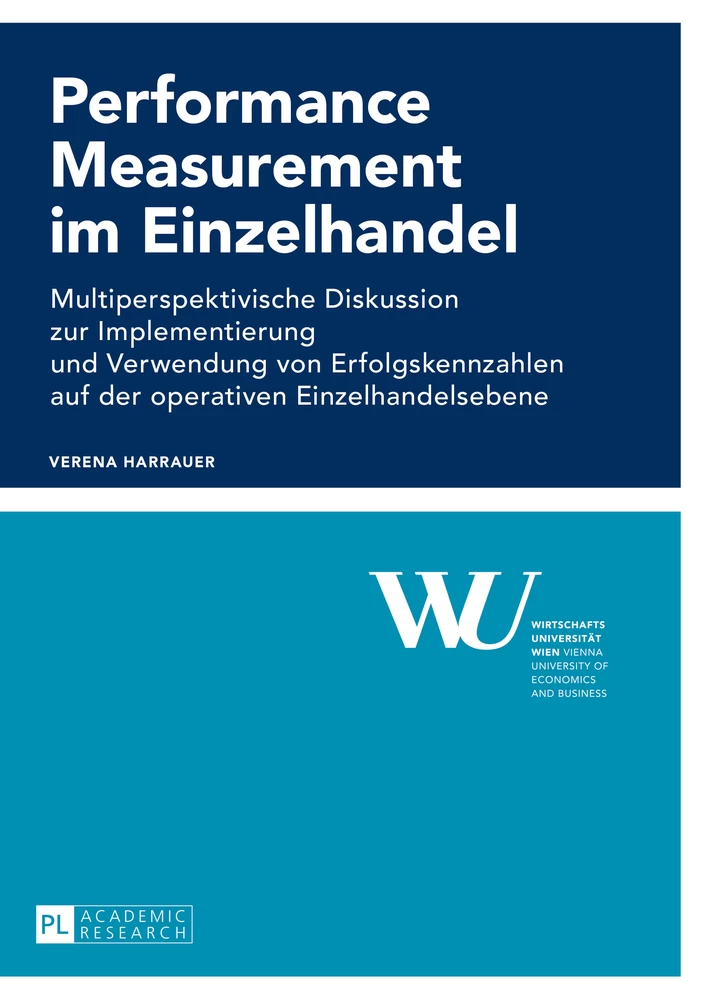Performance Measurement im Einzelhandel
Multiperspektivische Diskussion zur Implementierung und Verwendung von Erfolgskennzahlen auf der operativen Einzelhandelsebene
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Herleitung der Forschungsfragen und Zielsetzung
- 1.2 Diskussion von Relevance und Rigour
- 1.2.1 Relevance der vorliegenden Problemstellung
- 1.2.2 Rigour der vorliegenden Problemstellung
- 1.3 Wissenschaftstheoretische Verortung
- 1.3.1 Entdeckung, Begründung, Verwendung
- 1.3.2 Methodische Einordnung des Projekts
- 1.4 Gang der Untersuchung
- 2 Performance Measurement – Theoretische Verortung der Begrifflichkeit
- 2.1 Aufbau und Einsatz von Kennzahlen
- 2.2 Performance-Dimensionen im Handelskontext
- 2.3 Effizienz- und Effektivitätsorientierung im Handel
- 2.4 Kommunikation auf unterschiedlichen Leistungsebenen
- 2.5 Entwicklung von „Controlling“ zu „Performance Measurement“
- 2.6 Kritische Reflexion und zusammenfassende Darstellung
- 3 Zielorientierung im Handelsmanagement-Prozess
- 3.1 Theoretische Verortung von Zielsetzungen
- 3.2 Rolle von Performance Kennzahlen im Informationsprozess
- 3.3 Rolle von Performance Kennzahlen in der Verwendung
- 3.3.1 Die Rolle der Entscheidungserleichterung
- 3.3.2 Die Rolle der Entscheidungsbeeinflussung
- 3.4 Kritische Reflexion und zusammenfassende Darstellung
- 4 Charakteristika und Struktur der Handelsbranche in Österreich und den USA
- 4.1 Die Funktionen des Handels
- 4.2 Strukturdaten der Handelslandschaft in Österreich
- 4.3 Strukturdaten der Handelslandschaft in den USA
- 4.4 Zusammenspiel von Marketing Mix und PM im Handelsalltag
- 4.4.1 Effizienz und Effektivität in der Sortimentspolitik
- 4.4.2 Effizienz und Effektivität beim Verkaufspersonaleinsatz
- 4.4.3 Effizienz und Effektivität bei standortsspezifischen Entscheidungen
- 4.4.4 Effizienz und Effektivität in der Kommunikationspolitik
- 4.4.5 Effizienz und Effektivität bei Preisen und Konditionen
- 4.5 Kennzahlen-Sets in der Handels- und Marketingforschung
- 4.5.1 Ausgewählte Kategorisierungen von Kennzahlen-Sets im Marketingkontext
- 4.5.2 Generische Kategorisierung von Kennzahlen-Sets
- 4.6 Kritische Reflexion und zusammenfassende Darstellung
- 5 Die Entwicklung von PM in der Handels- und Marketingforschung
- 5.1 Forschungsfragen und Zielsetzung der Literaturanalyse
- 5.2 Auswahlkriterien und Forschungsprotokoll
- 5.3 Kodierung der Studien
- 5.4 Ergebnisse der Literaturanalyse
- 5.4.1 Entwicklung der Publikationstätigkeit
- 5.4.2 Themenschwerpunkte in der kennzahlenorientierten Handels- und Marketingforschung
- 5.4.3 Kategorisierung von Handelskennzahlen
- 5.5 Zusammenfassung und Beantwortung der Forschungsfragen (Literaturüberblick)
- 5.6 Limitationen des Literaturüberblicks
- 6 Qualitatives Design: Problemzentrierte Interviews
- 6.1 Problemzentrierte Interviews: Methodische Annäherung
- 6.1.1 Problemzentrierte Interviewführung
- 6.1.2 Theoretisches Sampling
- 6.1.3 Instrumente und Ablauf der problemzentrierten Interviews
- 6.1.4 Zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring
- 6.2 Theoretische Verortung und Erkenntnisse der qualitativen Erhebung
- 6.3 Ein Blick von außen – Kontingenztheoretische Perspektive
- 6.3.1 Umwelt
- 6.3.2 Unternehmensgröße
- 6.3.3 Unternehmensstrategie
- 6.3.4 Unternehmensstruktur
- 6.3.5 Informationstechnologie
- 6.4 Ein Blick von innen – Praxistheoretische Perspektive
- 6.4.1 Arbeitsaufgaben von Store Manager/innen
- 6.4.1.1 Instore-logistische Aufgaben auf der Store-Ebene
- 6.4.1.2 Managementaufgabe: Organisation von Aktivitäten
- 6.4.1.3 Managementaufgabe: Analyse von Performance
- 6.4.1.4 Managementaufgabe: Steuerung, Kontrolle und Planung
- 6.4.1.5 Managementaufgabe: Treffen von Entscheidungen
- 6.4.2 Ziele auf der Store-Ebene
- 6.4.3 Performance Kennzahlen auf der Store-Ebene
- 6.4.3.1 Kategorisierung von Kennzahlen auf der Store-Ebene
- 6.4.3.2 Aktualität von Kennzahlen auf der Store-Ebene
- 6.4.3.3 Relevanz von Kennzahlen im Store Alltag
- 6.4.4 Evaluierung auf der Store-Ebene
- 6.5 Zusammenfassung und Beantwortung der Forschungsfragen (PZI)
- 6.6 Limitation des qualitativen Designs
- 7 Empirisch quantitative Forschung
- 7.1 Managementbefragung
- 7.1.1 Managementbefragung: Hypothesen und methodischer Steckbrief
- 7.1.2 Managementbefragung: Stichprobenbeschreibung
- 7.1.3 Managementbefragung: Darstellung der Ergebnisse und Hypothesenprüfung
- 7.1.4 Zusammenfassende Darstellung und kritische Reflexion
- 7.2 Conjoint Analyse
- 7.2.1 Conjoint Befragung: Konzeption und Ablauf
- 7.2.1.1 Auswahl der Eigenschaften und deren Ausprägungen
- 7.2.1.2 Präferenzmodell
- 7.2.1.3 Untersuchungsansatz und Erhebungsdesign
- 7.2.1.4 Konstruktion der Stimuli
- 7.2.1.5 Bewertung der Stimuli
- 7.2.2 Conjoint Befragung: Hypothesen und methodischer Steckbrief
- 7.2.3 Conjoint Befragung: Darstellung der Ergebnisse und Hypothesenprüfung
- 7.2.4 Zusammenfassende Darstellung und kritische Reflexion
- 8 Zusammenfassende Darstellung und kritische Reflexion des Gesamtprojekts
- 8.1 Zusammenfassende Darstellung und Implikationen für die Wissenschaft
- 8.2 Zusammenfassende Darstellung und Implikationen für die Praxis
- Anhang A
- Anhang B
- Anhang C
- Anhang D
- Anhang E
- Bibliografie
- Stichwortverzeichnis
- Reihenübersicht
Abbildung 1: Verknüpfung Marketing Mix und Permance Measurement (Müller-Hagedorn/Natter 2011, 25)
Abbildung 2: Rigour und Relevance des vorliegenden Projekts
Abbildung 3: Theoriebildung und –prüfung (Anm: Beob.=Beobachtung) (De Vaus 2002, 10)
Abbildung 6: Typen kombinierter Forschungsmodelle (Srnka 2007, 254 nach Srnka 2006, 12)
Abbildung 7: Dominante betriebswirtschaftliche Forschungsmethoden (Homburg 2007, 29)
Abbildung 8: Aufbau der Arbeit
Abbildung 10: Bezugsobjekte des Handelscontrollings (Schröder 2006, 1054)
Abbildung 11: PM-Modell (Horvath/Seiter 2009, 396) und Umsetzung im Projekt
Abbildung 12: Informationsverarbeitung im organisationalen Kontext (Sinkula et al. 1997, 307)
Abbildung 13: Rolle von Performance Measurement
Abbildung 14: Herausforderung an die Informationsbereitstellung (Bouwens/Abernethy 2000, 225)
Abbildung 17: Filialisierungsgrad und Filialflächenanteil stationärer Einzelhandelsgeschäfte in %, nach ausgewählten Branchen, I. Quartal 2011 (K.M.U. Forschung Austria 2011, 23) ← 9 | 10 →
Abbildung 20: Verkaufsflächenproduktivität (Brutto-Umsätze/m²) (K.M.U. Forschung Austria 2011, 54)
Abbildung 21: Kennzahlen Sets im Marketing (Farris et al. 2011, 5)
Abbildung 25: Literaturüberblick: Herkunft der Autorenschaft (absolut) (n=270)
Abbildung 26: Literaturüberblick: Angewendete Forschungsdesigns (absolut) (n=270)
Abbildung 27: Literaturüberblick: Leistungsebene (absolut) (n=270)
Abbildung 28: Themenschwerpunkte in den Jahren 1965–1994
Abbildung 29: Themenschwerpunkte in den Jahren 1995–2004
Abbildung 30: Themenschwerpunkte in den Jahren 2005–2013
Abbildung 32: Literaturüberblick: Performance Kennzahlen im Handel – Detailentwicklung (n=270)
Abbildung 33: Entwicklung der Themenschwerpunkte im gesamten Analysezeitraum
Abbildung 34: PZI: Einordnung in den Forschungsprozess
Abbildung 35: PZI: Epistemologische Verortung (Witzel/Reiter 2012, 18)
Abbildung 38: PZI: Kategorienschema – Kontingenztheoretische Diskussion ← 10 | 11 →
Abbildung 39: PZI: Kund/innenorientierung als strategische Ausrichtung – Zusammenfassung
Abbildung 40: Praxistheoretischer Weg der Analyse
Abbildung 41: Beschreibung der Instore Logistikprozesse (Kotzab et al. 2007, 1138)
Abbildung 42: PZI: Instore-Logistik reflektiert durch PM (in Anlehnung an Kotzab et al. 2007, 1138)
Abbildung 43: PZI: Führungsaufgaben von Store Manager/innen
Abbildung 44: PZI: Zusammenfassung – Zielerreichung auf der Store-Ebene
Abbildung 48: Stufen im Forschungsprozess – Quantitatives Design
Abbildung 50: Managementbefragung: Basismodell
Abbildung 51: Managementbefragung: Ranking der operativ verwendeten Handelskennzahlen (n=134)
Abbildung 54: Managementbefragung: Kennzahlen-Sets (Verteilung lt. Definition)
Abbildung 56: Paradigma – Entscheidungswahl (in Anlehnung an Rao 2014, 2)
Abbildung 57: Conjoint Befragung: Basismodell
Abbildung 58: Idealtypischer Ablauf der Conjoint Analyse (Weiber/Mühlhaus 2009, 44) ← 11 | 12 →
Abbildung 60: Konzeptionelles Modell – Conjoint Analyse
Abbildung 61: Conjoint Befragung: Arbeitsstunden pro Woche (n=215)
Abbildung 62: Conjoint Befragung: Subjektiv empfundene Aufgabenkomplexität (n=217)
Abbildung 63: Conjoint-Befragung: Nutzenausprägungen der Kennzahlen-Sets (n=217)
Abbildung 64: Conjoint Befragung: Aktualität der Bereitstellung (n=217)
Abbildung 65: Conjoint Befragung: Umfang der Bereitstellung (n=217)
Abbildung 66: Conjoint Befragung: Nützlichkeit der Kennzahlensets (gesamt) (n=217)
Abbildung 67: Ziele der Wissenschaft (in Anlehnung an Töpfer 2007, 3) ← 12 | 13 →
Tabelle 1: Hauptforschungsfrage
Tabelle 2: Unterforschungsfragen
Tabelle 3: Gegenüberstellung: Realismus vs. Relativismus (Kuß 2013a, 129)
Tabelle 5: Morphologischer Kasten über Kennzahlen-Kategorien (Meyer 2007, 23)
Tabelle 6: Performance Kennzahlen (Clark 1999, 713)
Tabelle 13: U.S. Umsätze (€) und Anzahl an U.S. Filialen im LEH (National Retail Federation 2014)
Details
- Seiten
- 405
- Jahr
- 2016
- ISBN (PDF)
- 9783653068962
- ISBN (ePUB)
- 9783653961744
- ISBN (MOBI)
- 9783653961737
- ISBN (Paperback)
- 9783631672839
- DOI
- 10.3726/978-3-653-06896-2
- Open Access
- CC-BY
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (April)
- Schlagworte
- Performancekennzahlen Dezentralisierung Kundenorientierung Controlling
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. 405 S., 67 s/w Abb., 93 Tab.