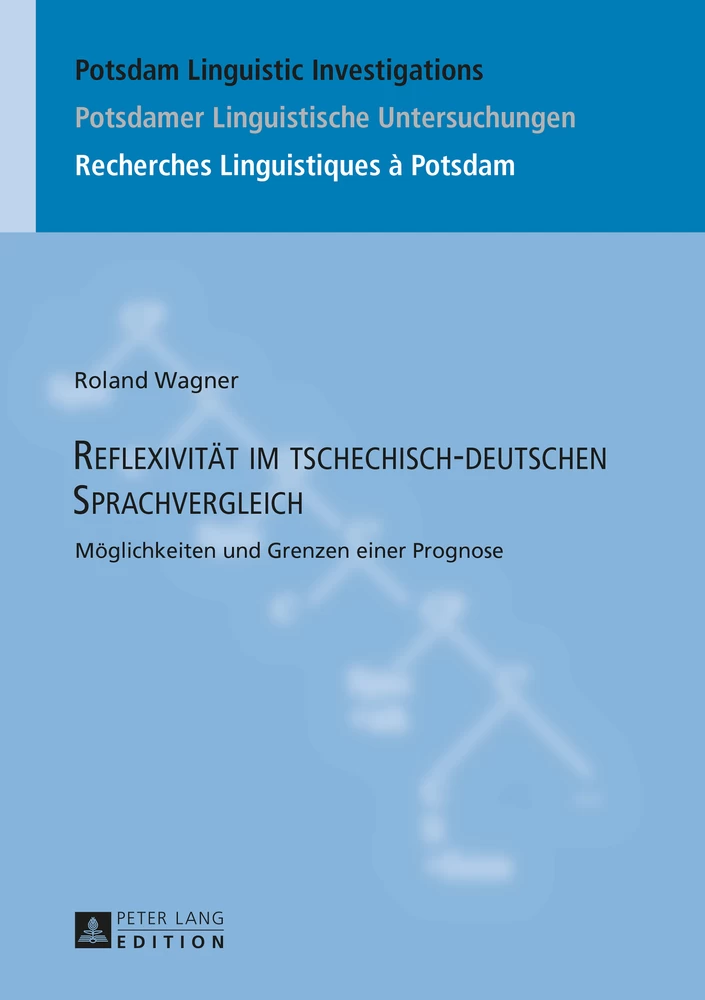Reflexivität im tschechisch-deutschen Sprachvergleich
Möglichkeiten und Grenzen einer Prognose
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen
- 1. Einstieg in die Problematik: Reflexivität und deren Prognose
- 2. Reflexivität aus Sicht der Valenztheorie
- 2.1. Grundannahmen der Valenztheorie
- 2.2. Tesnière und Reflexivität als Diathese
- 2.2.1. Reflexive Diathese
- 2.2.2. Rezessive Diathese
- 2.2.3. Grammatiktheoretische Einordnung der Analyse von Tesnière
- 2.3. Reflexivität in der Prager Dependenzsyntax (FGP)
- 2.3.1. Klassifizierung der reflexiven Konstruktionen im Tschechischen
- 2.3.2. Ist das tschechische Reflexivum ein syntaktisches Objekt?
- 2.3.3. Aktantenrahmen und Relationen zwischen reflexiven und nichtreflexiven Einträgen
- 2.3.4. Differenzierung innerhalb des lexikalischen Reflexivitätstyps
- 2.4. Der Beitrag der Zwei-Ebenen-Valenztheorie und daran anschließender Konzeptionen
- 2.4.1. Semantische Verbklassen
- 2.4.2. Semantische Rollen und syntaktische Valenzpositionen
- 2.4.3. Semantisch reflexive Verben
- 2.4.4. Exkurs zum dativischen Reflexivum
- 2.4.5. Reflexiva ohne Anbindung an Argumentpositionen
- 2.4.6. Semantische Beziehungen im Wortschatz und Dekausativa
- 2.5. Valenzbasierte Klassifizierung von reflexiven Strukturen im Deutschen: die „Standardtheorie“
- 2.5.1. Die Typen der Reflexivität nach Helbig und Buscha
- 2.5.2. Operationale Tests zur Abgrenzung der Typen
- 2.5.3. Grundlage und Interpretation der operationalen Tests
- 2.5.4. Referentieller Status des nicht kommutierenden Reflexivums
- 2.5.5. Syntaktischer Status des Reflexivums: Bestandteil des Lexems?
- 2.5.6. Erfassung von Valenzalternation
- 2.5.7. Die reflexive Wortform im Deutschen
- 2.6. Eine alternative Konzeption: Mediale Reflexivität im Deutschen
- 2.6.1. Zur Begründung der Kategorie „Medium“
- 2.6.2. Neuklassifizierung nach Vilmos Ágel
- 2.6.3. Einordnung in die Valenztheorie
- 2.6.4. Kritik an der Verwendung der Kategorie „Medium“ für das Deutsche
- 3. Die generative Perspektive
- 3.1. Analysen im Rahmen der Rektions- und Bindungstheorie
- 3.1.1. Die klassische Bindungstheorie: Reflexiva als Anaphern
- 3.1.2. Reflexive Klitika in den romanischen Sprachen
- 3.1.3. Die Reflexiva in zwei germanischen Sprachen
- 3.2. Minimalistisches Programm: Anaphern als Kopien
- 3.2.1. Koreferenz durch Bewegung und Rollenakkumulation
- 3.2.2. Das Reflexivum als unterspezifiziertes Nominal
- 3.3. Konstruktion der Valenzstruktur in der Syntax und funktionale Köpfe
- 3.4. Ertrag der vorgestellten Analysen für sprachübergreifende Prognosen
- 4. Theoretischer Rahmen der Untersuchung und mögliche Prognosen
- 4.1. Semantische und syntaktische Valenz
- 4.2. Valenzpotential und Valenzrealisierung
- 4.3. Aufbau des Aktantenrahmens
- 4.4. Reflexivum und die Besetzung von Leerstellen
- 4.5. Reflexiva ohne Leerstellenbesetzung: Lexikalische Operationen am Aktantenrahmen
- 4.6. Möglichkeiten der valenztheoretischen Modellierung von lexikalischer Reflexivität
- 4.7. Strukturelle Valenzrealisierung und Reflexivität
- 5. Syntaktische Reflexivität und Grenzfälle
- 5.1. Erfolgsquote der Prognose
- 5.2. Problemlose Reflexivierung (und die Ausreißer)
- 5.3. Veränderungen am Aktantenrahmen
- 5.4. Fehlende Äquivalenz beim nicht-reflexiven Verb
- 5.4.1. Lexikalische Lücken
- 5.4.2. Fehlende Aktanten
- 5.4.3. Abweichungen bei den Selektionsbeschränkungen
- 5.5. Lexikalisch-semantische und pragmatische Faktoren als Reflexivierungsbremsen
- 5.5.1. Logische Inkompatibilität von Partizipantenrollen
- 5.5.2. Asymmetrien in der hierarchischen Stellung von Partizipanten
- 5.5.3. Reflexivierungshemmende Bedeutungskomponenten
- 5.6. Exkurs zu den Bewegungsverben
- 5.7. Neubewertung der quantitativen Auswertung
- 6. Dekausative Reflexivierung
- 6.1. Äquivalenz beim Kausativum: Abweichungen zwischen Benennungsstruktur und semantischer Repräsentation (Bedeutungsstruktur)
- 6.1.1. Bedeutungsstrukturierung beim Kausativum und Benennungsstruktur
- 6.1.2. Drei Fallbeispiele: rozvázat, zabít, opít
- 6.2. Blockierung von Dekausativa durch primäre Valenzträger
- 6.2.1. Zum Begriff „Blockierung“ und den linguistischen Voraussetzungen
- 6.2.2. Blockierung durch Stammvarianten
- 6.2.3. Blockierung durch labile Verben
- 6.3. Dekausativierung und Belebtheit
- 6.3.1. Situationskontrolleure in der höchsten Position des Aktantenrahmens
- 6.3.2. Situationskontrolle im Tschechischen
- 6.3.3. Psychologische Wirkungsverben
- 7. Lässt sich Reflexivität prognostizieren? Eine vorläufige Bilanz
- English Summary
- Literaturverzeichnis
- Anhang 1: Ergebnisse der Informantenbefragung zu den Momentanverben
- Anhang 2: Tschechische Dekausativierung mit belebtem A-2
- Reihenübersicht
Der hier vorgelegte Text beruht auf meiner im April 2012 an der Masaryk-Universität als Dissertation angenommenen Arbeit zu den reflexiven Verben im Tschechischen und Deutschen (Wagner 2011b), stellt aber eine gründlich umgearbeitete, stark gekürzte und an anderen Stellen ergänzte Version des ursprünglichen tschechischen Textes dar. Völlig neu geschrieben ist Kapitel 4 zur Modifizierten Valenztheorie, die den theoretischen Rahmen der Arbeit bildet. Im Wesentlichen unverändert geblieben sind dagegen die Ergebnisse, die ich hier der interessierten Öffentlichkeit vorstelle.
In erster Linie möchte ich mich an dieser Stelle bei Petr Karlík bedanken, der das Dissertationsprojekt betreut und während des langen Entstehungsprozesses mit großem Interesse begleitet hat. Ohne seine fachliche und moralische Unterstützung wäre die Arbeit sicher nicht zustande gekommen. Daneben bin ich den vielen tschechischen Kolleginnen und Kollegen zu Dank verpflichtet, die sich bereitwillig als Informanten für die Beurteilung und Konstruktion von Beispielsätzen zur Verfügung gestellt haben. Věra Janíková danke ich für die Gewährung eines Forschungsfreisemesters im WS 2007/08, das ich an der Universität Nizza (Université de Nice – Sophia Antipolis) verbracht habe. Hier ist die Konzeption der Arbeit und der Großteil des Kapitels zur Situationskontrolle entstanden. Jarmila Panevová von der Karlsuniversität in Prag und Michèle Olivieri von der Universität Nizza bin ich für die Möglichkeit dankbar, mit ihnen theoretische Probleme linguistischer Modelle und Fragen der Reflexivierung zu konsultieren.
In der letzten Entstehungsphase des Textes haben mich Barbara Westermayer, Mojmír Muzikant und Jan Budňák durch sprachliche Korrekturen unterstützt. Danken möchte ich außerdem Peter Kosta von der Universität Potsdam für die freundliche Rezension und die Aufnahme des Textes in die Reihe Potsdam Linguistic Investigations / Potsdamer Linguistische Untersuchungen / Recherches Linguistiques à Potsdam. Der Druck wurde durch einen Druckkostenzuschuss ermöglicht, den mir die Pädagogische Fakultät der Masaryk-Universität in Brno gewährt hat.
Gewidmet ist die Arbeit Lucy, für ihre langjährige Freundschaft und die wundervolle Musik, die sie schreibt. ← 11 | 12 → ← 12 | 13 →
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen
Abkürzungsverzeichnis
Verwendete thematische Rollen und Aktanten
| A | Aktant (A-1, A-2, A-3) |
| Agens | |
| Benefizient ← 14 | 15 → | |
| DIR | Direktivergänzung |
| Experiencer | |
| Kausator | |
| Patiens | |
| Stimulus | |
| Thema | |
| Vorgangsträger |
Aktanten in der Prager Dependenzgrammatik
| ACT | Actor |
| PAT | Patient |
| ADDR | Addressee |
| EFF | Effect |
| ORIG | Origin |
Morphosyntaktische, semantische und sortale Merkmale
1. Einstieg in die Problematik: Reflexivität und deren Prognose
In der sprachlichen Produktion von DaF-Lernerinnen und Lernern1 mit Tschechisch als Erstsprache finden sich häufig sprachliche Strukturen wie die folgenden:2
(1) Wenn ich höhere Miete bezahlen müsste, wäre es ein Grund, mich wegzuziehen. [Herbstsemester 2004]
(2) Dieses Heft führen sich die Studenten seit der ersten Seminarstunde. [Frühjahrssemester 2005]
(3) […] die zweite Gruppe sind die Anglizismen, die sich sehr selten erscheinen. [Herbstsemester 2008]
(4) Davon fingen die Küchenschränke Feuer und sie stürzten sich ein. [Frühjahrssemester 2009]
(5) Leider kann ich mich an diesen Vorstellungen nicht teilnehmen. [Herbstsemester 2010]
Offenbar ist es in den Beispielen zu Interferenzen mit der tschechischen Ausgangssprache der Lerner gekommen. Die tsch. Übersetzungsäquivalente von (1)–(5) sind nämlich reflexiv (odstěhovat se, vést si, objevit se, zhroutit se, zúčastnit se), und es liegt daher der Verdacht nahe, dass die Sprecher bzw. Schreiber der Beispiele die Reflexivität der Strukturen in ihrer Ausgangssprache auch in der Zielsprache reproduziert haben.
Die Beispiele illustrieren die bekannte Tatsache, dass sich die Reflexivität in zwei verschiedenen Sprachen nicht unbedingt zu decken braucht. Tschechische Lehrbücher für Deutsch als Fremdsprache (z. B. Dusilová/Kolocová et al. 2001, 72 f.) fassen diese Einsicht gewöhnlich in der Aussage zusammen, dass es sowohl im Tschechischen als auch im Deutschen „reflexive Verben“ („zvratná slovesa“) gibt, wobei nicht garantiert ist, dass sich Übersetzungsäquivalente hinsichtlich ← 17 | 18 → der Reflexivität gleich verhalten: Ein reflexives Verb im Tschechischen kann ein nicht-reflexives Äquivalent im Deutschen haben und umgekehrt. Den Fremdsprachenlernern wird daher empfohlen, die Reflexivität einer lexikalischen Einheit in jedem einzelnen Fall auswendig zu lernen.
Die vollständige Auslagerung der Reflexivierung in den Bereich der Lexik mag für den Fremdsprachenunterricht zweckdienlich sein; aus Sicht der Grammatiktheorie ist sie unbefriedigend. Zum einen unterliegt die Reflexivierung nachweislich bestimmten grammatischen Regularitäten, die in der sprachwissenschaftlichen Literatur exakt beschrieben sind. So braucht das Reflexivpronomen etwa ein Antezedens, das in einem strukturell festgelegten Abstand vom Reflexivpronomen vorkommen muss. Im Tschechischen ist es z. B. nicht möglich, dass sich das Reflexivpronomen innerhalb einer infiniten Klausel auf eine Person bezieht, die zwar im übergeordneten Satz genannt wird, aber nicht gleichzeitig das implizite Agens der durch das infinite Verb ausgedrückten Handlung ist (vgl. Karlík 1999, 52). Dementsprechend kann sich si in (6) nur auf die Soldaten, nicht auf den Korporal beziehen.
Details
- Pages
- 290
- Publication Year
- 2016
- ISBN (Hardcover)
- 9783631674703
- ISBN (PDF)
- 9783653066814
- ISBN (MOBI)
- 9783653958492
- ISBN (ePUB)
- 9783653958508
- DOI
- 10.3726/978-3-653-06681-4
- Language
- German
- Publication date
- 2016 (June)
- Keywords
- Reflexivpronomen Valenztheorie Dekausativierung Aktantenrahmen Übersetzungsäquivalenz
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. 290 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG