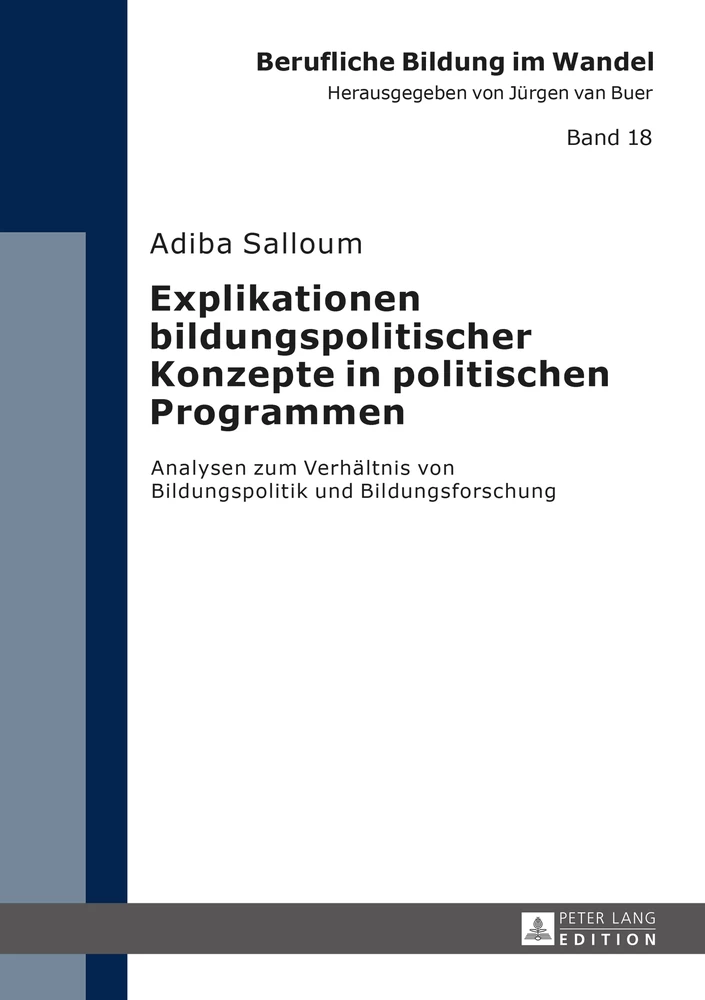Explikationen bildungspolitischer Konzepte in politischen Programmen
Analysen zum Verhältnis von Bildungspolitik und Bildungsforschung
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung zum Forschungsgegenstand
- 1.1 Voraussetzungen
- 1.2 Aufbau
- 2. Präzisierung des Forschungsdesiderats
- 2.1 Funktionen von Wahlprogrammen
- 2.2 Legitimation bildungspolitischer Entscheidungen in Wahlprogrammen
- 2.3 Funktionen von Bildungsforschung im bildungspolitischen Kontext
- 2.4 Zusammenfassung der Fragestellungen und Hypothesen
- 3. Theoretische Grundlagen
- 3.1 Funktionen von Texten politischer Kommunikation
- 3.1.1 Vorüberlegungen zum Begriff Text
- 3.1.2 Allgemeine Einordnung von Texttypen und Textfunktionen
- 3.1.2.1 Texte in der Politik
- 3.1.2.2 Exkurs: Nicht-schriftliche politische Kommunikation
- 3.1.3 Politische Textsorte ‚Wahlprogramm’
- 3.1.3.1 Wahlprogramme als Bestandteil politischer Kommunikation
- 3.1.3.2 Entstehungskontext eines Wahlprogrammes
- 3.1.3.3 Idealtypische Struktur eines Wahlprogrammes
- 3.1.4 Kriterien für die Analyse der Wahlprogramme
- 3.2 Nutzung von Legitimationsformulierungen in parteipolitischen Texten
- 3.2.1 Eingrenzung des Begriffes der Legitimation
- 3.2.1.1 Politische Legitimität
- 3.2.1.2 Begriffliche Einschränkung und Verwendungskontext
- 3.2.2 Legitimation durch Kommunikation
- 3.2.3 Grundlagen zur Identifikation innertextlicher Legitimationsmodi innerhalb des Persuasionsprozesses
- 3.2.3.1 Botschaft als Kommunikationsinput innerhalb des Persuasionsprozesses: Argumente und Informationen
- 3.2.3.2 Quelle als Kommunikationsinput innerhalb des Persuasionsprozesses: Verweise und Referenzen
- 3.2.4 Prüfmuster für die verwendeten Legitimationsmodi
- 3.3 Darstellung von Bildungsforschung im Kontext von Bildungspolitik
- 3.3.1 Betrachtung von Bildungsforschung und -politik
- 3.3.1.1 Allgemeine Definitionen
- 3.3.1.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- 3.3.1.3 Ziele
- 3.3.2 Zusammenarbeit von Bildungsforschung und Bildungspolitik
- 3.3.2.1 Rollen der Akteursgruppen
- 3.3.2.2 Herausforderungen und Handlungsmuster
- 3.3.3 Auswirkungen der Kooperation
- 3.3.3.1 Gegenseitige Abhängigkeiten
- 3.3.3.2 Wechselseitiger Legitimationsanspruch
- 3.3.3.3 Beispiel: Konferenz „Wissen für Handeln“
- 3.3.4 Bildungsberichterstattung der Bundesregierung
- 3.3.4.1 Konzept und Aufbau der Bildungsberichte
- 3.3.4.2 Schwerpunktthemen der Bildungsberichte
- 3.3.5 Rolle der Bildungsforschung aus der Perspektive von Bildungspolitik
- 4. Stand der empirischen Forschung und Abgrenzung zur gewählten Thematik
- 4.1 Textfunktionen innerhalb eines Wahlprogrammes
- 4.2 Innertextliche Legitimationsmodi in parteipolitischen Programmen
- 4.3 Das Konstrukt evidenzbasierter Bildungspolitik
- 4.4 Ausgangslage der Exploration
- 5. Forschungsdesign
- 5.1 Untersuchungsmethode
- 5.2 Beschreibung des Materials
- 5.3 Untersuchungsablauf
- 5.4 Codesystem
- 5.5 Identifikation der Begründungsstruktur und der Appellfunktion innerhalb der Exploration
- 6. Auswertung der Exploration
- 6.1 Strukturelle Analyse
- 6.1.1 Formale Kriterien
- 6.1.2 Strukturelle Kriterien
- 6.1.3 Wortschatzanalyse
- 6.1.4 Zwischenfazit: Strukturelle Analyse
- 6.2 Inhaltliche Analyse
- 6.2.1 Analyse der Codierungen auf Dokumentenebene
- 6.2.2 Kategorienbasierte Auswertung
- 6.2.2.1 Auswertung der Kategorie Bildung
- 6.2.2.1.1 Analyse: Bildung im Lebenslauf
- 6.2.2.1.2 Analyse: Schwerpunktthemen von Bildung
- 6.2.2.1.3 Analyse: Sonstiges außerhalb des Kapitels Bildung
- 6.2.2.1.4 Ergebnisse zur Kategorie Bildung
- 6.2.2.2 Auswertung der Kategorie Bildungsforschung
- 6.2.2.2.1 Analyse: Bildungsforschung – konkrete Studien
- 6.2.2.2.2 Analyse: Bildungsforschung – ohne Bezug zu einer konkreten Studie
- 6.2.2.2.2.1 Zahlen im Kapitel Bildung
- 6.2.2.2.2.2 Zusammenhänge und Vergleiche im Kapitel Bildung
- 6.2.2.2.3 Ergebnisse zur Kategorie Bildungsforschung
- 6.2.2.3 Auswertung der Kategorien Legitimation durch Forschung außerhalb des Kapitels Bildung und Zusammenarbeit mit Forschung
- 6.2.3 Zwischenfazit: Inhaltliche Analyse
- 6.3 Darstellung der Analyseergebnisse
- 7. Zusammenfassende Ergebnisse und Ausblick
- 7.1 Ergebnis: Funktionen von Wahlprogrammen
- 7.2 Ergebnis: Legitimation bildungspolitischer Entscheidungen
- 7.3 Ergebnis: Funktionen von Bildungsforschung im Kontext von Bildungspolitik
- 7.4 Weitere Auffälligkeiten
- 7.5 Ein kurzes Fazit
- 8. Literaturverzeichnis
- 9. Anhang
- 9.1 Politische Textsorten
- 9.2 Aufbau der Bildungsberichte
- 9.3 Häufigkeiten verwendeter Konjunktionen
- 9.4 Wortwolken der Wahlprogramme
- 9.5 Worthäufigkeiten aus der Wortwolke
- 9.6 Häufigkeiten der Codings
1. Einleitung zum Forschungsgegenstand
„Die Aufgabe der Bildungsforschung besteht darin, wissenschaftliche Informationen auszuarbeiten, die eine rationale Begründung bildungspraktischer und bildungspolitischer Entscheidungen ermöglichen“ (Tippelt & Schmidt, 2010, S. 9).
Folgt man der zitierten Grundüberzeugung, bietet Bildungsforschung eine Begründungsmöglichkeit für Entscheidungen, die im Feld der Bildungspolitik getroffen werden.1 Auf dieser Ebene der Politik unterliegen Entscheidungen einem deutlichen Rechtfertigungsdruck gegenüber Bürgern.2 Das Ergebnis dieser Entscheidungsprozesse erhalten die politischen Akteure durch freie regelmäßige Wahlen. Die Wahlergebnisse sind u.a. davon abhängig, inwiefern es den Regierenden gelingt, die eigenen Entscheidungen zu legitimieren und ob die Bürger diesen Begründungen der Politiker folgen (vgl. (Falter & Schoen, 2005, S. 28)). Ergebnisse der Bildungsforschung könnten dementsprechend dazu genutzt werden, bildungspolitische Reformen rational zu begründen.
Das Spannungsfeld des angesprochenen Forschungsdesiderats bewegt sich zwischen der Bildungsforschung, der Bildungspolitik und der Öffentlichkeit. Dabei handelt es sich um multilaterale Beziehungen. Die Bürger verlangen nicht nur eine Begründung politischer Entscheidungen, sondern sie sind ebenso Forschungsrezipienten; sie bringen die Resultate über die Herstellung des öffentlichen Interesses in politische Entscheidungsprozesse ein. Eine unterstellte Absicht der Bürger ist die Behebung wahrgenommener Defizite. Obwohl diese Problemlagen meist komplex und selten kurzfristig zu lösen sind, ist der Anspruch der Bürger, eine schnelle, empirisch gesicherte und rational begründete Lösung zu finden (vgl. (Prenzel, 2005, S. 13)). Die Reaktionen auf die Ergebnisse der ersten PISA-Untersuchung3 ist dafür ein geeignetes Beispiel: Die Öffentlichkeit verlangte von der Bildungspolitik eine Erklärung für die im Vergleich zu anderen Ländern unterdurchschnittlichen Ergebnisse der deutschen Schüler. Ein besonderer Fokus wurde dabei auf die Lernleistungen der Jugendlichen im Verhältnis zu den ← 1 | 2 → Bildungsausgaben Deutschlands gelegt. Während die Frage nach den Gründen für die Resultate eventuell einfach zu stellen ist, fällt die Beantwortung durch die Komplexität der Ursachen schwer (vgl. (Oelkers, 2003, S. 9)). Sowohl die Studie selbst als auch die Ursachenuntersuchung konnten in der empirischen Bildungsforschung durchgeführt werden, doch die Konsequenzen waren bildungspolitisch zu treffen. Auffällig war, dass die besonders negative Darstellung genutzt wurde, um politische Aufmerksamkeit zu erregen sowie bildungspolitische Entscheidungen zu forcieren. Auch weil Bildungsprobleme generell schwer sichtbar sind, bringt erst deren Inszenierung die notwendige Aufmerksamkeit, die sie zur Lösung benötigen (vgl. (Oelkers, 2003, S. 15)). Dies ist durch zwei Akteursgruppen möglich: die Öffentlichkeit kann selbst dafür verantwortlich sein oder die Bildungsforschung spiegelt die Ergebnisse an die Bildungspolitik zurück.
„Zum einen liefert die Bildungsforschung strukturierte und relativ sichere Informationen über die Realitäten im Bildungssystem […]. Dabei macht sie auf Probleme und Defizite aufmerksam. Politiker/innen brauchen solche Informationen, wenn sie realitätsgerecht agieren und ihr Handeln plausibel begründen wollen. Zum anderen können Befunde der Bildungsforschung zum Gegenstand der öffentlichen Debatte werden und auf diese Weise in den politischen Prozess eindringen“ (Tillmann, Dedering, Kneuper, Kuhlmann, & Nessel, 2008, S. 47).
Die Bildungspolitik unterliegt einem Rechtfertigungsdruck gegenüber den Wählern, häufig werden bestehende Problemlagen vereinfacht dargestellt. Eigene Positionen werden bis zur Wahl etwas weniger explizit benannt, sodass wahltaktische Überlegungen vermutet werden können (vgl. (Sarcinelli, 1987, S. 242)). Aufgrund dieser Beobachtung wird es in der vorliegenden Arbeit um die Analyse von Textdokumenten aus der Wahlkampfphase gehen; in ihnen sollten Begründungen von politischen Akteuren angeboten und von der Öffentlichkeit eingefordert werden.4 In der Untersuchung steht immer das direkte Kommunikationsmedium im Vordergrund, es werden keine vertiefenden Analysen zu Beratungsstrukturen innerhalb des politischen Agierens aufgestellt, obwohl sich auch im Bereich Bildungspolitik „[…] ein wachsendes gesellschaftliches Interesse an einer wissenschaftlich fundierten Bildungspolitikberatung ablesen […]“ (Reuter & Sieh, 2010, S. 195) lässt. Die Funktionen und Leistungen von Politikberatung, ← 2 | 3 → die gegebenenfalls außerhalb der direkten Bezüge von Bildungsforschung in politische Entscheidungen einfließen, werden in dieser Arbeit vernachlässigt.5
„Die empirisch ausgerichtete Bildungsforschung zielt darauf ab, stattfindende Erziehungs- und Bildungsprozesse sowie deren Bedingungen und Ergebnisse zu untersuchen. Ihr Anspruch ist es, erfahrungswissenschaftlich abgesichertes Wissen bereitzustellen, mit dem die Erziehungswirklichkeit besser verstanden und gegebenenfalls zielgerichtet verändert werden kann“ (Prenzel, 2005, S. 7).
Details
- Pages
- XIX, 269
- ISBN (Hardcover)
- 9783631675540
- ISBN (PDF)
- 9783653070798
- ISBN (MOBI)
- 9783653957495
- ISBN (ePUB)
- 9783653957501
- DOI
- 10.3726/978-3-653-07079-8
- Language
- German
- Publication date
- 2016 (August)
- Keywords
- Evidenzbasierung Bildungspolitikberatung Rationalität Transparenz
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. XX, 269 S., 20 s/w Abb., 37 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG