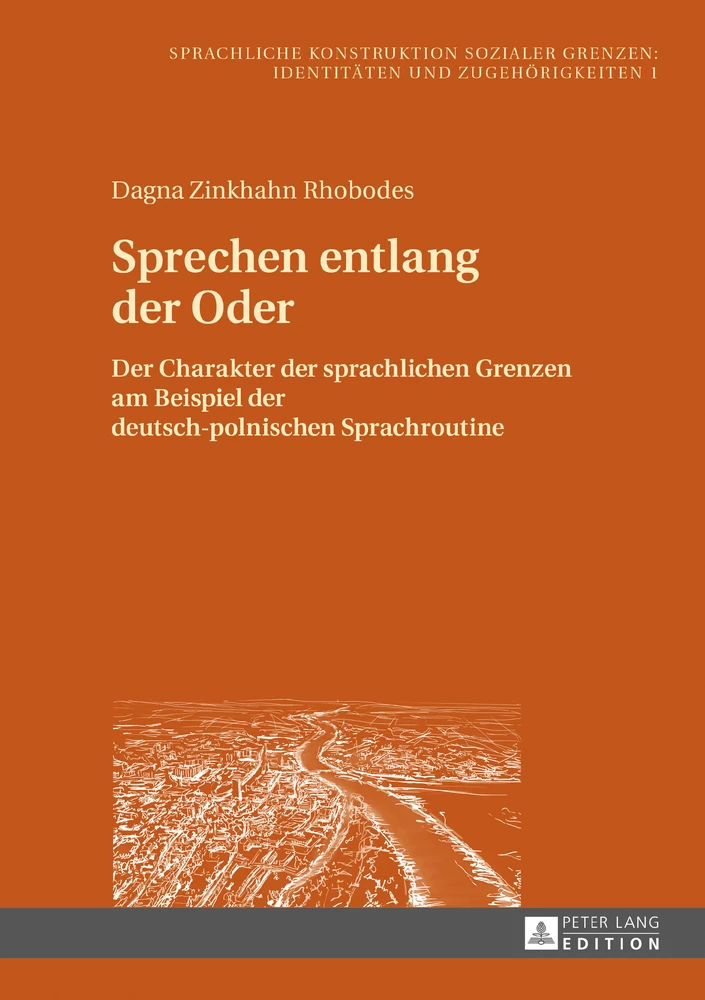Sprechen entlang der Oder
Der Charakter der sprachlichen Grenzen am Beispiel der deutsch-polnischen Sprachroutine
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Grafikverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Datenbelegverzeichnis
- I Einleitung
- 1 Gegenstand und Ziele der Arbeit
- 1.1 Gegenstand der Arbeit
- 1.2 Ziele der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- II Forschungsstand und Theoretische Grundlagen
- 2 Uni – pluri – inter – trans: Sprachenkontakt und Perspektiven innerhalb der Kultur- und Sprachwissenschaften
- 2.1 Sprachenkontakt
- 2.2 Unikulturelle Phase
- 2.3 Plurikulturelle Phase
- 2.4 Interkulturelle Phase
- 2.5 Transkulturelle Phase
- 2.6 Mehrsprachigkeit als Normalfall
- 3 Code-switching-Forschung
- 3.1 Terminologische Grundlagen
- 3.1.1 Code-switching
- 3.1.2 Code-mixing
- 3.1.3 Code-switching und Code-mixing als Etappen eines Kontinuums
- 3.1.4 Diskussion um die Abgrenzung zwischen Code-switching und Entlehnung
- 3.1.4.1 Code-switching und Entlehnung als zwei getrennte Phänomene
- 3.1.4.2 Code-switching und Entlehnung als Teile eines Kontinuums
- 3.1.5 Konvergenz
- 3.1.6 Kreolisierung
- 3.2 Verschiedene Erscheinungsformen des Sprachwechsels
- 3.2.1 Extrasententialer, intersententialer und intrasententialer Sprachwechsel
- 3.2.2 Flüssiger versus kommentierten Sprachwechsel
- 3.3 Sprachwechsel aus struktureller Perspektive – ein Forschungsüberblick
- 3.3.1 Distributionalistisch-variationistische Ansätze
- 3.3.2 Insertion-Modelle
- 3.3.3 Generative Ansätze
- 3.3.4 Zusammenfassung
- 3.4 Sprachwechsel-Modelle
- 3.4.1 Äquivalenzmodell und Morphemrestriktion
- 3.4.2 Rektionsbeschränkung
- 3.4.3 Matrix-Language-Frame Modell
- 3.4.4 Typologie des Sprachwechsels nach Muysken
- 3.5 Zusammenfassung
- 4 Deutsch-polnischer Sprachenkontakt
- 4.1 Exkurs: Kurzer geschichtlicher Abriss der deutsch-polnischen Sprachenkontakte
- 4.2 Literaturüberblick
- 4.2.1 Lexikalische Entlehnungen
- 4.2.2 Zweisprachiger Sprachgebrauch
- 4.2.3 Viadrinisch
- 4.3 Exkurs: Geschichtlicher Abriss der polnischen Migration nach Deutschland
- 5 Drei Ebenen des Sprachenkontakts
- 5.1 Phonetik
- 5.1.1 Strategien der phonetischen Anpassung
- 5.1.2 Phonetische Grenze als „graue Zone“
- 5.1.3 Deutsche und polnische Phonetik aus kontrastiver Sicht
- 5.1.3.1 Vokale
- 5.1.3.2 Konsonanten
- 5.2 Morphologie
- 5.2.1 Morphologische Integration
- 5.2.1.1 Nomen
- 5.2.1.2 Verben
- 5.2.2 Deutsche und polnische Morphologie aus kontrastiver Sicht
- 5.2.2.1 Nomen
- 5.2.2.2 Verben
- 5.2.3 Morphologische Adaptation deutscher Nomen und Verben ins Polnische
- 5.3 Syntax
- 5.3.1 Syntaktischer Transfer und syntaktische Konvergenz
- 5.3.2 Lehnübersetzung
- 5.3.3 Deutsche und polnische Syntax aus kontrastiver Sicht
- 6 Grenze aus kulturwissenschaftlicher Perspektive
- 6.1 Etymologie des Begriffs der Grenze
- 6.2 Signifikat und Manifestationen der Grenze
- 6.3 Der Grenzbegriff in den Kulturwissenschaften
- 6.3.1 Einleitendes
- 6.3.2 Drei Dimensionen der Grenze
- 6.3.2.1 Differenzierung
- 6.3.2.2 Überschreitung
- 6.3.2.3 Bildung der Grenzzonen
- 6.3.2.3.1 Dritter Raum nach Bhabha
- 6.3.2.3.2 Liminalität nach Turner
- 7 Grenze & Linguistik: Vorschlag eines interdisziplinären Analyseansatzes
- 7.1 Der Begriff der Grenze in den Sprachwissenschaften
- 7.2 Der Begriff der Grenze in der Sprachenkontaktforschung
- 7.3 Ansatz zur Verschränkung des Grenzbegriffs mit der Linguistik
- 7.3.1 Durabilität, Permeabilität und Liminalität der sprachlichen Grenzen
- 7.3.2 Zusammenfassung
- 7.4 Dynamische Typologie der Sprachwechselphänomene
- III Methodologie
- 8 Forschungsdesign
- 8.1 Methodologische Vorgehensweise
- 8.2 Forschungsfragen
- 8.3 Analysemodell
- 8.4 Transkription und Annotation
- 8.5 Datenerhebung
- 8.5.1 Untersuchungsorte
- 8.5.1.1 Exkurs: Frankfurt/Oder und Słubice
- 8.5.1.2 Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder
- 8.5.1.3 Karl-Liebknecht-Gymnasium in Frankfurt/Oder
- 8.5.1.4 Robert-Jungk-Oberschule in Berlin
- 8.5.2 Probanden
- 8.5.2.1 Studierende aus der EUV
- 8.5.2.2 SchülerInnen aus dem KLG
- 8.5.2.3 SchülerInnen aus der RJO
- 8.5.3 Sprachaufnahmen
- IV Datenanalyse
- 9 Analyse des Charakters der sprachlichen Grenzen
- 9.1 Bestimmung der syntaktischen, morphologischen und phonetischen Grenzen
- 9.2 Durabilität
- 9.2.1 Sprachwechsel an der SATZgrenze
- 9.2.2 Sprachwechsel an der PHRASENgrenze
- 9.2.3 Sprachwechsel an der WORTgrenze
- 9.2.4 Sprachwechsel an der MORPHEMgrenze
- 9.2.5 Zusammenfassung und Zwischenergebnisse
- 9.3 Permeabilität
- 9.3.1 Sprachwechsel an der SATZgrenze
- 9.3.2 Sprachwechsel an der PHRASENgrenze
- 9.3.3 Sprachwechsel an der WORTgrenze
- 9.3.4 Sprachwechsel an der MORPHEMgrenze
- 9.3.5 Zusammenfassung und Zwischenergebnisse
- 9.4 Liminalität
- 9.4.1 Sprachwechsel an der SATZgrenze
- 9.4.2 Sprachwechsel an der PHRASENgrenze
- 9.4.3 Sprachwechsel an der WORTgrenze
- 9.4.4 Sprachwechsel an der MORPHEMgrenze
- 9.4.5 Zusammenfassung und Zwischenergebnisse
- 9.5 Exkurs: Deutsch-polnische Sprachverknüpfungen im Sprachgebrauch der deutschmuttersprachlichen SprecherInnen
- 9.5.1 Durabilität
- 9.5.2 Permeabilität
- 9.5.3 Liminalität
- 9.5.4 Zusammenfassung
- 9.6 Durabilität, Permeabilität und Liminalität im Gesamtkorpus und im Gruppenvergleich
- V Abschluss
- 10 Ergebnisse
- 11 Beitrag zum Forschungsstand
- Literaturverzeichnis
Stuttgart-Tübingen-Tagset (STTS)
ADJD adverbiales oder prädikatives Adjektiv
ADV Adverb
APPR Präposition
ART bestimmter oder unbestimmter Artikel
CARD Kardinalzahl
ITJ Interjektion
KOUS unterordnende Konjunktion mit Satz
KON nebenordnende Konjunktion
NN normales Nomen
PDS substituierendes Demonstrativpronomen
PDAT attribuierendes Demonstrativpronomen
PIS substituierendes Indefinitpronomen
PIAT attribuierendes Indefinitpronomen ohne Determiner
PPER irreflexives Personalpronomen
PPOSAT attribuierendes Possessivpronomen
PRF reflexives Personalpronomen
PTKNEG Negationspartikel
PTKA Partikel bei Adjektiv oder Adverb
VVFIN finites Verb, voll
VVINF Infinitiv, voll
VVPP Partizip Perfekt, voll
VAFIN finites Verb, aux
VMFIN finites Verb, modal
Grammatische Kategorien
1 erste Person
2 zweite Person
3 dritte Person
ADJVR Adjektivalisierung
AKK Akkusativ
DAT Dativ
F Femininum
FUT Futur
GEN Genitiv
INF Infinitiv
INSTR Instrumental
LOC Lokativ
M Maskulinum
N Neutrum
NOM Nominativ
NR Nominalisierung
PFV vollendeter Aspekt
PL Plural
PRED Prädikativ
IMP Imperativ
PRS Präsens
PST Präteritum
SG Singular
Sonstige Abkürzungen
ADVP Adverbialphrase
D durabel
L liminal
MG Morphemgrenze
NP Nominalphrase
P permeabel
PG Phrasengrenze
S Satz
SG Satzgrenze
VP Verbalphrase
PP Präpositionalphrase
ADJP Adjektivphrase
WG Wortgrenze
Transkriptionszeichen (HIAT)
• - kurzes Stocken im Redefluss
• • - geschätzte Pause bis zu einer halben Sekunde ← 12 | 13 →
• • • - geschätzte Pause bis zu einer dreiviertel Sekunde
((1s)) - gemessene Pause ab einer Sekunde
/ - Reparatur
… - abgebrochene Äußerung
: - Ankündigung
Grafik 1: Methodologische Vorgehensweise
Grafik 2: Dynamische Typologie der bilingualen Rede (nach Auer 1998)
Grafik 3: Mögliche Stellen des Sprachwechsels (nach Poplack 1980)
Grafik 4: Phrasenstrukturmodell (nach Woolford 1983)
Grafik 5: Alternation
Grafik 6: Insertion
Grafik 7: Kongruente Lexikalisierung
Grafik 8: Alternation, Insertion und kongruente Lexikalisierung im Kontinuum
Grafik 9: Vokaltrapez des Deutschen
Grafik 10: Vokaltrapez des Polnischen
Grafik 11: Gegenüberstellung der deutschen und polnischen Vokale
Grafik 12: Gegenüberstellung der deutschen und polnischen Konsonanten
Grafik 13: Genera im Polnischen
Grafik 14: Trennende Grenze (nach Donec 2014)
Grafik 15: Teilende Grenze (nach Donec 2014)
Grafik 16: Verschwindende Grenze (nach Donec 2014)
Grafik 17: Grenze als Rand/Ende und Rand/Beginn (nach Donec 2014)
Grafik 18: Grenze als „Mischzone/Hybrides“ (nach Donec 2014)
Grafik 19: Grenze als „das Dazwischen“ (nach Donec 2014)
Grafik 20: Grenze als Schwelle „nach oben“ und „nach unten“ (nach Donec 2014)
Grafik 21: Grenze als Barriere (nach Donec 2014)
Grafik 22: Liminalitätsmodell (nach Turner 1969)
Grafik 23: Durabilität der sprachlichen Grenzen
Grafik 24: Permeabilität der sprachlichen Grenzen
Grafik 25: Liminalität der sprachlichen Grenzen
Grafik 26: Durabilität, Permeabilität und Liminalität der sprachlichen Grenzen
Grafik 27: Kontinuumsmodell
Grafik 28: Das Analysemodell
Grafik 29: Studierendenstatistik der EUV nach Herkunft der Studierenden
Grafik 30: Durabilität, Permeabilität und Liminalität (absolute Anzahl im Gesamtkorpus) ← 15 | 16 →
Grafik 31: Satz-, Phrasen-, Wort- und Morphemgrenze (absolute Anzahl im Gesamtkorpus)
Grafik 32: Durabilität, Permeabilität und Liminalität an unterschiedlichen strukturellen Stellen (in % vom Gesamtkorpus)
Grafik 33: Charakter der sprachlichen Grenzen im Gruppenvergleich
Grafik 34: Strukturelle Stellen des Sprachwechsels im Gruppenvergleich
Grafik 35: Charakter der sprachl. Grenzen an unterschiedlichen strukturellen Stellen im Gruppenvergleich
Tabelle 1: Unterscheidungskriterien von Entlehnung, Ad-hoc-Entlehnung und Code-switching
Tabelle 2: Linguistische Kriterien zur Bestimmung von Insertion, Alternation und kongruenter Lexikalisierung
Tabelle 3: Extralinguistische Faktoren zur Bestimmung von Alternation, Insertion und kongruenter Lexikalisierung
Tabelle 4: Geschichtlicher Abriss der polnischen Migration nach Deutschland
Tabelle 5: Unterschiede im deutschen und polnischen Vokalsystem
Tabelle 6: Das Konsonantensystem im Deutschen
Tabelle 7: Das Konsonantensystem im Polnischen
Tabelle 8: Unterschiede im deutschen und polnischen Konsonantensystem
Tabelle 9: Das Kasussystem im Polnischen
Tabelle 10: Das Kasussystem im Deutschen
Tabelle 11: Genuszuweisung im Polnischen anhand morphophonologischer Kriterien
Tabelle 12: Wortstellung in Aussagesätzen im Polnischen und Deutschen
Tabelle 13: Satzgliedstellung in unterschiedlichen Satztypen im Polnischen und Deutschen
Tabelle 14: Analysespuren
Tabelle 15: Befragte aus der EUV (Erstsprache Pol.)
Tabelle 16: Befragte aus der EUV (Erstsprache Dt.)
Tabelle 17: Befragte aus dem KLG
Tabelle 18: Befragte aus der RJO
Tabelle 19: Deklination der maskulinen Substantive mit dem Auslaut –t
Tabelle 20: Durabilität, Permeabilität und Liminalität sowie strukturelle Stellen des Sprachwechsels (absolute Anzahl im Gesamtkorpus und im Gruppenvergleich)
Tabelle 21: Verlauf der phonetischen, morphologischen und syntaktischen Grenzen
Tabelle 22: Zusammenfassung der Ergebnisse
Datenbeleg 1: ich fühl’ mich angesprochen
Datenbeleg 2: czyli internationale Verträge
Datenbeleg 3: wiesz tam Platzhalter
Datenbeleg 4: do Prüfungsamt
Datenbeleg 5: na Mauer
Datenbeleg 6: Mamy Potenzregel. No ona mówi
Datenbeleg 7: taki richtig schlechtes Bild
Datenbeleg 8: jakieś tam kleine Aufgaben
Datenbeleg 9: taki bardzo duży jakby Hausarbeit
Datenbeleg 10: ten Prüfung cały
Datenbeleg 11: napisałaś już swoją Rede?
Datenbeleg 12: było jakieś Hausaufgabe?
Datenbeleg 13: tych Hausarbeitów
Datenbeleg 14: mamy Falla
Datenbeleg 15: bastelować
Datenbeleg 16: musimy skundigować
Datenbeleg 17: pracy bachelorskiej
Datenbeleg 18: wyräumuj Spülmaschine
Datenbeleg 19: jakie ono było stare
Datenbeleg 20: do Sprachenz/centrum, żeby odebrać
Details
- Seiten
- 386
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (Hardcover)
- 9783631681015
- ISBN (ePUB)
- 9783631707746
- ISBN (MOBI)
- 9783631707753
- ISBN (PDF)
- 9783653071986
- DOI
- 10.3726/978-3-653-07198-6
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Januar)
- Schlagworte
- Sprachkontakt Code-switching Sprachmischung Morphosyntax Hybridität Liminalität
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2016. 386 S., 9 farb. Graf., 26 s/w Graf., 22 s/w Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG