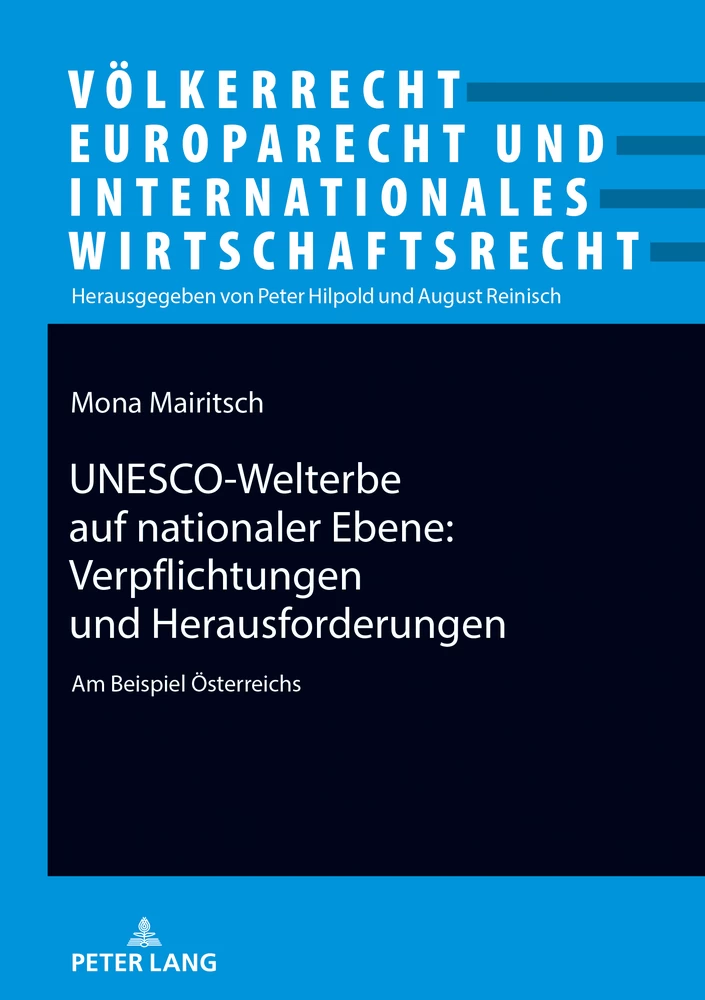UNESCO-Welterbe auf nationaler Ebene: Verpflichtungen und Herausforderungen
Am Beispiel Österreichs
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Herausgeberangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Danksagung
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung: Themenskizze, Literatur, Aufbau der Arbeit
- 2. Überblick über die Thematik und Grundproblematik: Die Theorie und die Praxis
- 3. Das Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt: Entstehung, Inhalt, Rechte und Pflichten der Vertragsstaaten
- 3.1 Geschichte
- 3.2 Rechtsnatur
- 3.2.1 Das Übereinkommen
- 3.2.2 Die Operativen Richtlinien
- 3.2.3 Die Beschlüsse des Komitees
- 3.3 Norminhalt
- 3.4 Rechte und Pflichten für Vertragsstaaten
- 3.4.1 Rechte
- 3.4.2 Pflichten
- 3.5 Zusammenfassung
- 3.5.1 Geschichte
- 3.5.2 Rechtsnatur
- 3.5.3 Norminhalt
- 3.5.4 Rechte und Pflichten der Vertragsstaaten
- 4. Die Kernverpflichtungen zum nationalen und internationalen Schutz: Die Artikel 4 bis 6 im Übereinkommen
- 4.1 Nationaler Schutz und Erhalt: Art 4 und Art 5
- 4.1.1 Verpflichtungsart
- 4.1.1.1 Der Übereinkommenstext
- 4.1.1.2 Die Operativen Richtlinien zum Übereinkommen
- 4.1.1.3 Die travaux préparatoires
- 4.1.1.4 Die Anwendungspraxis
- 4.1.1.5 Die Umsetzung in Österreich
- 4.1.1.6 Blick nach Deutschland
- 4.1.1.7 Der Kommentar zum Übereinkommen
- 4.1.1.8 Die Fachliteratur
- 4.1.1.9 Zusammenfassung, Fazit und Zwischenergebnis
- 4.1.2 Verpflichtungsgrad
- 4.1.3 Schutzgegenstand
- 4.1.4 Schutzmaßnahmen
- 4.2 Internationale Hilfe und Unterstützung: Art 6
- 4.2.1 Verpflichtungsart und -grad
- 4.2.2 Schutzgegenstand
- 4.2.3 Schutzmaßnahmen
- 4.3 Zusammenfassung
- 4.3.1 Nationaler Schutz und Erhalt
- 4.3.2 Internationale Hilfe und Unterstützung
- 5. Umsetzung des Übereinkommens in Österreich: Ratifizierung, Rechtsumsetzung und Rechtsprechung
- 5.1 Ratifizierung und Inkrafttreten
- 5.2 Rechtsumsetzung
- 5.3 Rechtsprechung
- 5.4 Zusammenfassung
- 5.4.1 Ratifizierung
- 5.4.2 Rechtsumsetzung
- 5.4.3 Rechtsprechung
- 6. Schlussfolgerungen und Ausblick
- 6.1 Normativer Gehalt der Verpflichtungen der Vertragsstaaten auf nationaler Ebene
- 6.2 Normative Wirkung des Übereinkommens im nationalen Recht
- Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Themenskizze, Literatur, Aufbau der Arbeit
Das UNESCO-Welterbe mit dem „Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“1 aus 1972, im Folgenden Welterbe-Übereinkommen, weist eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte auf: Von 193 Staaten2 unterzeichnet, besitzt es universelle Gültigkeit und zählt zu den Völkerrechtsverträgen mit den meisten Vertragsstaaten.3 Die Welterbeliste4 verleiht dem Übereinkommen große Sichtbarkeit und den Staaten Ansehen. Mittlerweile verzeichnet sie über 1.000 Welterbestätten5 und ein Ende dieser Popularität ist nicht in Sicht.
Die anfängliche Euphorie weicht aber auch langsam einer gewissen Ernüchterung. In den ersten Jahrzehnten wurde das Welterbe vor allem als Prädikat, als Auszeichnung ohne weitere oder weitreichendere Verpflichtungen wahrgenommen. Der rechtliche Schutz, der vom Übereinkommen ausgehen sollte, schien in der Praxis auch kaum Probleme aufzuwerfen. Gab es Interessenskonflikte, konnten diese durch Verhandlungen im Vorfeld, Kompromisse und Eingeständnisse für alle Parteien mehr oder weniger zufriedenstellend beigelegt werden.
In den letzten Jahrzehnten stiegen jedoch in Zahl und Ausmaß die Problemfälle in Welterbestätten, zumeist verbunden mit Bauvorhaben. Auch in Österreich ist keine der Welterbestätten6 von größeren Konflikten verschont geblieben, ←15 | 16→die in vielen Fällen medial ausgetragen wurden und werden. Überblicksmäßig seien hier erwähnt:
–die ‚Semmeringeisenbahn‘ mit dem Bau des Semmering-Basistunnels;
–die historischen Stadtzentren von ‚Graz‘ und ‚Salzburg‘ mit diversen Bauvorhaben wie dem Kastner & Öhler Ausbau oder die Bebauung des Dr.-Franz-Rehrl-Platzes;
–die Kulturlandschaften ‚Wachau‘, ‚Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut‘ und der ‚Neusiedler See‘ mit Gewerbe- und Wohnbauprojekten und der Frage der landschaftsverträglichen Bebauung;
–‚Schönbrunn‘ mit einem geplanten Hochhaus auf den sogenannten Komet-Gründen, oder die beabsichtigte Integrierung des Botanischen Gartens in den Zoo;
–das historische Zentrum von ‚Wien‘ mit Hochhausprojekten in Wien-Mitte, beim neu entwickelten Areal des Hauptbahnhofs und aktuell am Heumarkt. Das Projekt ‚Hotel Intercontinental-Eislaufverein-Konzerthaus‘ am Heumarkt mit seinem projektierten 72 m und dann auf 63 m reduzierten Wohnturm, das sich in der Kernzone des Welterbegebietes befindet, hat ua sogar dazu geführt, dass das „Historische Zentrum von Wien“ vom Welterbekomitee bei seiner 41. Sitzung in Krakau im Juli 2017 als gefährdet eingestuft und auf die „Liste des gefährdeten Erbes der Welt“ gesetzt wurde.7
Bei all diesen Konflikten wurde das Übereinkommen je nach Interessenslage in den Mittelpunkt der Argumentation gegen einen Bau gestellt oder es wurde als innerstaatlich rechtlich irrelevantes Instrument, als Geschmacksfrage abgetan. Eine profunde Auseinandersetzung mit dem Übereinkommen und seinen rechtlichen Implikationen fand jedoch kaum statt. Diese Tatsache spiegelt sich auch in der vorhandenen Literatur zum Thema Welterbe und Recht wider. Im Vergleich zu anderen UNESCO-Rechtsinstrumenten gibt es hierzu wenig Literatur. Erst der Streit um den Bau der vierspurigen Waldschlößchenbrücke in der Welterbestätte Dresdner Elbtal, wo sich deutsche Gerichte bis hin zum Bundesverfassungsgericht8 mit dem Übereinkommen beschäftigen mussten, führte im ←16 | 17→deutschsprachigen Raum zu einem Wandel und es begann eine systematische Auseinandersetzung mit dem Thema.
Auch in Österreich gewinnt, ausgelöst durch das umstrittene Hochhausprojekt am Heumarkt in Wien, die Frage der rechtlichen Bindungswirkung des Übereinkommens an Relevanz.9 Dabei profitieren wir von der infolge des deutschen Rechtsstreits entstandenen Fachliteratur, auch wenn ihre Anzahl weiterhin überschaubar bleibt. Bei der Rechtsprechung müssen wir uns mit ein paar wenigen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen und einer höchstgerichtlichen Entscheidung begnügen.10 Das Welterbe-Übereinkommen ist damit weder wissenschaftlich ausreichend abgehandelt, noch durch- oder ausjudiziert, als dass man von einer übereinstimmenden Auslegung sprechen könnte.
Details
- Seiten
- 140
- Erscheinungsjahr
- 2019
- ISBN (Paperback)
- 9783631770498
- ISBN (PDF)
- 9783631772829
- ISBN (ePUB)
- 9783631772836
- ISBN (MOBI)
- 9783631772843
- DOI
- 10.3726/b15226
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2019 (Februar)
- Schlagworte
- Schutz des Kultur- und Naturerbes Völkerrechtliche Verpflichtungen Welterbestätten Innerstaatlicher Schutz Normative Qualität Umsetzung
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019. 137 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG