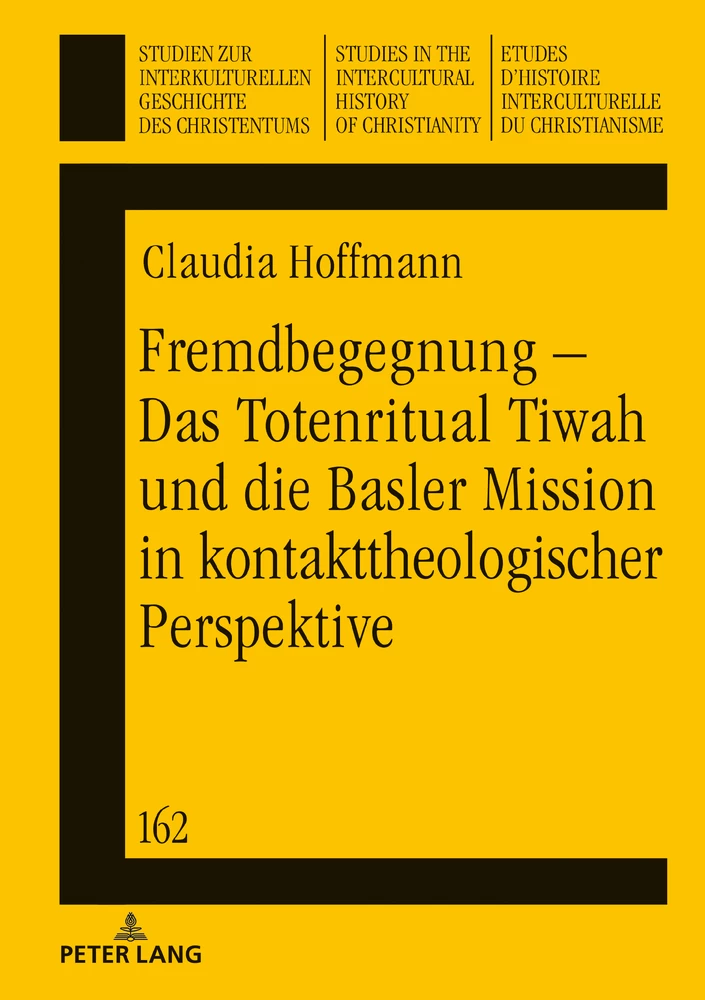Fremdbegegnung – Das Totenritual Tiwah und die Basler Mission in kontakttheologischer Perspektive
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort und Dank
- Abbildungen
- 1 Einleitung: Das Totenritual Tiwah als „Hauptfest der Dajacken“
- 1.1 Verstehen des Fremden
- 1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
- 1.3 Forschungsgeschichte zum Tiwah
- 1.3.1 Die Anfänge: Robert Hertz und Hans Schärer
- 1.3.2 Ein wichtiges Forschungsinteresse: Seelenvorstellungen
- 1.3.3 Indonesische Literatur: Identitätspolitik
- 1.3.4 Mehrstimmige Forschungsgeschichte
- 1.4 Quellen und methodischer Zugang
- 1.4.1 Quellenbestand
- 1.4.2 Historisch-hermeneutischer Zugang: Diskursanalyse
- 1.4.3 Sozialempirische Vorgehensweisen: Feldforschung
- 1.4.4 Herausforderungen des Methodenmixes
- 1.5 Theoretischer Rahmen
- 1.5.1 Missionsgeschichtliche Perspektive: Dort-zentrische Kontakttheologie
- 1.5.2 Bildwissenschaftliche Perspektive: „Imagetext“ und visuelle Rhetorik
- 1.5.3 Ritualtheoretische Perspektive: Gelebte Religion
- 2 Ein in der Tradition verankertes Totenritual und protestantische Beerdigungspraktiken
- 2.1 Beerdigungsriten in Hindu Kaharingan
- 2.1.1 Der Tod und die primäre Bestattung Mangubur
- 2.1.2 Das Wegschieben der Toten: Balian Tantulak Ambun Rutas Matei
- 2.1.3 Tiwah
- 2.2 Beerdigung in der Evangelischen Kirche Kalimantan
- 2.2.1 Andachten und Beisetzung
- 2.2.2 Stellungnahmen der Evangelischen Kirche Kalimantan
- 2.2.3 Grabrenovation und Umbettung der Toten
- 2.2.4 Beerdigungspraxis im Vergleich
- 2.3 Beerdigungsszenen in Bildern
- 2.3.1 Das Tiwah in Bildern
- 2.3.2 Christliche Beerdigung und Pemugaran Kuburan in Bildern
- 3 Kontexte des Tiwah-Diskurses
- 3.1 Geografische Einbettung
- 3.2 Religiöses und sittliches Orientierungssystem
- 3.2.1 Christentum
- 3.2.2 Traditionelles Religionssystem: Agama Helo und Hindu Kaharingan
- 3.2.3 Islam
- 3.2.4 Adat
- 3.3 Die Ngaju Dayak und ihre Beurteilung durch Missionare
- 3.4 Zwischenfazit: Diskursformationen im Abseits
- 4 Entstehung des Tiwah-Diskurses
- 4.1 Die Basler Mission
- 4.2 Missionarische Profile
- 4.2.1 Hugo Haffner
- 4.2.2 Mattheus Vischer
- 4.2.3 Hans Schärer
- 4.2.4 Die Missionarsfrau
- 4.3 Gereja Kalimantan Evangelis
- 4.4 Medien des Tiwah-Diskurses
- 4.4.1 Missionsfotografie
- 4.4.2 Tiwah-Fotografie
- 4.5 Transkulturelle Verwendung von Bildern
- 4.5.1 Das Tiwah in Zeitschriften
- 4.5.2 Das Tiwah in Lichtbilder-Vorträgen
- 4.5.3 Das Tiwah im Film
- 4.6 Imaginiertes Tiwah
- 5 Das Tiwah in der Perspektive von Missionaren
- 5.1 Dechiffrierung des Tiwah
- 5.1.1 Bauwerke
- 5.1.2 Ritualspezialisten
- 5.1.3 Festgemeinde
- 5.1.4 Blutige Tieropfer
- 5.2 Verstehensbemühungen
- 5.2.1 „Zeichen einer Gegenwelt des Christentums“: dualistisches Weltbild
- 5.2.2 „Andere Felder, andere Heuschrecken“: kulturalistisches Argument
- 5.2.3 Zwei mögliche Wege der „Volksmission“: Substitutionsmethode oder Anknüpfungspunkte
- 5.2.4 „Der Sinn der kultischen Totenbräuche“: verstehende Mission
- 5.2.5 „Lieber keine Christen als Tiwah-Christen“: pastoral-theologische Fragen
- 5.3 Zusammenfassung der Ergebenisse aus der Diskursanalyse
- 6 Zuordnung des Tiwah-Diskurses in die theologischen Strömungen der 1930er-Jahre
- 6.1 Die 1930er-Jahre als verschwiegene Zeit
- 6.2 Theologische Strömungen innerhalb der Basler Mission
- 6.2.1 Evangelische Religionskunde
- 6.2.2 Volksmission
- 6.2.3 Frühe dialektische Theologie
- 6.2.4 Religionsvergleichende Ansätze
- 6.2.5 Globale Diskurse
- 6.3 Kontakttheologie: Verschiebungen im theologischen Denken
- 7 Bilanz einer Fremdbegegnung
- 7.1 Methodische Impulse
- 7.2 Relevanz der Topoi aus dem Tiwah-Diskurs
- 7.3 Dort-zentrische Kontakttheologie
- 8. Abbildungs- und Literaturverzeichnis
- 8.1 Abbildungsverzeichnis
- 8.2 Archivquellen
- 8.2.1 Personalfaszikel
- 8.2.2 Berichte, Briefe und Drucksachen im Archiv der Basler Mission (BMA)
- 8.2.3 Berichte im Archiv der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG)
- 8.2.4 Berichte im Königlichen Institut für Sprache-, Land- und Völkerkunde (KITLV)
- 8.2.5 Bildnachweis erwähnter Bilder aus dem Archiv der Basler Mission
- 8.3 Gedruckte Quellen
- 8.4 Literaturverzeichnis
- 8.5 Filme
- 8.6 Internetverzeichnis
- Glossar
- Liste Experten und Expertinnen
- Personen-, Orts- und Sachindex
- Reihenübersicht
Claudia Hoffmann
Fremdbegegnung –
Das Totenritual Tiwah und
die Basler Mission in
kontakttheologischer Perspektive
![]()
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die Herausgabe des Bandes wurde betreut von
Professor Dr. Klaus Koschorke
ISSN 0170-9240
ISBN 978-3-631-72685-3 (Print)
E-ISBN 978-3-631-73379-0 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-631-73380-6 (EPUB)
E-ISBN 978-3-631-73381-3 (MOBI)
DOI 10.3726/b11733
© Peter Lang GmbH
Internationaler Verlag der Wissenschaften
Frankfurt am Main 2017
Alle Rechte vorbehalten.
Peter Lang Edition ist ein Imprint der Peter Lang GmbH.
Peter Lang – Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Diese Publikation wurde begutachtet.
Autorenangaben
Claudia Hoffmann ist Assistentin für Aussereuropäisches Christentum an der Theologischen Fakultät der Universität Basel, Schweiz. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der südostasiatischen Religions- und Missionsgeschichte mit Schwerpunkt Indonesien und in Fragen, wie sich das Christentum in der Schweiz durch Migration verändert.
Über das Buch
Diese missionsgeschichtliche Studie gibt Einblick in die konfliktreiche Zeit der 1930er-Jahre und zeigt die Theologieproduktion eines abgelegenen Missionsfeldes. Das komplexe Ritual der Sekundärbestattung der Ngaju Dayak in Mittelkalimantan, Indonesien, steht im Zentrum der Untersuchung. Die Autorin ergänzt die ethnographische und ritualtheoretische Herangehensweise durch Analysen von Archivalien der Basler Mission. Eine zentrale Rolle spielen dabei Fotografien, deren Beachtung in interkultureller Theologie an Bedeutung gewinnt. Das Buch bettet die Analyse-Ergebnisse in den theologischen und religionswissenschaftlichen Deutungsrahmen der 1930er-Jahre ein und erfasst die Verschiebungen in der theologischen Denkweise der Missionare mit dem Begriff der Kontakttheologie.
Zitierfähigkeit des eBooks
Diese Ausgabe des eBooks ist zitierfähig. Dazu wurden der Beginn und das Ende einer Seite gekennzeichnet. Sollte eine neue Seite genau in einem Wort beginnen, erfolgt diese Kennzeichnung auch exakt an dieser Stelle, so dass ein Wort durch diese Darstellung getrennt sein kann.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung: Das Totenritual Tiwah als „Hauptfest der Dajacken“
1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
1.3 Forschungsgeschichte zum Tiwah
1.3.1 Die Anfänge: Robert Hertz und Hans Schärer
1.3.2 Ein wichtiges Forschungsinteresse: Seelenvorstellungen
1.3.3 Indonesische Literatur: Identitätspolitik
1.3.4 Mehrstimmige Forschungsgeschichte
1.4 Quellen und methodischer Zugang
1.4.2 Historisch-hermeneutischer Zugang: Diskursanalyse
1.4.3 Sozialempirische Vorgehensweisen: Feldforschung
1.4.4 Herausforderungen des Methodenmixes
1.5.1 Missionsgeschichtliche Perspektive: Dort-zentrische Kontakttheologie
1.5.2 Bildwissenschaftliche Perspektive: „Imagetext“ und visuelle Rhetorik
1.5.3 Ritualtheoretische Perspektive: Gelebte Religion
2 Ein in der Tradition verankertes Totenritual und protestantische Beerdigungspraktiken
2.1 Beerdigungsriten in Hindu Kaharingan
2.1.1 Der Tod und die primäre Bestattung Mangubur
2.1.2 Das Wegschieben der Toten: Balian Tantulak Ambun Rutas Matei
2.1.3 Tiwah←5 | 6→
2.2 Beerdigung in der Evangelischen Kirche Kalimantan
2.2.1 Andachten und Beisetzung
2.2.2 Stellungnahmen der Evangelischen Kirche Kalimantan
2.2.3 Grabrenovation und Umbettung der Toten
2.2.4 Beerdigungspraxis im Vergleich
2.3 Beerdigungsszenen in Bildern
2.3.2 Christliche Beerdigung und Pemugaran Kuburan in Bildern
3 Kontexte des Tiwah-Diskurses
3.2 Religiöses und sittliches Orientierungssystem
3.2.2 Traditionelles Religionssystem: Agama Helo und Hindu Kaharingan
3.3 Die Ngaju Dayak und ihre Beurteilung durch Missionare
3.4 Zwischenfazit: Diskursformationen im Abseits
4 Entstehung des Tiwah-Diskurses
4.3 Gereja Kalimantan Evangelis
4.4 Medien des Tiwah-Diskurses
4.5 Transkulturelle Verwendung von Bildern
4.5.1 Das Tiwah in Zeitschriften←6 | 7→
4.5.2 Das Tiwah in Lichtbilder-Vorträgen
5 Das Tiwah in der Perspektive von Missionaren
5.2.1 „Zeichen einer Gegenwelt des Christentums“: dualistisches Weltbild
5.2.2 „Andere Felder, andere Heuschrecken“: kulturalistisches Argument
5.2.3 Zwei mögliche Wege der „Volksmission“: Substitutionsmethode oder Anknüpfungspunkte
5.2.4 „Der Sinn der kultischen Totenbräuche“: verstehende Mission
5.2.5 „Lieber keine Christen als Tiwah-Christen“: pastoral-theologische Fragen
5.3 Zusammenfassung der Ergebenisse aus der Diskursanalyse
6 Zuordnung des Tiwah-Diskurses in die theologischen Strömungen der 1930er-Jahre
6.1 Die 1930er-Jahre als verschwiegene Zeit
6.2 Theologische Strömungen innerhalb der Basler Mission
6.2.1 Evangelische Religionskunde
6.2.3 Frühe dialektische Theologie
6.2.4 Religionsvergleichende Ansätze
6.3 Kontakttheologie: Verschiebungen im theologischen Denken
7.1 Methodische Impulse←7 | 8→
7.2 Relevanz der Topoi aus dem Tiwah-Diskurs
7.3 Dort-zentrische Kontakttheologie
8. Abbildungs- und Literaturverzeichnis
8.2.2 Berichte, Briefe und Drucksachen im Archiv der Basler Mission (BMA)
8.2.3 Berichte im Archiv der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG)
8.2.4 Berichte im Königlichen Institut für Sprache-, Land- und Völkerkunde (KITLV)
8.2.5 Bildnachweis erwähnter Bilder aus dem Archiv der Basler Mission
Liste Experten und Expertinnen
Personen-, Orts- und Sachindex ←8 | 9→
„Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung.“
Wo die Erde berührt wird, wird der Himmel hochgeachtet.
Seit meiner ersten Berührung mit Kalimantan vor fünfzehn Jahren, fühlte ich mich mit dieser fremden Welt verbunden und versuchte mich so zu verhalten, dass es den örtlichen Gepflogenheiten entsprach. Ich habe selber erfahren, mit wieviel Schwierigkeiten solche Fremdbegegnungen verbunden sind, was mir wiederum grosses Verständnis für die von mir untersuchte Fremdbegegnung zwischen Basler Mission und Ngaju Dayak einbrachte.
Diese Arbeit wäre nicht zu Stande gekommen ohne zahlreiche Gespräche mit sehr unterschiedlichen Menschen. Neben den Experten und Expertinnen, die im Anhang dieser Arbeit genauer vorgestellt werden, weiss ich mich einer ganzen Reihe weiterer Leute zu tiefem Dank verpflichtet. Es sind dies Forscher und Forscherinnen aus der Theologie, der Religionswissenschaft und der Ethnologie, aber auch Kolleginnen, Menschen, die mit der Basler Mission oder mit mir eng verbunden sind. Einige besonders wichtige Personen, werden hier mit Namen genannt, in der Hoffnung, dass dies meine Dankbarkeit sichtbar machen kann.
Andreas Heuser (Aussereuropäisches Christentum, Basel) begleitete und unterstützte nicht nur meine ersten Schritte bei dieser Arbeit, sondern spornte mich durch seine kritischen Fragen an, immer weiter zu forschen und diese Arbeit schliesslich zu einem Ende zu bringen. Reinhold Bernhardt (Systematische Theologie, Basel) unterstützte den Schreibprozess durch wichtige strukturelle Hinweise. Daria Pezzoli-Olgiati (Religionswissenschaft, München) schärfte meinen Blick besonders für Fragen ausserhalb der Theologie. Der Ethnologe, Bali-Kenner und Indonesienspezialist Urs Ramseyer stand mir während der ganzen Schreibzeit in vielfacher Hinsicht bei. Monika Glavac unterstützte mich auf der sprachlichen Ebene, mit Stefanie Reumer gestaltete sich ein fruchtbarer kollegialer Austausch, Claudia Wirthlin, Anke Schürer-Rihs, Paul Jenkins und Barbara Frey-Näf führten mich durch die Untiefen des Archivs der Basler Mission. Wolfgang Appelt ermöglichte mir einen Einblick in das Archiv der Rheinischen Mission, Richard Kunz begleitete mich durch die Sammlungen des Museums der Kulturen Basel. Marianne Dubach-Vischer und Thomas Haffner, als Nachfahren der von mir untersuchten Missionare, bestärkten mein Bestreben, eine Arbeit zu schreiben, die für ein breites Publikum lesenswert ist. Nicht zuletzt danke ich meiner Familie, meinen Eltern Andi und Bea Hoffmann, insbesondere meinem Mann Michael Oswald und meiner Tochter Johanna, die nicht nur mit längeren←9 | 10→ gedanklichen und physischen Abwesenheiten meinerseits leben mussten in den vergangenen fünf Jahren, sondern mich auch in die fremde Welt Kalimantan begleiteten, schulde ich Dank, den ich nicht in Worte fassen kann.
Details
- Seiten
- 378
- Erscheinungsjahr
- 2018
- ISBN (Hardcover)
- 9783631726853
- ISBN (PDF)
- 9783631733790
- ISBN (ePUB)
- 9783631733806
- ISBN (MOBI)
- 9783631733813
- DOI
- 10.3726/b11733
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (Dezember)
- Schlagworte
- Missionsgeschichte Indonesien Missionsfotografie Xenologie Archiv Beerdigung
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2018., 378 S., 18 farb. Abb., 20 s/w Abb., 6 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG