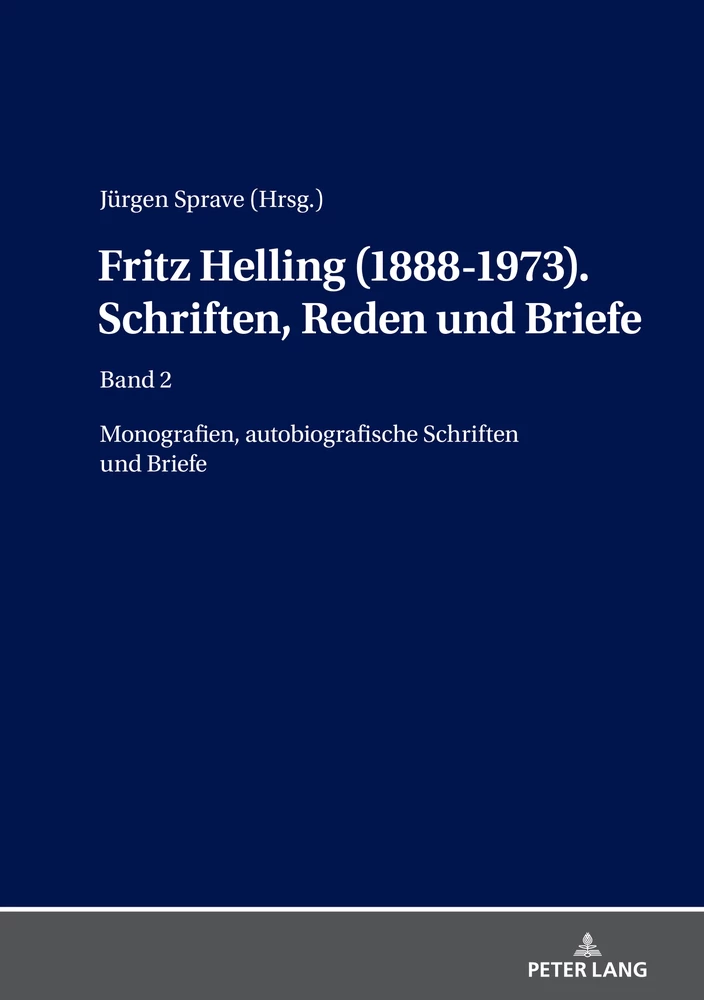Fritz Helling (1888-1973). Schriften, Reden und Briefe
Band 2: Monografien, autobiografische Schriften und Briefe
Summary
In drei Bänden werden die verstreut veröffentlichten Publikationen sowie die bisher nicht publizierten Schriften, Reden und Briefe Fritz Hellings historisch-kritisch aufgearbeitet und zusammengefasst. Seinen Texten werden Sekundärtexte gegenüber gestellt, die aufzeigen, in welchen Kontexten er gewirkt und sich geäußert hat und wie diese sein Werk bestimmt haben.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Band 2
- 2 Monografien
- 3 Autobiografische Schriften
- 4 Briefe
2 Monografien
←720 | 721→1. Einführung in die deutsche Literaturgeschichte
Heinrich Handels Verlag, Breslau 1928
Helling hat in seinen umfangreichen autobiografischen Schriften kein einziges Wort über diese Veröffentlichung verloren. Das verwundert eigentlich; denn ansonsten würdigt er in ihnen seine Leistungen durchaus selbstbewusst und keineswegs unbescheiden.
Es handelt sich im Folgenden um eine überarbeitete Abschrift des Originals. Das Inhaltsverzeichnis enthält im Original Seitenangaben, auf die in der Abschrift verzichtet wird, da sie im Rahmen dieser Werkausgabe keinen Sinn machen. Im Original zitierte Literaturtexte und deren Titel werden kursiv gedruckt, um sie hervorzuheben. Der allgemeine Drucktyp des Originals (siehe Faksimile) ist geändert, ebenso sind Sperrungen im Druck und fett gedruckte Ausdrücke überarbeitet. Unterschiedliche Darstellungsverfahren Fritz Hellings werden vereinheitlicht (z. B. die Angabe von Vornamen der erwähnten Schriftsteller, die mal erfolgt, mal nicht).
Diese Literaturgeschichte ist ganz offensichtlich für die Hand der Schüler gedacht; denn sie ist für den Literaturunterricht didaktisch aufbereitet; z. B. wird der Schüler immer wieder in direkter Ansprache (übrigens mit einem damals üblichen Du) angesprochen: er erhält Leseanregungen, ihm werden Lese- und Arbeitsaufträge erteilt, ihm wird ein Begriffsinventar als Lernstoff geboten und in einem umfangreichen Schlusskapitel erhält er mit anschaulichen Beispielen das wichtigste metrische Rüstzeug.
Vorwort
„Es ist kein hoher Berg so hoch,
so tief kein tiefes Tal:
Es dringt hinauf ein Vögelein,
hinab ein Sonnenstrahl.“
In die Höhe der Erkenntnis und des Glücks, in die Tiefe des Sinnens und des Leides dringt deutsche Dichtung. Sie weist auch wie das Janushaupt zurück in die Vergangenheit und vorahnend in die Zukunft. Die echte Poesie will aber auch Triebkräfte erwecken. Nur zu sehr wandelt moderne Technik die Anschauung in Mechanisierung. Die Welt darf nicht vor uns liegen wie eine kalte Maschinenhalle, in der elektrisches Licht den letzten Winkel entschleiert. Die Dichtung öffnet das Morgentor des Schönen, die Welt der Gedanken, das Sinnen der Seele. Das Volk der Dichter und Denker braucht den Sänger, den Bringer der Lust. In das bunte Leben der Poesie führt nur eigene Lektüre. Hierbei will die vorliegende Literaturkunde hilfreiche Hand bieten. In Zeiträumen erschließt sich der Wechsel der Zeit. Die deutsche Dichtung erhob sich immer wieder von einem Niedergang zu neuer Kraft. Gerade der Umstand, dass ein Zickzackkurs in der Entwicklung bestand, macht Deutschlands Poesie reizvoll; aber ein Verständnis ihrer Eigenart ist dadurch erschwert. Deshalb kann und muss eine Stütze gewährt werden. Aus der unendlichen Welt der Erscheinungen ist das Wesentliche gewählt. Dadurch wird die Übersicht ←721 | 722→erleichtert. Gebotene Inhaltsangaben dienen der Wiederholung; sie sollen nicht das Lesen und Sinnen ersparen, sondern zu wiederholter Versenkung anregen.
Auch von der Dichtung gilt das Wort: „Wo ihr’s packt, da ist es interessant.“ Die wertvollste innere Anteilnahme ist aber die Liebe zu Land und Volk. Deshalb sind auch die hierfür in Betracht kommenden Dichterwerke besonders gewürdigt worden. Die klassische Zeit, besonders bedeutsam durch das Wirken Goethes und Schillers, erfährt entsprechende Würdigung. Die Neutöner, die Poeten der Gegenwart, dürfen nicht vergessen werden. Sie heben aus gärender Zeit Stoffe, die durch Farbenfülle und Schilderung von Seelenkämpfen fesseln. Die Modernen sind in das Blickfeld gerückt. Möge auch ihnen Anerkennung nicht vorenthalten werden.
Hagen i. W., Ostern 1928
Fritz Helling
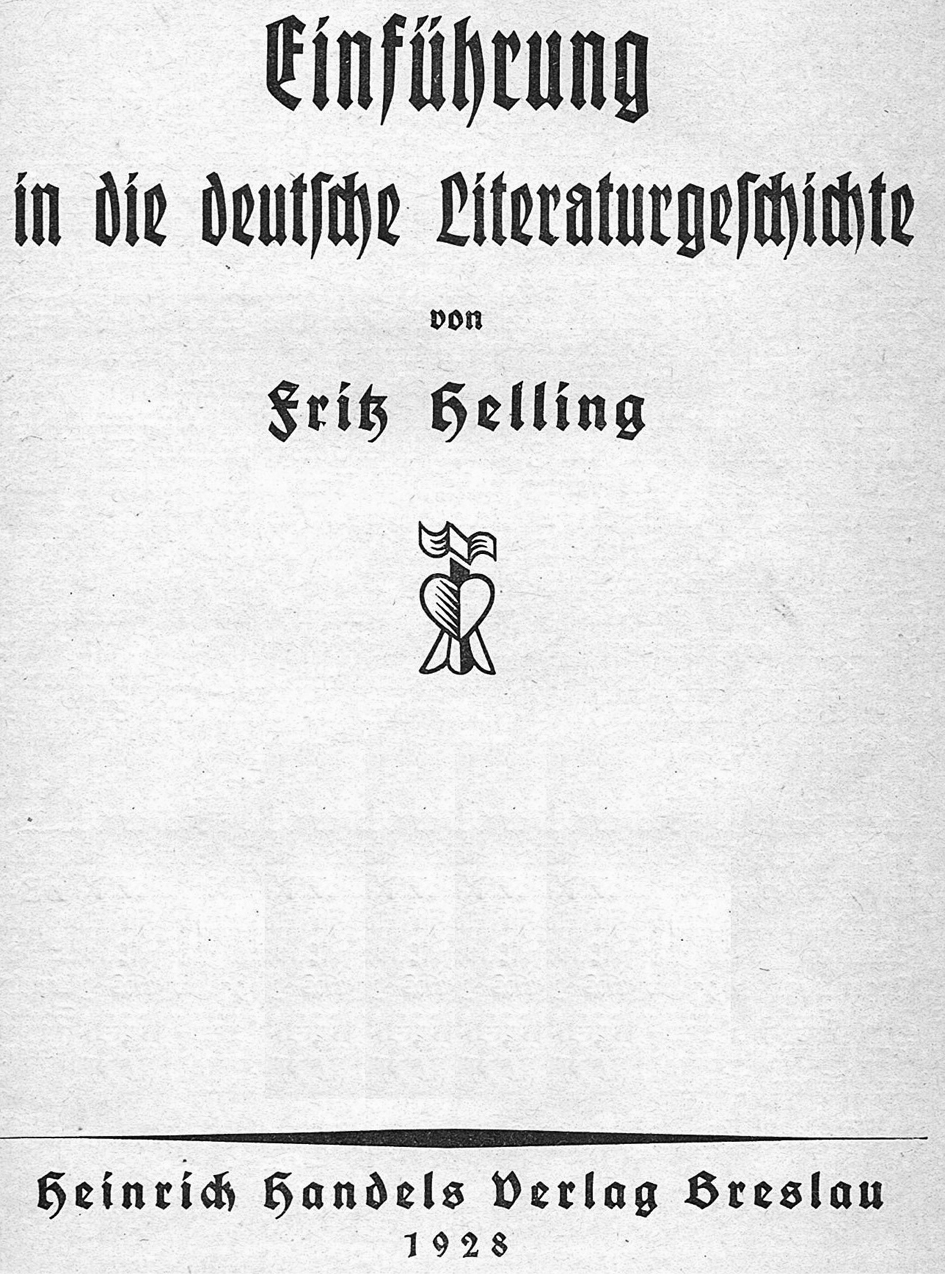
Abb. 9: Fritz Helling, Einführung in die deutsche Literaturgeschichte, 1928: Titelblatt
←722 | 723→Inhaltsangabe1
A: Entwicklung deutscher Dichtkunst bis zum Jahre 1100
Alte Zeit der deutschen Dichtung
B: Aufblühen deutscher Dichtung (1100 – 1300)
1. Das Volksepos (Nibelungen- und Gudrunlied)
2. Die höfische Dichtkunst
a. Das höfische Epos
Hartmann von der Aue: Der arme Heinrich
Wolfram von Eschenbach: Parzival
b. Das höfische Lied
Walther von der Vogelweide
C: Deutsche Dichtkunst, gefördert durch den Bürgerstand (1300 – 1600)
1. Das Volkslied
2. Die satirische Dichtung
Sebastian Brant
Die Volksbücher Till Eulenspiegel und Die Schildbürger
3. Der Meisterge sic! sang
Hans Sachs
4. Martin Luther
Humanismus
Thomas Murner
5. Das Kirchenlied
Martin Luther
Philipp Nicolai
Nicolaus Hermann
Nicolaus Decius
Paul Gerhardt
Paul Flemming
Georg Neumark
Johannes Franck
Luise Henriette
Details
- Pages
- VIII, 602
- Publication Year
- 2020
- ISBN (Hardcover)
- 9783631831007
- ISBN (PDF)
- 9783631834732
- ISBN (ePUB)
- 9783631834749
- ISBN (MOBI)
- 9783631834756
- DOI
- 10.3726/b17899
- Language
- German
- Publication date
- 2020 (December)
- Keywords
- Reformpädagogik Schulreform Neue Allgemeinbildung Sozialismus Schwelmer Kreis Schwelmer Schulreformplan Elastisierte Oberstufe Produktions-/Lebensschule Polytechnische Oberschule Schulmitwirkung
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2020. VIII, 602 S., 22 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG