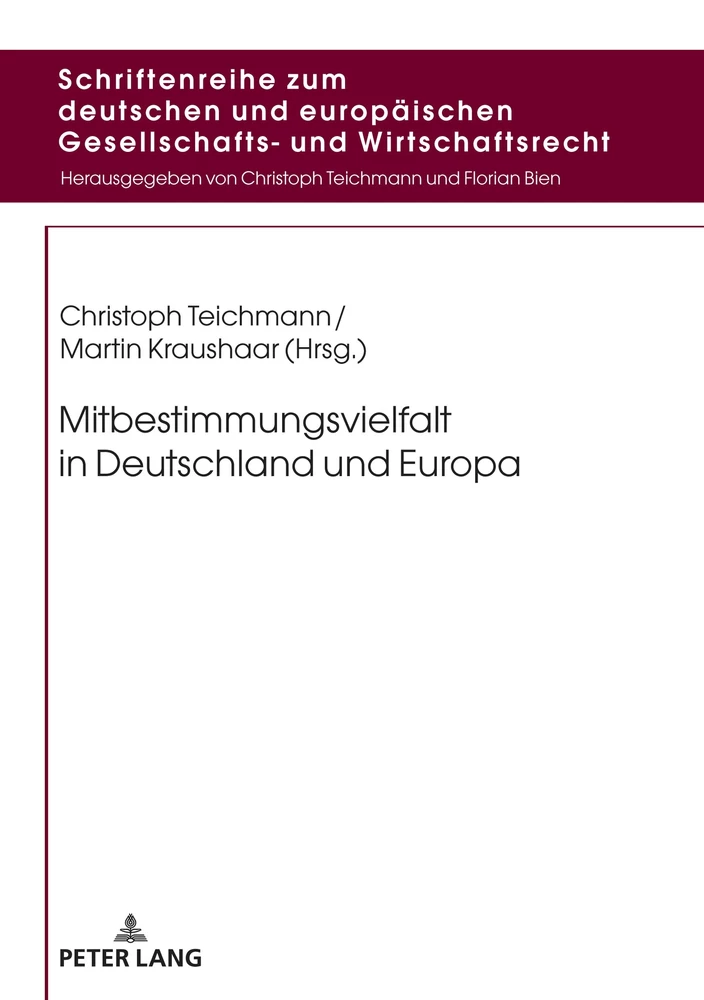Mitbestimmungsvielfalt in Deutschland und Europa
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort der Herausgeber
- Inhalt
- Mitbestimmungsvereinbarungen im Rechtsgespräch (Peter Hommelhoff)
- Mitbestimmungsverhandlungen aus der Sicht der Praxis (Thomas Müller-Bonanni)
- Mitbestimmung im monistischen Leitungssystem – Frankreich und Luxemburg als Beispiele – (Achim Seifert)
- Die Beteiligung der Arbeitnehmer in der geplanten Europäischen Privatgesellschaft (SPE) (Rüdiger Krause)
- Unionsrechtskonforme Mitbestimmungserstreckung auf EU-Auslandsgesellschaften (Christoph Teichmann)
- Vom Anfang und Ende der Mitbestimmungsverhandlung aus Sicht der Leitenden Angestellten (Martin Kraushaar)
- Empirische Mitbestimmungsforschung und Öffentlichkeit: Zur Differenz von sozialwissenschaftlichem und massenmedialem Diskurs über Arbeitsrecht (Kai Kühne und Dieter Sadowski)
Prof. Dr. Peter Hommelhoff, Universität Heidelberg
Mitbestimmungsvereinbarungen im Rechtsgespräch
Abstract: The author discusses how German co-determination should be liberalised by endorsing co-determination agreements. These agreements would allow for a more flexible coordination of business interests and should therefore be the object of both further academic discussion as well as legislative measures.
Als die Würzburger Fachtagung im Juli 2009 zum Thema „Verhandelte Mitbestimmung“ zusammentrat,1 war dies die erste Reaktion auf den Vorschlag des Arbeitskreises „Unternehmerische Mitbestimmung“,2 das deutsche Mitbestimmungsrecht für Mitbestimmungsvereinbarungen zu öffnen. In der Zwischenzeit hat es weitere Reaktionen gegeben,3 vor allem in der Konferenz ←9 | 10→„Auslaufmodell AG? Reform der unternehmerischen Mitbestimmung“,4 die in der Universität Frankfurt/Main im Oktober 2009 veranstaltet wurde. Parallel hierzu hat der Arbeitskreis „Aktien- und Kapitalmarktrecht“ (AAK) im November 2010 Vorschläge zu den Mitbestimmungsvereinbarungen in der deutschen SE, der Europäischen Aktiengesellschaft unterbreitet.5 Und schließlich hat auch die rechtspolitische Diskussion um die Europäische Privatgesellschaft (SPE) einiges zu den Mitbestimmungsvereinbarungen beigesteuert6– vor allem die Stellungnahme des deutschen Bundestages zur SUP-Richtlinie rechtspolitisch breit getragenen Aufforderung, einen neuen SPE-Vorschlag vorzulegen.7 Vor diesem Hintergrund scheint es reizvoll, das seit 2009 laufende Rechtsgespräch zu den Mitbestimmungsvereinbarungen nun auch in der Dokumentation der Würzburger Fachtagung fortzusetzen – zumal die Ziele, die der AK „Unternehmerische Mitbestimmung“ mit seinem Gesetzesvorschlag zur verhandelten Mitbestimmung ursprünglich verfolgt hatte, in der Zwischenzeit erheblich ausgeweitet und nach vorn verlagert worden sind.
A. Zur Legitimation von Mitbestimmungsvereinbarungen
Es geht nämlich nicht mehr allein darum, die (paritätisch mitbestimmte) AG deutschen Rechts im Wettbewerb der Rechtsformen gegenüber der SE zu stärken. Darüber hinaus stellt sich (schon seit geraumer Zeit und jetzt erst recht) die Aufgabe, die Unternehmen und Konzerne in Deutschland mitbestimmungsrechtlich gegenüber dem europäischen Binnenmarkt und global zu öffnen.
I. Der Einbezug ausländischer Arbeitnehmer
In europa- und weltweit aufgestellten Konzernen mit deutscher Mutter (wie BASF, Siemens oder VW) erodiert die Legitimation gleichberechtigter Entscheidungsteilhabe aller Arbeitnehmer, wenn diese allein von den Repräsentanten der Arbeitnehmer in Deutschland wahrgenommen wird.8 Dem Einbezug auch der ausländischen Arbeitnehmer wird man nicht ernsthaft ←10 | 11→entgegenhalten können, ausländische Belegschaften seien nicht legitimiert, das Mitbestimmungsrecht deutscher Kapitalgesellschaften abzuändern.9 Denn in mitbestimmten Unternehmen und Konzernen wurzelt die gleichberechtigte Teilhabe der Arbeitnehmer an bestimmten Entscheidungen bekanntlich in der Tatsache, dass die Arbeitnehmer von diesen Entscheidungen betroffen sind oder zumindest sein können – und zwar unabhängig davon, ob ihr Arbeitsplatz im In- oder Ausland liegt. Folglich müssen auch die ausländischen Arbeitnehmer an den Verhandlungen beteiligt werden, wenn Gegenstände anstehen, die sie betreffen oder betreffen können. Man denke nur an die Restrukturierung eines unionsweit aufgestellten Unternehmens oder Konzerns mit Arbeitsplatzabbau in mehreren EU-Mitgliedsstaaten. Mit der angeblich „fehlenden Legitimation ausländischer Arbeitnehmer“ sollte die rechtspolitische Diskussion in Deutschland nicht weiter belastet werden.10 – Schon diese Gelegenheit zur Entscheidungsteilhabe11 für ausländische Arbeitnehmer erfordert eine durchgreifende Reform des deutschen Mitbestimmungsrechts – und zwar des zur paritätischen Mitbestimmung (nach dem MitbestG 1976) ebenso wie des der Drittelbeteiligung. Dabei sollte der deutsche Gesetzgeber das schon unionsrechtsdogmatisch zweifelhafte Tui-Urteil des EuGH rechtspolitisch bereinigen.
II. Selbstgestaltetes Mitbestimmungsrecht
Aber damit nicht genug: Die Konstruktionsprinzipien und -elemente des deutschen Mitbestimmungsrechts, seit mehr als einem halben Jahrhundert starr und zwingend festgeschrieben und rechtspolitisch unverrückbar, werden den spezifischen Anforderungen nicht länger gerecht, die der globale Wettbewerb in all´ seiner Dynamik auch an die Organisation der Unternehmen und Konzerne stellt. Individualität und Flexibilität sind gefordert.12 Gerade weil dabei die gleichberechtigte Entscheidungsteilhabe aller Arbeitnehmer nicht unter die Räder geraten darf, sollte ein zu mitbestimmungsrechtlicher Gestaltung allenfalls marginal bereiter Gesetzgeber sich dazu durchringen, den Beteiligten in den Unternehmen und Konzernen (selbstverständlich einschließlich ihrer ←11 | 12→Arbeitnehmer) die Freiheit zu eröffnen, von den bislang zwingenden Regeln des geltenden Mitbestimmungsrechts in ausgehandelten Mitbestimmungsvereinbarungen abzuweichen; ja: sie sogar (innerhalb gewisser gesetzlich fixierter Grenzen) vollständig zu ersetzen. Oder anders formuliert: Die Modernisierung des überkommenen Mitbestimmungsrechts sollte der deutsche Gesetzgeber den Beteiligten in der Unternehmenspraxis überantworten.13 Damit würde er zugleich seinem jüngeren Anliegen gerecht, das deutsche Unternehmensrecht im Wettbewerb mit dem anderer EU-Mitgliedstaaten, aber auch mit dem der Union an rechtspolitisch markanter Stelle zu ertüchtigen.14
III. Anregungen an den europäischen Gesetzgeber
Auf der Ebene der Europäischen Union fungiert die Mitbestimmungsvereinbarung zwischen den am Unternehmen oder Konzern Beteiligten als Instrument, um die ganz unterschiedlichen Mitbestimmungskulturen in den EU-Mitgliedstaaten zum Ausgleich zu bringen.15 Trotz mancher Erfahrungen, die zu Mitbestimmungsverhandlungen und -vereinbarungen vor allem in Deutschland gesammelt worden sind,16 hat sich dies Instrument im SE-Recht noch nicht vollständig konsolidiert. Hierzu könnte ein modernes Recht der Mitbestimmungsvereinbarungen in Deutschland beispiel-gebend beitragen; auch ein solches Ziel nationaler Gesetzgebung ist legitim und könnte überdies für eine Europäische Privatgesellschaft dereinst noch erheblich an Bedeutung gewinnen.
Details
- Seiten
- 178
- Erscheinungsjahr
- 2021
- ISBN (Hardcover)
- 9783631681145
- ISBN (ePUB)
- 9783631706725
- ISBN (MOBI)
- 9783631706732
- ISBN (PDF)
- 9783653072556
- DOI
- 10.3726/b17886
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (November)
- Schlagworte
- Unternehmerische Mitbestimmung Mitbestimmungsverhandlungen Aufsichtsrat Verhandlungslösung Mitbestimmungserstreckung Arbeitnehmermitbestimmung
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. 178 S., 1 s/w Abb., 3 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG