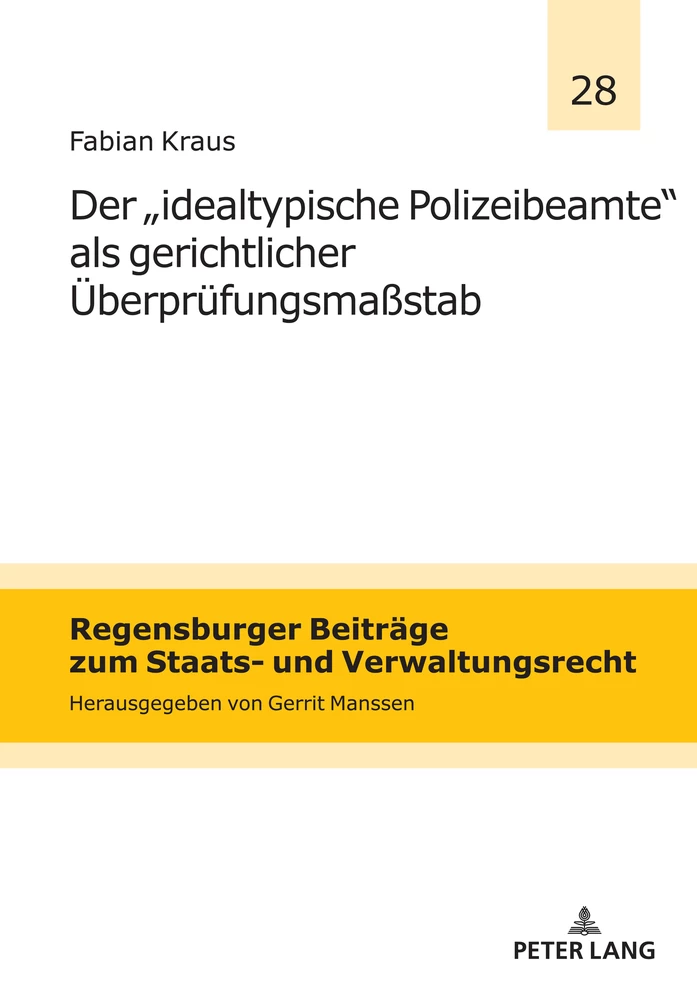Der `idealtypische Polizeibeamte´ als gerichtlicher Überprüfungsmaßstab
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Erster Teil – Der „idealtypische Beamte“ als Maßstab
- A. Grundzüge der Anknüpfungspunkte
- I. Die Gefahr im Sinne des Polizeirechts
- II. Der Gefahrverdacht
- III. Die Entscheidung über die Maßnahmerichtung
- 1. Zurechnung
- 2. Verdacht der Verantwortlichkeit
- B. Die Rechtsfigur des „idealtypischen Beamten“
- I. Vermeintliche Gefahr
- 1. Die Fallgruppe und ihre Bedeutung
- 2. Die Bezeichnung des Maßstabs
- 3. Zum Begriff „Anscheinsgefahr“
- 4. Abgrenzung zum Gefahrverdacht
- II. Vermeintlicher Gefahrverdacht
- III. Vermeintliche Verantwortlichkeit
- IV. Finanzielle Ebene
- C. Übertragbarkeit auf das Sicherheitsrecht
- D. Zusammenfassung
- Zweiter Teil – Die Eingrenzung der Relevanz des Maßstabs
- A. Die Maßstäbe bei der Überprüfung des polizeilichen Gefahrenurteils
- I. Grenzen gerichtlicher Kontrolle
- 1. Zur Möglichkeit eines Beurteilungsspielraums
- 2. Fachwissenschaftliche Erkenntnisgrenzen
- II. Verschiedene Anknüpfungspunkte
- III. Maßstäbe bei der Auswahl der zugrunde zu legenden Umstände
- 1. Arten der Erweiterung des Wissenshorizonts
- a) Die Dimensionen
- b) Neue Tatsachen oder neue Informationen
- aa) Grundlagen der Differenzierung
- bb) Neue Tatsachen und Informationen in den Dimensionen
- c) Die Begriffe ex ante und ex post
- d) Zwischenergebnis
- 2. Der Maßstab für die Berücksichtigung neuer Tatsachen
- a) Prozessualer Blickwinkel
- b) Der Zeitpunkt des zu bildenden Wahrscheinlichkeitsurteils
- c) Zur Notwendigkeit von Ausnahmen
- d) Zwischenergebnis
- 3. Der Maßstab bei der Berücksichtigung neuer Informationen
- a) Der idealtypische Beamte
- b) Der handelnde Beamte
- c) Der objektive Beobachter
- d) Stellungnahme
- aa) Überprüfbarkeit der Grundlagen als Mindestanforderung
- bb) Objektiver oder subjektiv-normativer Maßstab
- (1) Vergleichbare Gewährleistung der Effektivität
- (2) Besonderheiten des Polizei- und Sicherheitsrechts
- (3) Steuerungswirkung
- e) Zwischenergebnis
- 4. Ergebnis zu den Grundlagen des Wahrscheinlichkeitsurteils
- IV. Schlussfolgerung und hinreichende Schadenswahrscheinlichkeit
- 1. Der Maßstab zur Überprüfung der Schlussfolgerung
- a) Gegenstand der Überprüfung
- b) Der anzulegende Maßstab
- c) Ergebnis zur Überprüfung der Schlussfolgerungen
- d) Ergänzender Exkurs: Die fehlende Übereinstimmung der Grundlagen
- 2. Überprüfungsmaßstab bezüglich der „hinreichenden“ Schadenswahrscheinlichkeit
- a) Abwägung spezifischer Belange
- b) Die gerichtliche Überprüfung der Abwägung
- V. Zusammenfassung der Erkenntnisse zur gerichtlichen Überprüfung des polizeilichen Gefahrurteils
- B. Übertragbarkeit auf den Gefahrverdacht und die Störerbestimmung
- I. Maßstäbe zur Überprüfung der Entscheidung über den Gefahrverdacht
- 1. Inhalt der polizeilichen Entscheidung über den Gefahrverdacht
- 2. Die jeweiligen Maßstäbe
- II. Maßstäbe zur Überprüfung der Bestimmung des Maßnahmeadressaten
- 1. Inanspruchnahme des Störers
- 2. Inanspruchnahme des Störungsverdächtigen
- C. Zusammenfassung
- Dritter Teil – Zur Konkretisierung des Maßstabs
- A. Die Ermittlung des Sachverhalts
- I. Objektive Grenzen der Ermittlung
- II. Reichweite der idealtypischen Ermittlung
- 1. Ermittlungserfordernis bis zur objektiven Grenze der Ermittlungen
- 2. Ansätze zur Beschreibung idealtypischer Ermittlungen
- a) Ableitungen aus dem Disziplinarrecht
- b) Einzelne Konkretisierungen
- c) Zwischenergebnis
- 3. Vorschlag zur Beschreibung der idealtypischen Ermittlung
- a) Ermittlungsfehler
- b) Verwendbarkeit einzelner Ermittlungsfehler
- aa) Ermittlungsgebote und Verfahrensvorschriften
- bb) Zweifelhafte Verwendbarkeit
- cc) Angepasste Auflistung allgemeiner Ermittlungsfehler
- c) Qualitative Erweiterung der Ermittlungsfehler
- d) Zusammenfassung des Vorschlags
- 4. Systematische Möglichkeit und praktische Funktionalität
- III. Behördliche Konkretisierung
- 1. Selbststeuerungskonzepte und ihre Begründung
- 2. Konzept zur Beschreibung idealtypischer Ermittlungen
- IV. Zusammenfassung
- B. Die Ausstattung mit Erfahrungswissen
- I. Obergrenze der Anforderungen
- II. Untergrenze der Anforderungen
- III. Polizeiliche Diensterfahrung
- 1. Berechtigung der Einbeziehung
- 2. Variabilität der Diensterfahrung
- IV. Erfahrungsbezogene Selbststeuerungskonzepte
- V. Zusammenfassung
- Abschließende Betrachtung
- Ergebnisse in Thesen
- Literaturverzeichnis
Einführung
„Nach ersten Ermittlungen meldeten sich gestern gegen 17.45 Uhr mehrere Personen über den Notruf der Polizei und machten Angaben zu einer verdächtigen Person im Bereich der Willem-Van-Vloten Straße. Der Mann soll eine Schusswaffe haben und bereits mehrere Schüsse abgegeben haben.
Wenige Minuten später konnten Beamte die Person an der dortigen U-Bahn Haltestelle antreffen. Der junge Mann, ein 17-jähriger Dortmunder, hielt eine Schusswaffe in der Hand. Auch nach mehrfacher Aufforderung ließ er die Waffe nicht fallen.
Das Geschehen verlagerte sich dann in Richtung Emscherpromenade. Kurz vor der Einmündung Faßstraße hob er die Waffe und richtete sie auf die Polizisten. Daraufhin gaben die Polizeibeamten insgesamt drei Warnschüsse ab. Der junge Mann rannte darauf auf einen Parkplatz an der Bollwerkstraße und richtete ein weiteres Mal die Waffe auf die Beamten. Auf eine erneute Aufforderung, die Waffe hinzulegen, reagierte er nicht.
Ein Polizist gab daraufhin einen Schuss ab, der den Mann in den Arm traf.
Der Tatverdächtige ließ die Waffe fallen und fiel zu Boden. Die Polizisten legten ihm im Rahmen der Ersten Hilfe ein Tourniquet an. Der alarmierte Rettungswagen brachte den 17-jährigen Dortmunder in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.
Nach den bis jetzt durchgeführten Ermittlungen handelt es sich [um] eine PTB Waffe, in Art und Bauweise einer scharfen Schusswaffe ähnlich.“1
Es bestehen keine Zweifel, dass solche oder ähnliche Fallgestaltungen, in denen sich die Befürchtung bevorstehender Schäden durch Polizeibeamte als unbegründet erweist, in der polizeilichen Praxis immer wieder vorkommen. Ob die Beamten von einer scharfen Schusswaffe ausgingen oder die Möglichkeit der Ungefährlichkeit der Waffe in Betracht zogen, geht aus der Pressemitteilung zwar nicht eindeutig hervor. Jedoch legt der Einsatz der eigenen Schusswaffe nahe, dass sie sich einer echten und scharfen Waffe ausgesetzt sahen.
←15 | 16→Es überrascht nicht, wenn eine polizeiliche Lagebeurteilung von der Realität abweicht. Die Erkenntnismöglichkeiten der Beamten in der konkreten Einsatzsituation sind begrenzt, Annahmen und Entscheidungen müssen aber dennoch getroffen werden. Da unzutreffende Annahmen unmöglich vollständig vermieden werden können, muss ein sachgerechter Umgang mit ihnen etabliert werden. Entscheidend ist dabei, ob und inwiefern unzutreffende Annahmen doch „berechtigt“ sein können, sodass sie nicht zur Rechtswidrigkeit einer hierauf folgenden Maßnahme führen. Als Abgrenzungskriterium zwischen berechtigter und unberechtigter Annahme unzutreffender Umstände wird mitunter der2 – von Hoffmann-Riem in die rechtswissenschaftliche Diskussion eingeführte3 – fingierte idealtypische Beamte herangezogen.
Bereits die Bezeichnung macht neugierig. Sie ist zwar terminologisch eingängig, leidet aber an einer nicht unerheblichen Unbestimmtheit. Sie macht zwar deutlich, dass hier ein gewisses Ideal gemeint ist, gibt aber keinen Hinweis auf dessen genaues Verständnis. Es bleibt nicht nur offen, wie der Begriff inhaltlich zu verstehen ist, sondern auch, in welchem konkreten Zusammenhang ihm Bedeutung zukommt. Er kann sich auf das gesamte polizeiliche Vorgehen beziehen oder nur auf einzelne Aspekte hiervon. Um dem Begriff näher zu kommen, ist also die Betrachtung der gesamten Problematik und damit auch die Analyse der Anknüpfungs- und Bezugspunkte des besonderen Begriffs notwendig. Nur so lässt sich auch die Relevanz beziehungsweise Irrelevanz des besonderen Begriffs vollständig erarbeiten.
Es ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, das Kriterium des idealtypischen Beamten einzuordnen und näher zu bestimmen. Dabei soll vor allem zugunsten der Gerichte eine Entscheidungshilfe bei der Behandlung von im Nachhinein als unzutreffend erkannten Annahmen entstehen. Insofern muss insbesondere eine klare Abgrenzung des Kriteriums „idealtypischer Beamter“ von denjenigen ←16 | 17→Kriterien erfolgen, die ebenfalls im Zusammenhang mit der Beurteilung unzutreffender Annahmen stehen, sich aber auf andere Aspekte beziehen. Ebenso sind den Gerichten die Möglichkeiten für den Umgang mit den relevanten Kriterien aufzuzeigen. Weil sie letztlich über die Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit einer polizeilichen Maßnahme zu befinden haben, ist ihre präzise Anwendung der Maßstäbe von entscheidender Bedeutung. Dagegen versteht sich die Arbeit weniger als rechtlicher Ratgeber für die Polizei oder andere Sicherheitsbehörden. Bei der Untersuchung des idealtypischen Beamten geht es – auch wenn die Terminologie es nahelegen könnte – nicht um den Entwurf eines Profils, das Polizeibeamte wie ein Leitbild zu beachten hätten. Stattdessen geht es um die Aufarbeitung eines rechtlichen Begriffs.
Aus den dargestellten Fragestellungen und dem angestrebten Ziel ergeben sich folgende Arbeitsschritte. Im ersten Teil der Untersuchung erfolgt eine Bestandsaufnahme, bei welchen Rechtsbegriffen der idealtypische Beamte als Maßstab verwendet werden kann. Hierbei sind diese Rechtsbegriffe zu definieren, voneinander abzugrenzen und die Bedeutung des idealtypischen Beamten einzuordnen. Hier wird ersichtlich, dass der Begriff „idealtypischer Beamter“ allgemein zur Umschreibung eines Sorgfaltsmaßstabs verwendet wird, an dem polizeiliches Handeln in bestimmten Fallgruppen gemessen wird. Der zweite Teil widmet sich den Details der zuvor beschriebenen Rechtsbegriffe und Fallgruppen. Dabei werden die polizeilichen Entscheidungsabläufe hinsichtlich der Rechtsbegriffe eingehend beleuchtet, um herauszufinden, bei welchen Einzelschritten das Kriterium des idealtypischen Beamten den Sorgfaltsmaßstab beschreiben soll. Dabei wird sich zeigen, dass es insbesondere systematische Grenzen für seine Anwendbarkeit gibt und sich der Begriff deshalb nur für die Beschreibung der Anforderungen bei einem bestimmten Einzelschritt eignet. Die nähere Betrachtung der in diesem Schritt geltenden Anforderungen erfolgt im dritten Teil. Um sich den hier geltenden und mit dem Begriff des idealtypischen Beamten bezeichneten Anforderungen anzunähern, ist zunächst ein Rahmen herauszuarbeiten, wie weit die Anforderungen gehen müssen und können. Bei der Bestrebung, über einen bloßen Rahmen hinausgehende nähere Konkretisierungen zu erreichen, werden allerdings auch die Grenzen der rechtswissenschaftlichen Möglichkeiten deutlich. Deshalb sind alternative Konkretisierungsansätze zu untersuchen, bei denen solche Grenzen nicht bestehen.
←17 | 18→1 Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund, des Polizeipräsidiums Recklinghausen und der Polizei Dortmund, vom 06.09.2021: „Mann droht mit Waffe – Schussabgabe durch Polizisten“, abrufbar unter https://dortmund.polizei.nrw/presse/mann-droht-mit-waffe-schussabgabe-durch-polizisten; abgerufen am 22.12.2021.
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird auf eine geschlechterneutrale Schreibweise verzichtet. In dieser Arbeit sind alle Amtsträger, (Polizei-)Beamten, Richter, Störer, usw. ohne besondere Individualisierung aber selbstverständlich m/w/d.
3 Hoffmann-Riem, in: FS Wacke, S. 327 (339) beschreibt die dem fingierten Polizeibeamten zugeschriebenen Fähigkeiten als an einem idealtypisch zu messenden Durchschnitt ausgerichtet; dementsprechend spricht Dill, Amtsermittlung und Gefahrerforschungseingriffe, 1997, S. 59 vom idealtypischen Durchschnittsbeamten; ähnlich Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, 9. Aufl., S. 223; Hansen-Dix, Die Gefahr im Polizeirecht, im Ordnungsrecht und im Technischen Sicherheitsrecht, 1982, S. 60 beschränkt ihre Terminologie auf den idealtypischen Polizeibeamten.
Erster Teil – Der „idealtypische Beamte“ als Maßstab
Relevanz gewinnt der „idealtypische Beamte“ im Kontext von drei zentralen gefahrenabwehrrechtlichen Kategorien. Prominent ist er insbesondere im Rahmen der „Gefahr“. Er tritt aber auch beim „Gefahrverdacht“ und bei der Bestimmung des „Störers“ in Erscheinung. Die Grundzüge dieser Anknüpfungspunkte werden daher zunächst umrissen (hierzu A.). Davon ausgehend werden die besonderen Konstellationen beschrieben, in denen der Begriff des idealtypischen Polizeibeamten eine Rolle spielt (hierzu B.). Anschließend ist darzustellen, inwiefern die Ausführungen auf das allgemeine Sicherheitsrecht übertragbar sind (hierzu C.).
A. Grundzüge der Anknüpfungspunkte
Im Zentrum der Betrachtung stehen Gefahr, Gefahrverdacht und Störerbestimmung. Diese sollen einschließlich der notwendigen Abgrenzungen kurz umrissen und eingeordnet werden.
I. Die Gefahr im Sinne des Polizeirechts
Rechtshistorisch betrachtet hat der heute geltende polizeiliche Gefahrbegriff eine lange Entwicklung hinter sich.4 Vor allem auf das Preußische Oberverwaltungsgericht kann entscheidender Einfluss zurückgeführt werden, weil dessen Rechtsprechung den in § 10 Teil II Titel 17 des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten (ALR)5 verwendeten Gefahrbegriff näher konkretisierte.6 Neben der Klärung spezifischer Fragen bezogen auf das Verständnis des Gefahrbegriffs7 trennte das Gericht beispielsweise in seiner viel beachteten ←19 | 20→„Kreuzberg-Entscheidung“ – entsprechend dem bis heute gültigen Verständnis8 – allgemein das Recht der Gefahrenabwehr von der Wohlfahrtspflege.9
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Rechtsprechung in der Bundesrepublik10, unterstützt von der rechtswissenschaftlichen Literatur11, die Konturen des Gefahrbegriffs – auch im Rahmen anderer Sicherheitsgesetze – noch weiter geschärft.12 Im Jahr 1974 formulierte das Bundesverwaltungsgericht sogar eine Definition des Tatbestandsmerkmals der Gefahr, die es als allgemeine Meinung bezeichnete. Eine polizeirechtliche Gefahr sei gegeben, „wenn eine Sachlage oder ein Verhalten bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens mit Wahrscheinlichkeit ein polizeilich geschütztes Rechtsgut schädigen wird“13.
Hieran orientiert wurde eine Definition der Gefahr in verschiedene Landessicherheits- beziehungsweise Polizeigesetze aufgenommen.14 Mit Wirkung zum ←20 | 21→01.08.2021 wurde sie auch mit folgendem Wortlaut in Art. 11 Abs. 1 S. 2 des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes (BayPAG) aufgenommen:15 „Unter einer solchen konkreten Gefahr (Gefahr) [scil. i. S. d. Art. 11 Abs. 1 S. 1 BayPAG] ist eine Sachlage zu verstehen, die bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens im Einzelfall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer Verletzung von Schutzgütern der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung führt.“ Die Verletzung von Schutzgütern der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung16 ist – so auch im Folgenden – vereinfacht als „Schaden“ zu bezeichnen.17 Mit der gewählten Definition knüpft der bayerische Gesetzgeber ausdrücklich an jüngere verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zum Gefahrbegriff an.18 Auch mit der sonstigen Rechtsprechung und rechtswissenschaftlichen Literatur stimmt die genannte Definition im Wesentlichen überein.19
←21 | 22→Das zentrale Merkmal der Gefahrdefinition ist das der hinreichenden Schadenswahrscheinlichkeit.20 Häufig wird das Wahrscheinlichkeitsurteil in zwei Schritte aufgeteilt, die als (Sachverhalts-)Diagnose und (Schadens-)Prognose beschrieben werden.21 Am ersten Schritt der Sachverhaltsdiagnose ist nicht zu zweifeln, da ein Wahrscheinlichkeitsurteil ohne eine Grundlage in der Wirklichkeit nicht denkbar ist.22 Dass hierauf nur ein weiterer Schritt folgt, ist allerdings nicht ausreichend, zumal dessen Bezeichnung als Prognose wenig aussagekräftig ist. Er soll daher in zwei Bestandteile aufgeteilt werden.23 Zum einen muss anhand der diagnostizierten Grundlage der Schluss auf eine Wahrscheinlichkeit des Schadens erfolgen, was auch als Prognose im engeren Sinne bezeichnet werden kann (zweiter Schritt).24 Wie die Definition zeigt, genügt eine Schadenswahrscheinlichkeit allein jedoch nicht, sondern sie muss zudem – ebenfalls anhand der Grundlage – als hinreichend zu bewerten sein (dritter Schritt).25 Die ←22 | 23→gewählte Aufteilung in drei Schritte wird sich vor allem bei der Betrachtung der Maßstäbe für die gerichtliche Überprüfung als hilfreich erweisen.26
Details
- Pages
- 202
- Publication Year
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631888469
- ISBN (ePUB)
- 9783631888476
- ISBN (Hardcover)
- 9783631885376
- DOI
- 10.3726/b20127
- Language
- German
- Publication date
- 2022 (September)
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 202 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG