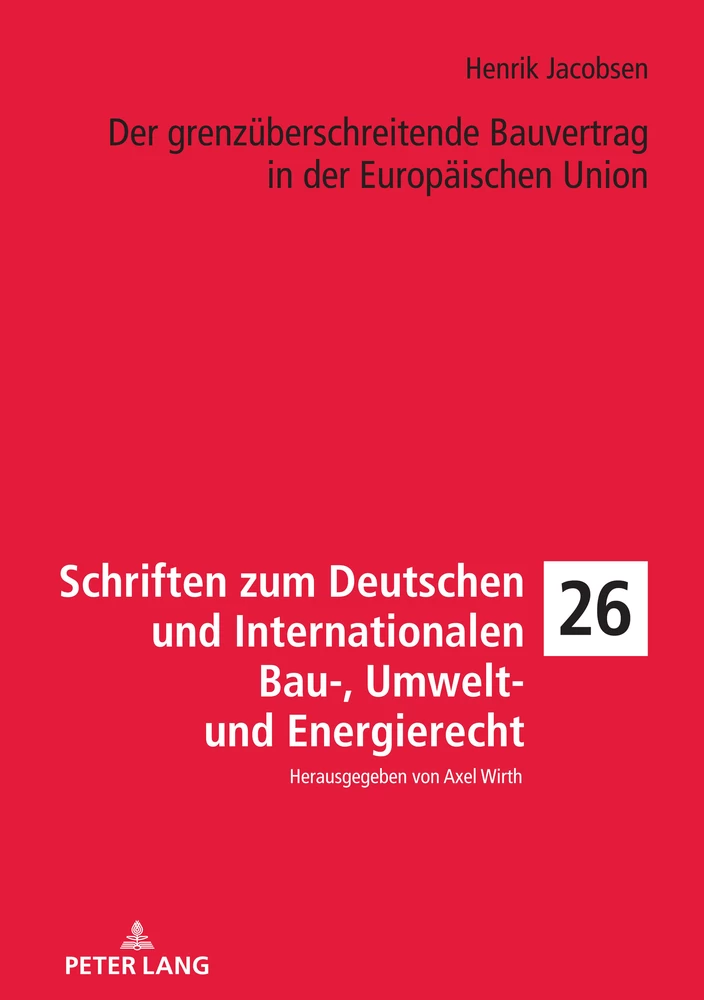Der grenzüberschreitende Bauvertrag in der Europäischen Union
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Danksagung
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- A. Problemaufriss
- I. Der Bauvertrag als Zentrum des Bauprojekts
- II. Wirtschaftliche Bedeutung des Bausektors
- III. Rechtsunsicherheit bei Grenzüberschreitung
- IV. Kein harmonisiertes Vertragsrecht in der EU
- V. Fazit
- B. Untersuchungsgegenstand und Thesen
- C. Gang der Untersuchung
- Kapitel 2: Rechtsquellen des privaten Baurechts in Europa
- A. Historische Einordnung
- I. Das Baurecht in der Antike
- II. Der Werkvertrag in der Neuzeit
- 1. Bayerisches Landrecht
- 2. Preußisches Landrecht
- 3. Code civil
- 4. Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch
- III. Fazit
- B. Modernes Bauvertragsrecht in Europa
- I. Deutsches Recht
- 1. Neues Bauvertragsrecht
- 2. VOB/B
- 3. Rechtsprechung des BGH
- II. Privates Baurecht in anderen europäischen Ländern
- 1. Vereinigtes Königreich und Irland
- a) Das Common Law
- b) Struktur des privaten Baurechts
- c) Vertragsschluss
- d) Werkleistung des Contractor
- e) Haftung für Mängel
- f) Pflichten des Employer
- 2. Frankreich
- a) Rechtsmaterie des privaten Baurechts
- b) Pflichten der Parteien
- c) Mängelgewährleistung und Verjährung
- d) Gesetzliche Sondervorschriften
- e) Vertragsmuster und Zusatzerklärungen
- 3. Polen
- C. Internationales Recht
- D. Recht der Europäischen Union
- I. Dienstleistungsfreiheit im Binnenmarkt
- II. ROM-Verordnungen
- III. Dienstleistungsrichtlinie
- IV. Rechtsprechung des EuGH
- V. Bedeutung der europäischen Rechtsquellen
- VI. Technische Bestimmungen
- 1. Öffentlich-rechtliche Vorschriften
- 2. Technische Normen privater Verbände
- 3. Europäische Einflüsse
- 4. Harmonisierungswirkung auf das materielle Recht?
- VII. Fazit
- E. Bestrebungen zur Harmonisierung des Zivilrechts
- I. Bestandsaufnahme
- II. Erste Initiativen
- III. Draft Common Frame of Reference
- IV. Optionen für ein europäisches Vertragsrecht
- V. Entwurf für ein europäisches Kaufrecht
- F. Zusammenfassung des Kapitels
- Kapitel 3: Merkmale des grenzüberschreitenden Bauvertrags
- A. Terminologie
- I. Der „Bauvertrag“ im deutschen Recht
- 1. Stand vor Einführung des Bauvertragsrechts
- 2. „Bauleistung“ und „Bauauftrag“
- 3. Neue Legaldefinition in § 650a BGB
- II. Der „construction contract“ im englischen Recht
- III. Der „contrat de louage d’ouvrage“ im französischen Recht
- IV. Zwischenergebnis
- V. Begriff der „Grenzüberschreitung“
- VI. Fazit
- B. Konfrontation mit einem fremden Recht
- I. Das europäische Kollisionsrecht nach Rom I-VO
- 1. Kein vorrangiges Sachrecht
- 2. Zweck der Rom I-VO
- II. Vertragsstatut bei fehlender Rechtswahl
- 1. Anknüpfung beim B2B-Bauvertrag
- a) Gewöhnlicher Aufenthalt des Dienstleisters
- b) Kritik von Hök
- c) Stellungnahme
- d) Zwischenfazit
- 2. Anknüpfung beim B2C-Bauvertrag
- 3. Besondere Vertragstypen
- a) Konsortium und ARGE
- b) Anknüpfung von Planungsleistungen
- c) Anknüpfung des Nachunternehmervertrags
- d) Anknüpfung des Bauträgervertrags
- 4. Anknüpfung bei nichtvertraglichen Ansprüche
- III. Rechtswahl
- 1. Wirksamkeitsvoraussetzungen
- 2. Konfliktfelder
- a) Beschränkte Handlungsoptionen
- b) Einseitiges Durchsetzen der Rechtswahl
- c) Wahl eines „neutralen“ Rechts
- d) Fehlende Beratung zur Rechtswahl
- 3. Keine Rechtswahl über zwingende Vorschriften
- a) Rechtliche Grundlage
- b) Zwingendes Recht der lex fori
- c) Zwingendes Recht am Erfüllungsort
- 4. Rechtswahl beim Nachunternehmereinsatz
- IV. Alternative: Teilrechtswahl
- V. Wahl nichtstaatlichen Rechts
- 1. Kein wählbarer Handelsbrauch in der Baubranche
- a) Handelsbräuche und lex mercatoria
- b) Meinungsstand
- c) Stellungnahme
- 2. Wählbarkeit internationaler Regelwerke
- 3. Rechtsfolgen der unzulässigen Rechtswahl
- VI. Kollidierende Rechtswahlklauseln
- VII. Fazit
- C. Besondere Bedeutung der Vertragsauslegung
- I. Bedeutung der Auslegung im Allgemeinen
- II. Kollisionsrechtlicher Maßstab für die Auslegung
- III. Vertragsauslegung im europäischen Vergleich
- 1. Deutsches Recht
- 2. Französisches Recht
- 3. Englisches Recht
- a) Bedeutung des Wortlauts
- b) Eingeschränkte Auslegung durch Gerichte
- c) Auslegungsmethodik
- d) Umgang mit Vertragslücken
- e) Rangfolge bei Widersprüchen
- 4. Zwischenfazit
- D. Bedeutung der Vertragssprache
- I. Sprache und Recht
- II. Hemmnis für den Vertragsschluss
- III. Wahl der „richtigen“ Vertragssprache
- 1. Gemeinsame Sprache der Vertragsparteien
- 2. Englisch als Weltsprache
- 3. Projektbezogene Sprachwahl
- 4. Sprache des gewählten Rechts
- 5. Mehrere Vertragssprachen
- IV. Fazit
- E. Zusammenfassung des Kapitels
- Kapitel 4: Verwendung von Bauvertragsmustern
- A. Bedeutung und Verbreitung
- B. Einzelne Vertragsmuster der Verbände
- I. VOB/B
- 1. Marktstellung
- 2. Vertragsgestaltung mit der VOB/B
- a) Grundprinzipien
- b) Vertragspflichten und Auslegung
- c) Internationale Verwendbarkeit
- d) Risikoverteilung und Risikosteuerung
- e) Individuelle Gestaltbarkeit
- 3. Fazit
- II. FIDIC
- 1. Überblick
- 2. Vertragsgestaltung mit FIDIC-Verträgen
- a) Die FIDIC-Bücher
- b) Grundprinzipien und Struktur
- c) Vertragspflichten
- aa) Pflichten des Contractor
- bb) Pflichten des Employer
- cc) Sonderstellung des Engineer
- d) Internationale Verwendbarkeit
- e) Risikoverteilung
- f) Individuelle Gestaltbarkeit
- 3. Fazit
- III. JCT
- 1. Überblick
- 2. Vertragsgestaltung mit JCT
- a) Die JCT-Vertragsfamilie
- b) Grundprinzipien und Struktur
- c) Vertragsinhalt
- d) Internationale Verwendbarkeit
- e) Risikoverteilung und individuelle Gestaltbarkeit
- 3. Fazit
- IV. AFNOR NF P03-001
- V. Fazit
- C. Vorteile
- D. Praktische Nachteile und Zweifel an Legitimation
- I. Praktische Nachteile
- 1. Umfang und Komplexität
- 2. Bedarf an Eingriffen in das Vertragsmuster
- 3. Fazit
- II. Konflikte mit dem Vertragsstatut
- 1. Ausrichtung auf ein Recht und eine Sprache
- 2. Unterschiedliche Auslegung
- 3. Zwingendes Recht
- 4. Fazit
- III. Vertragliche Koordination beteiligter Unternehmen
- 1. Nachunternehmereinsatz
- 2. Arbeitsteilige Bauausführung
- 3. Fazit
- IV. Legitimität von privaten Vertragsmustern
- 1. Ursprung in nichtstaatlicher Sphäre
- 2. Kritikpunkte
- a) Demokratiedefizit
- aa) Keine Rechtssetzungspflicht nach GG
- bb) Privatautonome Verwendungsentscheidung
- cc) Fehlende staatliche Legitimität
- dd) Ende der staatlichen Gesetzgebung?
- ee) Kritik an privater Rechtssetzung
- b) Entzug judikativer Kontrolle
- aa) Funktion und Zweck richterlicher Kontrolle
- bb) Privilegierung und zurückhaltende Rechtsanwendung
- cc) Umgehung durch nichtstaatliche Gerichtsbarkeit
- c) Keine Berücksichtigung ausländischer Interessen
- 3. Stellungnahme
- E. Zusammenfassung des Kapitels
- Kapitel 5: Individuelle Vertragsgestaltung
- A. Einführung
- B. Ablauf eines Bauprojekts
- I. Festlegung von Projektzielen
- II. Projektphasen aus bautechnischer Sicht
- 1. Planungsphase
- 2. Ausführungsphase
- 3. Gewährleistungsphase
- III. Einteilung nach dem Bauvertragsmanagement
- IV. Zeitliche Einordnung der Vertragsgestaltung
- C. Gestaltung des Vertragsdokuments
- I. Vertragsgestaltung als Akt der Privatautonomie
- II. Regeln für die Abfassung des Vertragstexts
- III. Aufbau und Inhalt des Vertragsdokuments
- IV. Einseitige Vertragsbedingungen
- 1. AGB im deutschen Recht
- 2. Standard Terms im englischen Recht
- 3. Conditions générales im französischen Recht
- 4. Weitere europäische Rechtsordnungen
- 5. Kollision der Klauselwerke
- V. Formbedürftigkeit
- 1. Deutsches Recht
- 2. Englisches Recht
- 3. Französisches Recht
- VI. Fazit
- D. Festlegung der Projektstruktur
- I. Zuweisung der Planungsverantwortung
- 1. Bedeutung
- 2. Eigenplanung des Auftraggebers
- 3. Planung durch den Auftragnehmer
- 4. Planungsverantwortung bei Grenzüberschreitung
- II. Wahl der Unternehmereinsatzform
- 1. Leistungsexport
- 2. Tochter- und Beteiligungsgesellschaften
- 3. ARGE und Partnerships
- 4. BOT und PPP
- III. Fazit
- E. Risikobewertung und Risikosteuerung
- I. Notwendigkeit einer Risikosteuerung
- II. Begriff des Risikos
- 1. Definition
- 2. Stellungnahme
- III. Risikokategorien
- 1. Klassifizierung nach Mallmann
- 2. Klassifizierung nach Sundermeier
- 3. Klassifizierung nach Bunni
- 4. Stellungnahme
- IV. Gesetzliche Risikozuweisung
- 1. Deutsches Recht
- 2. Common Law
- V. Vertragliches Risikomanagement
- 1. Bedeutung
- 2. Methodik
- 3. Risikoanalyse
- a) Risiken erkennen und begreifen
- b) Risiken bewerten und gewichten
- 4. Risikosteuerung
- a) Grundsätze der Risikozuweisung
- b) Steuerung über Wahl des Vertragsmodells
- aa) Klassischer Austauschvertrag
- bb) Neoklassischer Vertrag
- cc) Partnerschaftliche Vertragsmodelle
- (1) Merkmale
- (2) GMP-Vertrag
- (3) Alliancing und Partnering
- dd) Stellungnahme
- c) Steurung über das Vergütungsmodell
- aa) Das Einheitspreismodell
- bb) Das Pauschalpreismodell
- (1) Detailpauschalvertrag
- (2) Globalpauschalvertrag
- (3) Sonderfall: GMP-Vergütung
- cc) Stellungnahme
- d) Steuerung über einzelne Vertragsklauseln
- aa) Stellenwert
- bb) Klauselgestaltung in der Praxis
- (1) Risikovermeidung
- (2) Risikominimierung
- (3) Vertraglicher Risikoausgleich
- (4) Absicherung gegen Risikorealisierung
- VI. Fazit
- F. Checkliste für die individuelle Gestaltung
- G. Zusammenfassung des Kapitels
- Kapitel 6: Vertragsgestaltung mit Modellregeln des DCFR
- A. Einführung
- I. Zielsetzung des DCFR
- II. Struktur und Aufbau
- 1. Model Rules, Principles und Definitions
- 2. Die Bücher des DCFR
- III. Rechtsnatur und praktische Bedeutung
- 1. Kein Rechtsakt nach Art. 288 AEUV
- 2. Entwicklungspotenzial
- 3. Stellungnahme
- IV. Eignung für die Vertragsgestaltung
- V. Fazit
- B. Die ersten drei Bücher des DCFR im Überblick
- I. Erstes Buch: General Provisions
- II. Zweites Buch: Contracts and other judicial acts
- 1. Inhalt und Auslegung des DCFR-Vertrags
- 2. Verwendung vorformulierter Bedingungen
- III. Drittes Buch: Obligations and corrresponding rights
- IV. Fazit
- C. Der Servicevertrag
- I. Hauptpflichten und Abgrenzung
- II. Eingeschränkte Erfolgsverpflichtung
- III. Warnpflichten des Unternehmers
- IV. Fazit
- D. Der Constructionvertrag
- I. Systematische Stellung
- II. Konzeption und Abgrenzung
- 1. Bezeichnung der Vertragsparteien
- 2. Legaldefinition
- 3. Anwendungsbereich
- 4. Abgrenzung zu anderen Vertragstypen
- a) Designvertrag
- b) Processingvertrag
- 5. Zuweisung der Planungsverantwortung
- a) Grundsatz: Planung durch Auftraggeber
- b) Ausnahme: Planung durch Auftragnehmer
- III. Vertragliche Pflichten der Parteien
- 1. Pflichten des Unternehmers
- 2. Pflichten des Bestellers
- IV. Weitere Pflichten der Parteien
- 1. Kooperationspflicht des Bestellers
- 2. Schutzpflichten des Unternehmers
- V. Die Übergabe des Werks
- 1. Rechtlicher Inhalt
- 2. Rechtsfolgen
- a) Gefahrübergang
- b) Fälligkeit des Werklohns
- 3. Teilabnahme des Werks
- VI. Mängel und Schlechtleistung
- 1. Das geschuldete Leistungssoll
- 2. Der Begriff der Conformity
- 3. Die Enthaftung des Unternehmers
- 4. Gewährleistungsansprüche des Bestellers
- 5. Keine Regeln zur Verjährung von Mängelansprüchen
- VII. Leistungsbestimmungs- und Anordnungsrechte
- VIII. Die Kündigung des Constructionvertrags
- E. Eignung der Modellregeln für die Vertragsgestaltung
- F. Zusammenfassung des Kapitels
- Kapitel 7: Der Weg zu einem EU-Bauvertragsrecht
- A. Die Idee eines harmonisierten Vertragsrechts
- I. Bedarf an Harmonisierung in der Krise
- II. Handlungsbedarf
- III. Störung des Wettbewerbs der Rechtsordnungen
- IV. Lösungsansätze
- B. Passive Harmonisierung über das Primärrecht
- I. Das Binnenmarktgebot des Art. 26 AEUV
- II. Stellungnahme
- C. Aktive Harmonisierung über das Sekundärrecht
- I. Materiell-rechtliche Zielsetzung
- 1. Europäische Zivilrechtskodifikation
- 2. Europäisches Bauvertragsrecht
- 3. Stellungnahme
- II. Modus der Harmonisierung
- 1. Indirekte Harmonisierung
- a) EU-Bauvertragsmuster
- b) Restatements und wissenschaftliche Entwürfe
- c) Richtlinien
- 2. Direkte Harmonisierung
- 3. Stellungnahme
- III. Verhältnis zum nationalen Recht
- 1. Verdrängendes Einheitsrecht
- 2. Sonderrecht für grenzüberschreitende Sachverhalte
- 3. Optionales Vertragsrecht bei Grenzüberschreitung
- 4. Stellungnahme
- IV. Fazit
- D. Erlass eines EU-Bauvertragsrechts de lege lata
- I. Entwurf für ein Europäisches Kaufrecht
- 1. Begründung und Inhalt
- 2. Funktionsweise und Verhältnis zum IPR
- 3. Anwendungsbereich
- 4. Rezeption
- 5. Bewertung und Stellungnahme
- II. Mögliche Kompetenznormen
- 1. Notwendigkeit einer Kompetenznorm
- 2. Mögliche Kompetenznormen de lege lata
- a) Art. 81 AEUV
- b) Art. 169 AEUV
- c) Art. 114 AEUV
- aa) Subsidiäre Anwendung
- bb) Gesetzgebungsverfahren
- cc) Binnenmarktbezogener Zweck
- (1) Maßstab
- (2) Beurteilungsspielraum
- (3) Begründung beim GEK
- (4) Begründung für ein EU-Bauvertragsrecht
- dd) Angleichung der Rechtsvorschriften
- (1) Anknüpfung: Recht der Mitgliedstaaten
- (2) Problematik der Teilangleichung
- (3) Problematik des optionalen Rechts
- (4) Stellungnahme
- ee) Erforderlichkeit der Rechtsangleichung
- (1) Begründung beim GEK
- (2) Begründung für ein EU-Bauvertragsrecht
- ff) Subsidiaritätsprinzip
- (1) Begründung beim GEK
- (2) Stellungnahme
- (3) Begründung für ein EU-Bauvertragsrecht
- gg) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
- (1) Begründung beim GEK
- (2) Begründung für ein EU-Bauvertragsrecht
- hh) Zwischenergebnis und Stellungnahme
- d) Art. 352 AEUV
- aa) Funktion und Inhalt
- bb) Eignung
- cc) Politische Umsetzbarkeit
- dd) Stellungnahme
- e) Art. 20 EUV i.V.m. Artt. 326 ff. AEUV
- 3. Rechtsgrundlage für eine neue Kompetenznorm
- 4. Ergebnis
- E. Materieller Gehalt eines EU-Bauvertragsrechts
- I. Rechtliche Grundlagen
- 1. Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten
- 2. Private Bauvertragsmuster
- 3. Wissenschaftliche Vorarbeiten
- II. Offene Fragen
- 1. Sprachliche und kulturelle Unterschiede
- 2. Verhältnis zum IPR
- 3. Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
- III. Stellungnahme
- F. Im Überblick: Möglichkeiten der aktiven Harmonisierung
- G. Zusammenfassung des Kapitels
- Ergebnis zu den Thesen und Fazit
- Literaturverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a. A. |
andere Ansicht |
a. a. O. |
am angegebenen Ort |
ABGB |
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch |
Abl. |
Amtsblatt |
Abs. |
Absatz |
AEUV |
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
a. F. |
alte Fassung |
AGB |
Allgemeine Geschäftsbedingungen |
ALR |
Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten |
AnwBl |
Anwaltsblatt |
ARGE |
Arbeitsgemeinschaft |
Art./Artt. |
Artikel |
B2B |
Business-to-Business |
B2C |
Business-to-Consumer |
BauO NRW |
Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen |
BayBO |
Bayerische Bauordnung |
BayVerfGH |
Bayerischer Verfassungsgerichtshof |
BauR |
baurecht: Zeitschrift für das gesamte öffentliche und zivile Baurecht |
BB |
Betriebsberater (Zeitschrift) |
BeckOK |
Beck’scher Online-Kommentar |
BeckOGK |
beck-online.GROSSKOMMENTAR |
Begr. |
Begründer |
BGB |
Bügerliches Gesetzbuch |
BGBl. |
Bundesgesetzblatt |
BGH |
Bundesgerichtshof |
BGHZ |
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen |
BLR |
Building Law Report |
BR-Drs. |
Bundesratdrucksache |
BT-Drs. |
Bundestagdrucksache |
BVerfG |
Bundesverfassungsgericht |
BVerfGE |
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts |
BVerwG |
Bundesverwaltungsgericht |
C. Civ. |
Code civil |
CDU |
|
CEN |
Comité Européen de Normalisation |
CESL |
Common European Sales Law |
CFR |
Common Frame of References |
Ch App |
Chancery Appeals |
CISG |
Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises |
cl. |
clause |
CLJ |
Construction Law Journal |
CMBC |
Codex Maximilianus Bavarius Civilis |
CR |
Computer und Recht (Zeitschrift) |
CSU |
Christlich-Soziale Union in Bayern |
DAI |
Deutsches Anwaltsinstitut e.V. |
DCFR |
Draft Common Frame of Reference |
Ders./Dies. |
Derselbe/Dieselbe/Dieselben |
DIN |
Deutsches Institut für Normung |
Diss. |
Dissertation |
DNotZ |
Deutsche Notar-Zeitschrift |
EG |
Europäische Gemeinschaft |
EL |
Ergänzungslieferung |
endg. |
endgültig |
et. al. |
et alii/et aliae |
EGBGB |
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch |
EN |
Europäische Norm |
ERCL |
European Review of Contract Law |
EU |
Europäische Union |
EuCML |
Journal of European Consumer and Market Law |
EuGH |
Europäischer Gerichtshof |
EuR |
Zeitschrift Europarecht |
EUV |
Vertrag über die Europäische Union |
euvr |
Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht |
EuZW |
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht |
e. V. |
eingetragener Verein |
EVÜ |
Übereinkommen von Rom über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht |
EWHC |
High Court of England and Wales |
EWS |
Europäisches Wirtschaft und Steuerrecht (Zeitschrift) |
f./ff. |
folgende |
FDP |
|
FIDIC |
Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils |
FS |
Festschrift |
Fn |
Fußnote |
GOA |
Gebührenordnung für Architekten |
GbR |
Gesellschaft bürgerlichen Rechts |
GEK |
Gemeinsame Europäische Kaufrecht |
GMP |
Garantierter Maximalpreis |
GOI |
Gebührenordnung der Ingenieure |
GWB |
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen |
HBC |
Hudson’s Building Contracts |
HBO |
Hessische Bauordnung |
Hdb. |
Handbuch |
HGCRA |
Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996 |
HOAI |
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure |
Hrsg. |
Herausgeber |
Hs. |
Halbsatz |
IBR/IBRRS |
Immobilien und Baurecht (Zeitschrift) |
ICE |
Institution of Civil Engineers |
ICLR |
International and Comparative Law Review |
IHR |
Internationales Handelsrecht (Zeitschrift) |
IntVG |
Gesetz über die Wahrnehmung der Integrationsverantwortung des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union |
IPR |
Internationales Privatrecht |
IPRax |
Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts |
i. V. m. |
in Verbindung mit |
JCT |
Joint Contracts Tribunal |
JuS |
Juristische Schulung (Zeitschrift) |
JZ |
JuristenZeitung (Zeitschrift) |
Kap. |
Kapitel |
KOM |
Dokumente der Kommission (EG/EU) |
L |
Rechtsvorschriften der Europäischen Union |
LBO BW |
Landesbauordnung Baden-Württemberg |
LBO SH |
Landesbauordnung Schleswig-Holstein |
lit. |
littera |
LR |
Law Report |
Ltd. |
Limited |
MaBV |
Makler- und Bauträgerverordnung |
Mio. |
|
MittBayNot |
Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern |
m. w. N. |
mit weiteren Nachweisen |
Mot. |
Motive zum BGB |
Mrd. |
Milliarden |
NEC |
New Engineering Contract |
n. F. |
neue Fassung |
NJW |
Neue Juristische Wochenschrift |
NJW-RR |
Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report |
NVwZ |
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht |
NZBau |
Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht |
OGH |
Oberster Gerichtshof |
OLG |
Oberlandesgericht |
OR |
Obligationenrecht im schweizerischen Zivilgesetzbuch |
pZGB |
polnisches Zivilgesetzbuch |
Rdnr. |
Randnummer |
Reg-E |
Regierungsentwurf |
RGBl. |
Reichsgesetzblatt |
RGZ |
Entscheidungssammlung des Reichsgerichts in Zivilsachen |
RiLi |
Richtlinie |
RIW |
Recht der Internationalen Wirtschaft (Zeitschrift) |
Rom I-VO |
Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) |
Rom II-VO |
Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“) |
Rs. |
Rechtssache vor dem EuGH |
s. |
siehe |
S. |
Seite |
SächsBO |
Sächsische Bauordnung |
SächsBGB |
Bürgerliche Gesetzbuch für das Königreich Sachsen |
SchwarzArbG |
Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung |
sec. |
Section |
sog. |
sogenannter/sogenannte/sogenannte |
SPD |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
sublit. |
sublittera |
TCC |
|
TU |
Technische Universität |
U. |
University |
u. a. |
unter anderem |
UK |
United Kingdom |
UKSC |
Supreme Court United Kingdom |
UN |
United Nations |
Univ. |
Universität |
v |
versus |
v. |
von |
v. Chr. |
vor Christus |
Var. |
Variante |
VO |
Verordnung |
VOB |
Details
- Seiten
- 342
- Erscheinungsjahr
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631892626
- ISBN (ePUB)
- 9783631892633
- ISBN (Hardcover)
- 9783631865392
- DOI
- 10.3726/b20339
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (Oktober)
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 342 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG