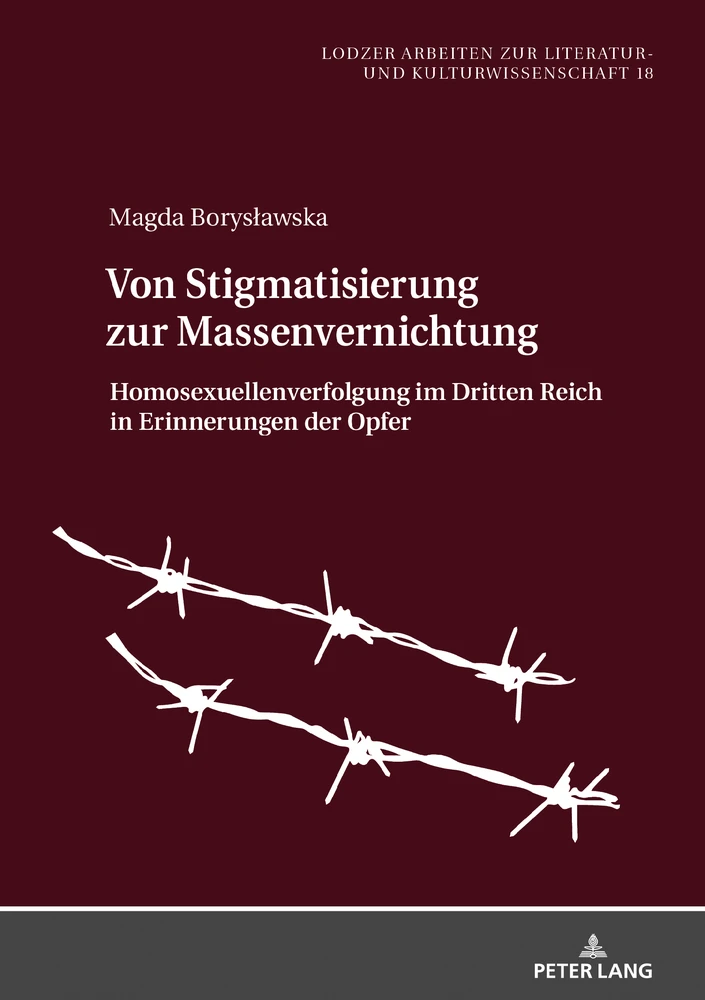Von Stigmatisierung zur Massenvernichtung
Homosexuellenverfolgung im Dritten Reich in Erinnerungen der Opfer
Summary
Adam Ostolski
Das Werk nimmt eine aktuelle Auseinandersetzung mit vergangenen und gegenwärtigen kulturellen Normen auf und beleuchtet überzeugend das Phänomen der Ausgrenzung von Homosexuellen als diejenigen, die nicht in die Normenwelt der Gesellschaft des Dritten Reiches passten.
Marek Ostrowski
Mit historischen Dokumenten und Zeitzeugenberichten bietet das Buch einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der tragischen Schicksale der queeren Opfer. Ein unverzichtbares Werk für alle, die sich mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und der queeren Geschichte auseinandersetzen wollen.
Paweł Piszczatowski
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- I.
- 1. Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
- 2. Zum Forschungsstand
- 3. Feindseligkeit gegen Homosexuelle aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive: auf der Suche nach dem Begriffsnetz
- 3.1. Zwischen Normalisierung und Ausschließung: Soziale Funktionen der Anomalie im Lichte von Theorien sozialer Kontrolle
- 3.2. Homophobie im Lichte Kritischer Diskursanalyse
- 3.3. Die Macht der Sprache und die Sprache der Macht: zum ideologischen Diskurs
- 3.4. „Das Private ist politisch“: Homosexualität im Kontext nationalsozialistischer Biopolitik
- 3.5. Totalität der Gesellschaft im Lichte der Kritischen Theorie und des symbolischen Interaktionismus
- 3.6. NS-Propaganda als eine Form von Kulturindustrie
- 3.7. Zentrale Dimensionen von Gewalt
- 3.8. Genozid: ein Definitionsversuch
- 4. Die moralische Panik
- 4.1. Brave Bürger, Deviante und Moralwächter: zur sozialen Rollenverteilung
- 4.2. Generelles Verständnis moralischer Panik
- 4.3. Zur Genese des Modells moralischer Panik
- 4.4. Panikstruktur und -symptome
- 4.5. Schöpfer einer moralischen Hegemonie
- 4.6. Das Zusammenspiel von kultureller Transition und sozialen Unruhen
- 5. Biografische Methode: Zugang zur individuellen Perspektive
- II.
- 1. „Du brauchst nicht zu verzweifeln, weil du ‚so‘ bist“: Entwicklung eines nicht heteronormativen Selbstbildes und Coming-out
- 2. Warnungsphase
- 2.1. Personifizierung des Bösen
- 2.2. Gegen die traditionellen Werte
- 2.3. Kausalität, Sensibilisierung und Verbreitung
- 2.4. Moralische Empörung als Weg zur Stabilität der sozialen Ordnung
- 2.5. Der Röhm-Putsch
- 2.6. „Aber zusammenhalten müssen wir doch!“
- 2.7. „Ohne Frage – dieses Wort hörte ich nicht zum ersten Mal“
- 2.8. „Ich war kein Mann, wie er meinte“
- 3. Auswirkungsphase
- 3.1. Gegen Fortpflanzung und Familie
- 3.2. Symbolisierung und Herstellung homophober Stereotype
- 3.3. ‚Verführte‘ und ‚Verführer‘
- 3.4. Männlichkeit, Verweichlichung und Bedrohung für den Männerstaat
- 3.5. Disproportionalität und fabrizierte Beweise
- 4. Inventurphase
- 4.1. Empfindlichkeit, Disproportionalität und Diffusion
- 4.2. Denunziation als Form der sozialen Kontrolle
- 4.3. Razzien gegen Homosexuelle und Schneeballprinzip
- 4.4. „Ich brauche deine Aussagen, um diesen Verbrechern ihr Handwerk zu legen“
- 4.5. „Es gab weiter vertrauliche Punkte in Berlin“
- 4.6. „Wir wurden aufgefordert, uns gegenseitig zu denunzieren“
- 4.7. „Nur ganz langsam begann ich, die ganze Wirklichkeit zu erfassen“
- 4.8. „Mich quälte allein die Angst um Willi“
- 4.9. Staatliche Agenten der sozialen Kontrolle
- 4.10. „Das typische Aussehen der homosexuell veranlagten Männer“
- 4.11. Individuelles Engagement und stillschweigende Zustimmung
- 4.12. „Unter den Schwulen wurde endlich aufgeräumt“
- 5. Reaktionsphase
- 5.1. Konsens und Feindlichkeit
- 5.2. Hinter verschlossenen Türen zu rechtlosen Objekten degradiert
- 5.3. Wegen Sicherung der öffentlichen Ordnung und Ruhe
- 5.4. Aus der Perspektive der Gefängniszelle
- 5.5. Anordnungen gegen die Homosexuellen in den Konzentrationslagern
- 5.6. Umerziehung
- 5.7. ‚Freiwillige‘ Entmannung
- 6. Massenvernichtung
- 6.1. Gleichschaltung der Gefangenen: „Ganz offensichtlich haßten die Nazis alle Exzentriker“
- 6.2. Lagergemeinschaft
- 6.3. Schikanen seitens der Mithäftlinge
- 6.4. Die Dramatisierung von Devianz: das Stereotyp des ‚schwulen Nazis‘
- 6.5. Einfluss der Häftlingskategorie auf die Überlebenschance
- 6.6. Sanktionssystem, Strafen und Sadismus
- 6.7. Vernichtung durch Arbeit
- III. Zusammenfassung und abschließende Betrachtung
- IV. Literaturverzeichnis
- 1. Primärliteratur
- 2. Sekundärliteratur
- Index
- Reihenübersicht
I.
1. Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
Homosexuelle Handlungen wurden bereits vor dem Nationalsozialismus kriminalisiert und mit strafrechtlichen Sanktionen belegt. § 175 des Strafgesetzbuchs wurde in Deutschland seit 1871 angewandt: „Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden“ (Schäfer, Widernatürliche Unzucht, 2006, S. 316). Als widernatürliche Unzucht wurden Anal-, Oral- und Schenkelverkehr zwischen Männern verstanden (vgl. Müller/Sparing, Volksfeinde, 1998, S. 25). Im September 1935 jedoch trat die Neuerfassung des bisherigen § 175 in Kraft.1 Nach der Verschärfung war die Interpretation des Begriffs „beischlafähnliche Handlung“ nicht auf den Geschlechtsverkehr begrenzt. Seit 1935 wurde der Tatbestand auf jede Art von „Unzucht“ einschließlich Küsse, Händehalten oder Umarmen erweitert. Darüber hinaus implizierte die Neufassung des Paragrafen eine künstlich etablierte Aufteilung in gewöhnliche Homosexuelle, Strichjungen und Verführer. Während gewöhnlichen Homosexuellen die Gefängnisstrafe drohte, konnten die Vertreter der letzten beiden Gruppen anhand des § 175 bis zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt werden (vgl. Sparing, Vergehen, 1997, S. 59).
Die Sequenz der Kennzeichnung der Homosexualität als Abweichung von der Norm, Stigmatisierung, Bekämpfung und Ausmerzung bilden eine Verfolgungskette, die allerdings keineswegs linear betrachtet werden sollte. Der Bezug auf die Zirkularität der Verfolgungskette ist für die vorliegende Forschung insofern relevant, als sie unterschiedliche Impulse für die Intensivierung der Repression zu identifizieren und ihre Auswirkung auf die breite Masse nachzuvollziehen ermöglicht. Die staatliche und gesellschaftliche Stigmatisierung nach der Machtergreifung Hitlers, die schrittweise zur Einlieferung in Konzentrationslager führte, benötigte jedoch die juristischen Grundlagen, die die Verfolgungsmaßnahmen rechtfertigten. Die Gründe für gesellschaftliche Aversion und Schikanierung in einem derartig großen Ausmaß waren allerdings vielfältig sowie zusammengesetzt und lassen sich nicht auf die nationalsozialistische Gesetzgebung und Verschärfung des homosexuellen Paragrafen zurückführen. Als Erklärung können hierbei der gesellschaftliche Kontext und eine spezifische Moralvorstellung dienen. Die nationalsozialistische Sicht auf Nicht-Heteronormativität wurde in dem öffentlichen Diskurs verbreitet und stellte die männliche Homosexualität als Verneinung der Pflicht zur Fortpflanzung sowie als Opposition zum militärisch geprägten Bild des Manns dar (vgl. Giles, Männerbund, 2002). Homosexuelle wurden als Volksschädlinge eingestuft, die die Bedrohung für die Volksgemeinschaft und für die öffentliche Moral dadurch mit sich bringen, dass sie „alles Naturhafte um[kehren] und eine Voraussetzung für völkischen Zerfall [schaffen]“ (Klare, Hoheitsträger, 1937, S. 25). Unter dem Einfluss solcher Überzeugungen wurden ZivilistInnen zu Denunzianten zum Wohle der Volksgemeinschaft erzogen. Die Anzeige seitens der Umgebung ist nur eines der Beispiele von Unterdrückungsmaßnahmen, die zum Alltag der verfolgten Homosexuellen gehörten. Disziplinierung, Ausgrenzung und ständige Kontrolle sind als Herrschaftstechniken der Nationalsozialisten zu betrachten, die das Gruppenschicksal der Schwulen prägten.
Obwohl in der vorliegenden Forschung nicht die Statistiken, sondern eine qualitative Erfassung der Erkenntnisperspektiven von homosexuellen NS-Opfern zentral behandelt wird, werden im Folgenden einige Zahlen angeführt, um das Ausmaß der strafrechtlichen Verfolgung im Dritten Reich zu schildern. Bereits 1940 befanden sich auf den Personallisten, die durch die Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung erstellt wurden, 41.000 Namen homosexueller Personen, die aufgrund des § 175 verdächtigt oder bestraft wurden (vgl. Grau/Schoppmann, Homosexualität, 2004, S. 140). Vergleicht man die von Jahr zu Jahr steigende Zahl der Verurteilungen, fällt auf, dass sich ihre Zahl zwischen den Jahren 1933 und 1937 verzehnfacht hat (vgl. Stümke, Homosexuelle, 1989, S. 119). Zwischen 1933 und 1945 wurden insgesamt ungefähr 100.000 Homosexuelle von der Gestapo erfasst und über 50.000 vor Gericht verurteilt (vgl. Grau, Verfolgung, 1990, S. 113). Schätzungsweise wurden zwischen 5.000 und 15.000 Homosexuelle in der Zeit des Nationalsozialismus in die Konzentrationslager deportiert. Auf Basis des aktuellen Forschungsstandes lässt sich gleichwohl nicht feststellen, wie viele davon ums Leben gekommen sind. Wegen fehlender Quellen ist es unmöglich, die Frage nach der Todesopferzahl durch die geschichtswissenschaftliche Forschung genau zu beantworten (vgl. Lautmann/Grikschat/Schmidt, Rosa Winkel, 1977, S. 333).
Die wichtige Frage ist, wen genau sollten wir meinen, wenn wir über Opfer im Sinne des § 175 sprechen? Wie kann man diese Gruppe bestimmen oder die Personen, die Opfer des Paragrafen waren, aufweisen? Die Reduzierung der Opfergruppenkategorisierung auf die Opposition gegen heterosexuelle Normen in Bezug auf psychosexuelle Orientierung erscheint unzuverlässig. Nicht jeder, der von § 175 bedroht war, war homosexuell im Sinne von Identität. Manche haben nur homosexuelle Erfahrungen gemacht. Andere waren bisexuell, transsexuell oder, wie es heutzutage heißt, queer. Manche Opfer hatten überhaupt kein Bedürfnis, ihre psychosexuelle Orientierung mithilfe verfügbarer Etiketten zu definieren. Sie befanden sich an einem Punkt im schwankenden Spektrum der menschlichen Sexualität, der nur ihnen bekannt war. Einige von ihnen hatten keinen Zugang zur Sprache, mit der sie es ausdrücken konnten. Daher kann nicht gesagt werden, dass nur Homosexuelle, Opfer der antihomosexuellen Politik der Nazis waren. Auch Nicht-Homosexuelle wurden wegen „Unzucht wider die Natur“ bestraft. Im Kontext von Konzentrationslagern umfasst der Begriff Häftlinge mit der Kategorie ‚homosexuell‘ auch heteronormative Menschen, die vom totalitären Staatsapparat verleumdet oder auf andere Weise als Außenseiter, Abweichler und Staatsfeinde eingestuft wurden (vgl. Borysławska, Więźniowie, 2023, S. 22–23).
Zwar betraf der § 175 sexuelle Handlungen zwischen Männern, und homoerotische beischlafähnliche Handlungen zwischen Frauen standen nicht unter Strafe, es wurden aber auch nichtheterosexuelle Frauen sozial ausgegrenzt und verfolgt. Das Fehlen eines Paragrafen, der den Geschlechtsverkehr zwischen Frauen unter Strafe stellte, bedeutete niemals, dass es keine Verfolgung und Diskriminierung gab. Romantische und erotische Beziehungen zwischen Frauen wurden gesellschaftlich stigmatisiert. Sie waren auch häufig Anlass für polizeiliche Ermittlungen, Durchsuchungen, Verhöre und andere Repressionen. Auch in Österreich, das am 12. März 1938 vom Reich annektiert wurde, war die Kriminalisierung lesbischer Handlungen im Strafrecht vorgesehen. Nach der Annexion änderte sich an der Gesetzgebung in Österreich nichts – weiterhin galt Paragraf 129 Ib des österreichischen Allgemeinen Strafgesetzbuches vom 27. Mai 1852, der für widernatürliche Unzucht mit einer Person gleichen Geschlechts eine Gefängnisstrafe von einem bis fünf Jahren vorsah. Aufgrund der damaligen Anwendung der Tatortregel konnten auch deutsche Frauen nach dem oben genannten Paragrafen 129 Ib verurteilt werden (vgl. Schopmann, Taka miłość, 2021, S. 75). Ebenso wie Schwule wurden auch lesbische Frauen in Konzentrationslager eingeliefert und als ‚Asoziale‘ gekennzeichnet. Für die vorliegende Untersuchung ist ihre Verfolgung jedoch nicht von Interesse, da dies ein eigenes Forschungsgebiet darstellt, das unterschiedlicher theoretischer Werkzeuge und methodischer Ansätze bedarf. Die Lebenssituation und -erfahrung der homosexuellen Frauen war nämlich durch eine ganz andere Art von Ausdifferenzierung sozialer Identitäten sowie psychosexueller Orientierungen gekennzeichnet. Im Gegensatz zur Lesbenverfolgung müssen bei der Untersuchung der Situation der Männer spezifische andersartige rechtliche, medizinische und ideologische Facetten sowie weitere gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt werden (vgl. Schwartz, Homosexuelle, 2014) (vgl. Müller, Vergleichbarkeit, 2007). So stellen die Lesben- und Schwulenverfolgung im Dritten Reich zwei separate Forschungsbereiche dar, die nicht in eine ganzheitliche Analyse zusammengeführt werden sollen.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Verfolgung der homosexuellen Männer auf Basis der Literatur und persönlicher Dokumente darzustellen. In diesem Rahmen soll die Entwicklung der homophoben Einstellungen als auch die individuelle Erfahrung von Schwulen in der Gesellschaft des Dritten Reichs untersucht werden. Darauf aufbauend wird folgende These aufgestellt:
Die Stigmatisierung Homosexueller auf der Ebene diskursiver Praktiken und institutionalisierter Präventivmaßnahmen war Ausdruck einer moralischen Panik.
Um diese These zu verifizieren, werden die persönlichen Erinnerungen der homosexuellen NS-Opfer – und zwar autobiografische Texte, die den homosexuellen Alltag in der nationalsozialistischen Gesellschaft analysieren – einschließlich Stigmatisierung, Ausgrenzung sowie Gefängnis- und KZ-Haft einbezogen. Zur Ergänzung werden die sozial-historischen Ursachen der steigenden Homophobie und Aversion gegenüber Schwulen – als relevanter Kontext der Schwulenverfolgung – anhand kritisch-theoretischer Sozialforschung recherchiert. Die zweite These lautet:
Stigmatisierung führte zur schrittweisen Etablierung der Völkermordintention und zur Massenvernichtung.
Fokussiert werden die Entstehung und Entwicklung der moralischen Panik und der sozialen Kategorisierung, die mit der Abweichungsherstellung verbunden sind. Infolgedessen lauten die weiteren Fragestellungen der Arbeit:
Wie war die Art und Wirkung der gesellschaftlichen Reaktion auf Homosexualität als eine transaktionell hergestellte Abweichung? Welche diskursiven Strategien und Praktiken wurden als Regierungstechniken reproduziert, um die staatliche sowie die soziale Gewalt gegenüber Homosexuellen zu rationalisieren und zu legitimieren? Wie wurden sie von den Individuen erfahren? Aufgrund welcher Eigenschaften lässt sich die soziale Reaktion als moralische Panik klassifizieren?
Neben der Frage nach den Ursachen und Grundlagen der Schwulenverfolgung erfolgt ebenfalls ein genauerer Blick auf den Verlauf der Massenvernichtung, um die These über die Etablierung der Völkermordintention zu verifizieren.
Im Mittelpunkt der Untersuchung der persönlichen Diskriminierungs- und Verfolgungserfahrungen stehen folgende Forschungsfragen:
Welche Erzählstrategien wurden von den Zeitzeugen genutzt, um ihre Erfahrungen und subjektiven Erlebnisse auszudrücken?
Wie und in welchen Kontexten kreuzten sich die soziale Identität und der psychosexuelle Selbstentstehungsprozess mit dem heterosexistischen Regime des NS-Staates?
Inwieweit wurde die Wahrnehmung der eigenen Sexualität durch die biopolitischen Visionen, z. B. die Idee des „gesunden Körpers“, in denen sich die hegemonialen Formen der Männlichkeit materialisieren, beeinflusst?
Da die Bearbeitung des genannten Themenkomplexes darauf abzielt, sowohl die Ausrottung während des Krieges als auch die sozialen Prozesse, die bereits seit den 30er Jahren im Dritten Reich vorkamen und zur Schwulenvernichtung führten, aus der Opferperspektive zu beleuchten, wurde der theoretische Hintergrund mit den literaturwissenschaftlichen Biografieforschungsmethoden bereichert. In der vorliegenden Arbeit korrespondieren sie mit dem Paradigma, „die Privilegierung anonymer Prozesse und überindividueller Strukturen“ (Depkat, schwieriges Genre, 2011, S. 23) zu überwinden und die Geschichte anhand individueller Erfahrungen zu biografisieren. Dies entspricht ebenfalls der Behauptung von Bożena Karwowska, die kritisch bemerkt, dass im Kontext der Lagerforschung die Marginalisierung eines großen Teils der KZ-Häftlingserfahrungen stattfindet. Insbesondere werden die Themen Geschlechtsverkehr, Lagerbordelle, aber auch Pubertät oder Intimität in der Umwelt der Konzentrationslager zum großen Teil ignoriert. Ihrer Meinung nach resultiert die Deprimierung der Körperlichkeit in der Rezeption der Lagerliteratur aus dem Primat der Intellektualität, die in der Literaturwissenschaft gilt (vgl. Karowowska, Ciało, 2009, S. 225).
Die homosexuellen Männer, die die NS-Verfolgung erlebten, bedienten sich der autobiografischen Texte, um sich selbst aus der Zeitperspektive im Kontext der kollektiv respektierten Normen, Werte und Überzeugungen, die innerhalb der homophoben und nationalsozialistisch orientierten Gesellschaft vorherrschten, zu positionieren und ihre zusammengesetzten Lebensgeschichten auszudrücken. Die Literatur des persönlichen Dokuments wird einerseits als Dokumentation der damaligen sozial-historischen Realität gelesen, und andererseits als Texte, die die individuelle Geistigkeit und narrative Schöpfung des Subjekts deutlich machen. Angesichts dessen ist zu konstatieren, dass die Subjektivität der autobiografischen Narration sich als konstitutive Eigenschaft des Textes dieser Art manifestiert. Die Analyse der Erzählweisen fokussiert auf zwei Stufen, und zwar auf die literarische Darstellung und Erklärung, die sich auf den äußeren Lebensablauf und die selbstinterpretativen konstruktivistischen Prozesse beziehen (vgl. Depkat, schwieriges Genre, 2011, S. 27–28).
Zur Erfassung der Mechanismen der sozialen Reaktion sowie der sozialen Kontrolle hinsichtlich der sozialen Minderheiten wurden bereits methodische Instrumente im Bereich der Sozialwissenschaften erarbeitet. Mit dem in der vorliegenden Arbeit verwendeten Modell der moralischen Panik, das von dem Soziologen und Vertreter der kritischen Kriminologie Stanley Cohen ausgearbeitet wurde, wird die Entwicklung der kollektiven Aversion, die später in der Völkermordmobilisierung resultierte, in bestimmte Phasen eingeteilt und strukturiert. Um die Rolle des ideologischen Diskurses, die Erweckung kollektiver Ängste und die Entstehung der Figur eines homosexuellen Volksfeindes in Relation zu setzen, wird der methodische Ansatz der Kritischen Diskursanalyse mit dem Modell der moralischen Panik kombiniert. Ferner treten dabei unterschiedliche Aspekte wie soziale Empfindlichkeit (concern), Empörung (hostility), Konsens (consensus), Disproportionalität (disproportionality) oder Flüchtigkeit (volatility) in den Vordergrund, die sich mit der moralischen Panik verbinden und sich aus der kritischen Perspektive analysieren lassen. Mit den benannten Schwerpunkten setzt die vorliegende Arbeit die Traditionen des sozialen Konstruktivismus in einer transaktionellen Auffassung fort.
An dieser Stelle zeigt sich wieder eine signifikante Korrelation zwischen der Biografieforschung und den konstruktivistischen Ansätzen, die die Eigenperspektive der handelnden Subjekte in den Mittelpunkt stellen. Eine solche Perspektive ermöglicht, die Aufmerksamkeit auf marginalisierte Gruppen oder Kulturen und ihre nicht geäußerten bzw. ignorierten Stimmen und Erzählungen zu lenken. Die Biografieforschung enthüllt hierbei die subjektiven Wahrnehmungen von Gewalt, Hunger, absoluter Disziplinarkontrolle sowie verschiedenen Überlebensstrategien in Konzentrationslagern. Zwischen der oben skizzierten transaktionellen Sozialwissenschaft und der literarischen Biografieforschung besteht eine hohe Affinität aufgrund des gemeinsamen Arbeitsfeldes. Somit versteht sich die vorliegende Untersuchung als Beitrag zur Etablierung des integrativen methodischen Ansatzes zu den Studien über Massenvernichtung.
Da als das Untersuchungsgebiet des zweiten Teils der Arbeit die individuellen Erinnerungen der Zeitzeugen gewählt wurden, werden die vorher benannten Forschungsfragen mit der Analyse der autobiografischen Zeitzeugenberichte und den anderen Arten von Literatur des persönlichen Dokuments beantwortet. Das empirische Material besteht aus vier Autobiografien, einer Biografie, zwei Sammlungen von biografischen Texten mit zahlreichen Zitaten aus Zeitzeugenberichten, Briefen etc. und einer verarbeiteten Sammlung der Strafakten des Landgerichts Berlin und der Ermittlungsfälle aus den Staatsanwaltschaftsregistern.
Die Texte sind im Zeitraum von 1972 bis 2011 erschienen und wurden anhand von Auswahlkriterien bzgl. des Inhalts zusammengestellt. Die Erstellung der Liste von Primärliteratur war abhängig von den zuvor präsentierten Forschungsfragen. Das heißt: Erstens sollten die Erzählungen die Wirklichkeit aus der persönlichen Perspektive von Opfern des NS-Regimes dokumentieren. Es geht hierbei nicht um eine genaue Rekonstruktion der Vergangenheit, die für die Geschichtsschreibung charakteristisch ist, sondern um eine Abbildung des individuellen Sinns sowie der Wirklichkeitswahrnehmung. Die konstruktivistische Auswirkung der menschlichen Wahrnehmung, die in die Logik des autobiografischen Schreibens einbezogen wird, ermöglicht es, einen kritischen Blick auf die geschichtswissenschaftlich geprägte Mainstream-Erzählung über das nationalsozialistische System und den Zweiten Weltkrieg zu werfen. Zweitens sollte sie die Identität des Erzählers durch die Angehörigkeit zur nichtheterosexuellen Minderheit aufzeichnen. Dies konnte durch die narrative Klärung des Selbstbildes erreicht werden, was besonders sichtbar wird, wenn man das autobiografische Erzählen als Herstellung des Identitätsentwurfs auf der Metaebene betrachtet.
Details
- Pages
- 322
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631918623
- ISBN (ePUB)
- 9783631918630
- ISBN (Hardcover)
- 9783631914007
- DOI
- 10.3726/b21806
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (October)
- Keywords
- Völkermord Genozid Heterotopien Kennzeichnungstheorie soziale Kontrolle Kulturindustrie Konzentrationslagern Homosexualität Drittes Reich Stigmatisierung moralische Panik ideologischer Diskurs Literatur des persönlichen Dokuments
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 322 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG