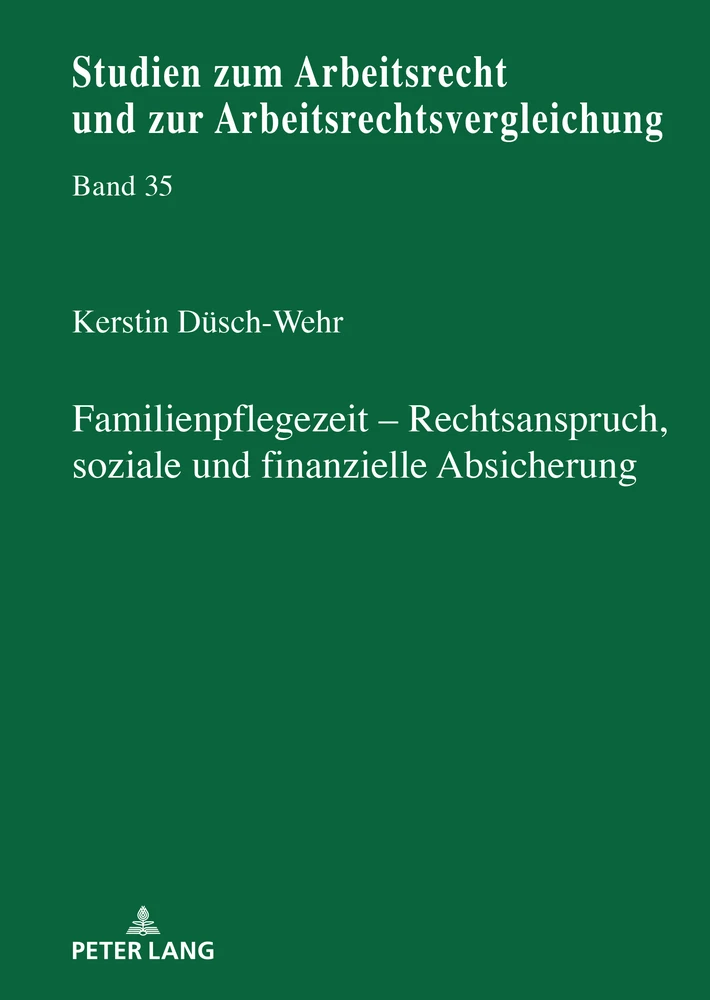Familienpflegezeit - Rechsanspruch, soziale und finanzielle Absicherung
Summary
Für die Übernahme der Pflege durch Angehörige ist insbesondere die finanzielle Situation von Pflegebedürftigem und pflegendem Angehörigen von Bedeutung. Vor diesem Hintergrund beleuchtet die Arbeit die Regelungen des Familienpflegezeitgesetzes näher.
Zunächst wird der Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit hinsichtlich seiner Verfassungsmäßigkeit geprüft und die Rechtfertigung des Eingriffs in Art. 12 Abs. 1 GG durch Art. 6 Abs. 1 GG und Art. 3 Abs. 2 GG herausgearbeitet. Der Vorschlag zu einer künftigen, effizienteren Finanzierung der Familienpflegezeit nimmt vertieft die Finanzierung durch Steuermittel in Anlehnung an das Elterngeld sowie eine Finanzierung im Rahmen der sozialen Pflegeversicherung in den Blick.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Dedication
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erster Teil: Grundlagen
- A. Grundlegende Begriffe
- I. Pflegebedürftigkeit
- II. Beschäftigte
- III. Nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen
- B. Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Pflege
- I. Pflegebedürftigkeit und Pflegepersonen in aktuellen Zahlen
- II. Nebeneinander von Berufstätigkeit und Pflege
- 1. Pflegepotential
- 2. Finanzielle Absicherung
- 3. Resümee
- C. Rechtliche Grundlagen für die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Pflege
- I. Europarechtliche Regelungen
- 1. Entstehungsgeschichte der Richtlinie (EU) 2019/1158
- 2. Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (EU)
- II. Arbeitsrechtliche Regelungen
- 1. Entstehungsgeschichte von Pflege- und Familienpflegezeit
- a) Diskussion vor Einführung der Pflegeversicherung
- b) Förderung der Teilzeitarbeit
- c) Einführung des Pflegezeitgesetzes
- d) Einführung des Familienpflegezeitgesetzes
- 2. Pflegezeitgesetz
- a) Rechtsanspruch auf vollständige oder teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung
- b) Kündigungsschutz
- c) Finanzielle Absicherung
- 3. Familienpflegezeitgesetz
- a) Rechtsanspruch auf teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung
- aa) Voraussetzungen
- (1) Betriebsgröße
- (2) Ankündigungsfrist
- bb) Dauer der Familienpflegezeit
- b) Kündigungsschutz
- c) Finanzielle Förderung
- aa) Finanzielle Förderung durch Aufstockung des Arbeitsentgelts
- bb) Finanzierung des Aufstockungsbetrags
- cc) Höhe beziehungsweise Umfang des Darlehens
- dd) Rückzahlung des Darlehens
- (1) Rückzahlung nach § 6 FPfZG
- (2) Rückzahlung im Härtefall nach § 7 FPfZG
- (a) Stundung der Rückzahlung des Darlehens
- (b) Teilerlass der Rückzahlungsverpflichtung und Stundung bis zum Ende der häuslichen Pflege
- (c) Erlöschen der gesamten Darlehensschuld
- (d) Anwendbarkeit der §§ 58 und 59 BHO
- (aa) Änderung von Verträgen oder Abschluss von Vergleichen nach § 58 BHO
- (bb) Veränderung von Ansprüchen
- 4. Verschränkung von Pflege- und Familienpflegezeit
- III. Sozialversicherungsrechtliche Regelungen
- 1. Pflegeversicherung – Sozialgesetzbuch XI
- a) Historische Entwicklung der sozialen Absicherung von Pflegepersonen
- b) Einbeziehung von Pflegepersonen in die Pflegeversicherung
- c) Einweisungsnorm § 44 SGB XI
- d) Zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzfristiger Arbeitsverhinderung – § 44a SGB XI
- aa) Finanzielle Zuschüsse zu Kranken- und Pflegeversicherung nach § 44a Abs. 1 SGB XI
- bb) Pflegeunterstützungsgeld nach § 44a Abs. 3 bis 7 SGB XI
- 2. Krankenversicherung – Sozialgesetzbuch V
- a) Historische Entwicklung
- b) Einbeziehung in die Krankenversicherung
- 3. Rentenversicherung – Sozialgesetzbuch VI
- a) Historische Entwicklung
- b) Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung
- c) Absicherung in berufsständischen Versorgungseinrichtungen
- 4. Arbeitslosenversicherung – Sozialgesetzbuch III
- a) Historische Entwicklung
- b) Einbeziehung von Pflegepersonen in die Arbeitslosenversicherung
- 5. Unfallversicherung – Sozialgesetzbuch VII
- a) Historische Entwicklung
- b) Einbeziehung in die gesetzliche Unfallversicherung
- Zweiter Teil: Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit
- A. Historische Entwicklung eines Rechtsanspruchs auf Freistellung zur Pflege
- B. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit
- I. Vereinbarkeit mit der Berufsfreiheit des Arbeitgebers aus Art. 12 Abs. 1 GG
- 1. Schutzbereich – Berufsfreiheit der Arbeitgeber aus Art. 12 Abs. 1 GG
- a) Persönlicher Schutzbereich
- b) Sachlicher Schutzbereich
- 2. Eingriff in Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG
- 3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs
- a) Formelle Anforderungen
- b) Materielle Anforderungen
- aa) Vernünftige Gründe des Allgemeinwohls
- (1) Erfordernisse der Pflege
- (2) Schutz der Familie
- (a) Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 GG
- aa) Schutz der „Kernfamilie“
- bb) Schutzbereich über die „Kernfamilie“ hinaus
- (i) Volljährige „Kernfamilie“
- (ii) Erweiterte Kernfamilie
- bb) Resümee
- c) Verhältnismäßigkeit
- d) Zusammenfassung
- II. Vereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 2 GG
- III. Fazit
- C. Zur Ausgestaltung des Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit
- I. Anspruchsberechtigter Personenkreis
- II. Betriebsgröße
- III. Ankündigungsfrist und Durchsetzung
- 1. Ankündigungsfrist
- 2. Durchsetzung der Arbeitszeitreduzierung
- 3. Einschätzung
- IV. Dauer der Freistellung
- V. Fazit
- D. Bewertung
- Dritter Teil: Soziale Absicherung der Pflegeperson
- A. Absicherung in der sozialen Pflegeversicherung
- B. Absicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung
- C. Absicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung
- D. Absicherung in der Arbeitslosenversicherung
- E. Absicherung in der gesetzlichen Unfallversicherung
- I. Anforderungen des § 19 SGB XI: Abhängigkeit von zeitlichen Umfang und Verteilung der Pflegetätigkeit
- II. Versicherte Tätigkeiten
- F. Bewertung
- Vierter Teil: Finanzielle Absicherung während der Inanspruchnahme von Familienpflegezeit
- A. Erforderlichkeit einer finanziellen Absicherung der Beschäftigten während der Inanspruchnahme von Familienpflegezeit
- I. Finanzielle Absicherung der Pflegeperson während der Familienpflegezeit der Pflegeperson de lege lata
- 1. Leistungen der Pflegeversicherung
- a) Finanzierung der häuslichen Pflege
- b) Stärkung der häuslichen Pflege
- 2. Zinsloses Darlehen des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
- II. Unterhaltspflicht der nahen Angehörigen
- 1. Unterhaltsanspruch nach § 1601 ff. BGB
- 2. Übergang des Unterhaltsanspruchs auf den Sozialhilfeträger nach § 94 SGB XII
- 3. Zusammenfassung
- III. Finanzielle Einschränkungen durch die Inanspruchnahme einer Familienpflegezeit
- 1. Finanzielle Situation während der Inanspruchnahme einer Familienpflegezeit
- 2. Finanzielle Auswirkung auf die Alterssicherung
- IV. Fazit
- B. Verfassungsrechtliche Einordnung der finanziellen Absicherung für Beschäftigte in Familienpflegezeit
- I. Pflicht zur Gewährung einer finanziellen Absicherung aus Art. 6 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG
- 1. Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 GG
- 2. Umfang der Pflicht zur Förderung der Familie aus Art. 6 Abs. 1 GG
- a) Familienlastenausgleich
- b) Vergleichbarkeit der finanziellen Unterstützung für die Pflege innerhalb der Familie
- 3. Auswirkungen des Sozialstaatsprinzips aus Art. 20 Abs. 1 GG
- 4. Resümee
- II. Pflicht zur Gewährung einer finanziellen Unterstützung aus dem Gleichstellungsgebot Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG
- 1. Reichweite des Förderauftrags
- 2. Beseitigung bestehender Nachteile
- 3. Vergleichbarkeit von Familienpflege- und Elternzeit
- III. Fazit
- C. Zur Ausgestaltung der finanziellen Absicherung
- D. Verschiedene Möglichkeiten der Ausgestaltung einer finanziellen Absicherung
- I. Entgeltersatzleistungen durch den Arbeitgeber
- 1. Grundsatz der Entgeltfortzahlung
- 2. Vereinbarkeit der Lohnfortzahlung im Rahmen der Familienpflegezeit mit der Berufsfreiheit der Arbeitgeber aus Art. 12 Abs. 1 GG
- 3. Ergebnis
- II. Finanzierung durch Wertguthaben
- 1. Historische Entwicklung
- a) Zinsloses Darlehen des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben an den Arbeitgeber
- b) Ausgleich des Wertguthabens und Rückzahlung des Darlehens
- 2. Wertguthaben nach § 7b SGB IV
- 3. Wertguthaben zur Finanzierung einer Familienpflegezeit
- 4. Ergebnis
- III. Finanzierung in Anlehnung an das Elterngeld
- 1. Elterngeld als Vorbild
- a) Historische Entwicklung
- b) Zielsetzung des Elterngelds nach § 1 ff. BEEG
- c) Situation der Familien mit Kindern im betreuungsbedürftigen Alter
- 2. Finanzielle Unterstützung während der Familienpflegezeit
- a) Zielsetzung der finanziellen Unterstützung nach § 3 Abs. 1 FPfZG
- b) Situation der pflegenden Angehörigen
- 3. Vergleichbarkeit von Elterngeld und einer finanziellen Unterstützung während der Familienpflegezeit
- 4. Ergebnis
- IV. Finanzierung im Rahmen des SGB XI
- 1. Zielsetzung und Leistungen der Pflegeversicherung
- 2. Gesamtgesellschaftliche Verantwortung und notwendige Eigenvorsorge der Pflegebedürftigen
- 3. Finanzielle Mittel der Pflegeversicherung
- a) Finanzierung der Pflegeversicherung
- b) Einbeziehung der finanziellen Unterstützung während der Familienpflegezeit in die Leistungen der Pflegeversicherung
- 4. Ergebnis
- V. Fazit
- E. Bewertung
- Fünfter Teil: Endergebnis
- Literaturverzeichnis
Einleitung
Die Frage, wie die Betreuung und Pflege pflegebedürftiger Personen sichergestellt werden kann, ist in den vergangenen Jahren verstärkt diskutiert worden. Im Fokus steht dabei neben der Betreuung der Pflegebedürftigen in stationären Einrichtungen oder ambulanten Diensten die Frage der Pflege im privaten Umfeld. Im Kern steht hierbei meist die Problematik, dass die Zahl der pflege- und betreuungsbedürftigen Personen aufgrund des demografischen Wandels weiter steigt1 und die Zahl der potenziellen nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen stetig – wenn auch langsam – fällt.2
Von den 4,96 Millionen Pflegebedürftigen, die das Statistische Bundesamt im Jahr 2021 erfasst hat, wurden 2,55 Millionen beziehungsweise 51,4 % zu Hause durch Angehörige betreut.3 Die Pflege wird damit in mehr als der Hälfte der Fälle innerhalb der Familie erbracht, sodass die Pflegebereitschaft und die Möglichkeit naher Angehöriger, die Pflege tatsächlich zu übernehmen, auch zukünftig ein wichtiger, wenn nicht gar der wichtigste Bestandteil zur Sicherstellung der Betreuung Pflegebedürftiger sein wird. Vor diesem Hintergrund wird verstärkt auf die Gefahr hingewiesen, dass die Übernahme der Pflege durch Angehörige in Zukunft nicht in gleichem Maße wie bisher aufrechterhalten werden kann.4 Um eine ambulante Betreuung durch Angehörige zu ermöglichen, wird dabei immer häufiger auf eine notwendige Verbesserung der Vereinbarung von Berufstätigkeit und Pflege und die dabei gesehene Notwendigkeit einer finanziellen Unterstützung der pflegenden Angehörigen hingewiesen.5
Die Diskussion über die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf wurde im Wesentlichen durch die Studie „Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege“ angestoßen, die vom Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend (BMFSFJ) bereits im Jahr 1997 veröffentlicht worden ist.6 Hier wurden explizit auch die fehlenden Möglichkeiten, Erwerbstätigkeit und Pflege miteinander zu vereinbaren, angesprochen und angeregt, dass der Gesetzgeber der Idee eines Pflegeurlaubs analog zum Erziehungsurlaub nachgehen solle.7 Diese Anregung wurde im Schlussbericht der Enquete-Kommission „Demographischer Wandel – Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik“ im Jahr 2002 erneut aufgegriffen.8
Das erste Gesetz, das schließlich gezielt die Frage der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf regeln sollte, war das Pflegezeitgesetz9 (PflegeZG), das zum 1. Juli 2008 eingeführt wurde10 und Beschäftigten unter anderem einen Anspruch auf sechsmonatige Freistellung zur Pflege eines nahen Angehörigen gewährt. Während die Regelungen einigen nicht weit genug gingen,11 waren insbesondere Arbeitgeberverbände der Ansicht, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege12 bereits mit den bestehenden Regelungen13 gewährleistet würde. An den Regelungen des Pflegezeitgesetzes sind vor allem die fehlende finanzielle Absicherung der Beschäftigten während einer vollständigen Freistellung von der Arbeit und die kurze Zeit der Freistellung kritisiert worden.14 Auch diesen Defiziten des Pflegezeitgesetzes sollte durch das Gesetz über die Familienpflegezeit15 (Familienpflegezeitgesetz, FPfZG), das zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, begegnet werden. Für Beschäftigte wurde hierdurch die Möglichkeit geschaffen, mit ihrem Arbeitgeber auf freiwilliger Basis eine Vereinbarung zu treffen, um ihre Arbeitszeit für maximal zwei Jahre zu verringern. Ein finanzieller Ausgleich während der Pflege sollte über negative Wertguthaben erreicht werden. Ziel des Gesetzes war es, die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf durch eine staatlich geförderte Aufstockung des Arbeitsentgelts der Beschäftigten, die ihre Arbeitszeit für die Pflege eines nahen Angehörigen reduzieren, zu verbessern.16
Ein Rechtsanspruch auch auf Familienpflegezeit wurde dann durch das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf17 (FPfZG 2015) eingeführt, das zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist; gleichzeitig wurde die finanzielle Unterstützung der pflegenden Beschäftigten überarbeitet. Ziel des Gesetzgebers war unter anderem, die Regelungen des Familienpflege- und Pflegezeitgesetzes besser aufeinander abzustimmen.18 So besteht ein Anspruch auf die finanzielle Unterstützung, die im Rahmen der Familienpflegezeit gewährt wird, nunmehr auch während der Inanspruchnahme einer Pflegezeit. In beiden Gesetzen wurden zudem Ausnahmen vorgesehen, bei deren Vorliegen auf die Voraussetzung der Pflege in häuslicher Umgebung verzichtet wird.19 Wohlfahrts- und Pflegeverbände kritisieren die Regelungen jedoch weiterhin als nicht weitgehend genug.20 Während Arbeitgeberverbände wiederum zu bedenken geben, dass die erneute Belastung der Arbeitgeber zu einem Verlust von Arbeitsplätzen führen könne und keine Notwendigkeit bestünde, die bestehenden Regelungen zu ändern.21
Auch wenn die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Pflege von sehr unterschiedlichen Faktoren abhängt – wie etwa der Planbarkeit und Verlässlichkeit der Arbeitszeitgestaltung oder der Möglichkeit, schnell und flexibel auf unvorhergesehene Krisensituationen reagieren zu können22 – ist insbesondere die finanzielle Situation von Pflegebedürftigem und pflegendem Angehörigen von erheblicher Bedeutung für die Übernahme der Pflege durch Angehörige.
Bis zur Einführung des Familienpflegezeitgesetzes zum 1. Januar 201223 waren nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen, die ihre Berufstätigkeit zugunsten der Pflege eines nahen Angehörigen reduzierten oder aufgegeben haben, entweder durch die Berufstätigkeit ihres Partners abgesichert24 oder griffen auf eigene Ersparnisse oder Ersparnisse des Pflegebedürftigen zurück, um weiterhin ein ausreichendes Einkommen erzielen zu können.25 Auch die durch das Pflegezeitgesetz26 eingeführte Möglichkeit zur Reduzierung der Arbeitszeit und das durch das Familienpflegezeitgesetz vorgesehene zinslose Darlehen des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) wurden nur selten in Anspruch genommen.27 Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Ausgestaltung der finanziellen Unterstützung als zinsloses Darlehen, das im Anschluss an die Freistellung zur Pflege zurückgezahlt werden muss, ausreichend ist, um die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Pflege zu gewährleisten.
Die Arbeit soll die Regelungen des Familienpflegezeitgesetzes näher beleuchten, dabei insbesondere die finanzielle Absicherung der pflegenden Angehörigen in den Blick nehmen und einen Vorschlag zur besseren finanziellen Absicherung der Beschäftigten, die ihre Arbeitszeit zur Pflege eines nahen Angehörigen reduzieren, erarbeiten. Aufgrund der engen Verzahnung der Regelungen der Familienpflege- und der Pflegezeit werden teilweise auch die Regelungen des Pflegezeitgesetzes näher untersucht.
Auch wenn Pflegebedürftigkeit Personen jeder Altersgruppe treffen kann, steigt das Risiko, pflegebedürftig zu werden ab dem 60. Lebensjahr erheblich an.28 Aus diesem Grund soll im Folgenden über die verschiedenen Herausforderungen für Berufstätige gesprochen werden, die hauptsächlich bei der Betreuung älterer Pflegebedürftiger auftreten. Die Problemlagen bei der Betreuung pflegebedürftiger Kinder und (relativ) junger Erwachsener sind in vielen Bereichen mit der Situation bei der Betreuung pflegebedürftiger älterer Menschen vergleichbar, unterscheiden sich allerdings bei zentralen Punkten – wie etwa der Zeitspanne, während derer die Pflege zu erbringen ist – erheblich.29 Aus diesem Grund soll die Betreuung von Pflegebedürftigen jungen und mittleren Alters im Wesentlichen aus der Betrachtung ausgenommen werden.
In einem ersten Schritt werden die Grundlagen für eine Vereinbarkeit von Pflege und Beruf erarbeitet sowie grundlegende Begriffe und die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen dargestellt (Erster Teil). Der durch das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf eingeführte Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit bietet Rechtssicherheit für die Beschäftigten, die ihre Arbeitszeit zur Pflege eines nahen Angehörigen reduzieren möchten, könnte jedoch einen Eingriff in die Berufsfreiheit der Arbeitgeber aus Art. 12 Abs. 1 GG darstellen. Daher soll im Anschluss die Verfassungsmäßigkeit des Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit in den Blick genommen werden (Zweiter Teil). Hierbei wird die Rechtfertigung des Eingriffs aufgrund der Schutzpflicht des Staates für Ehe und Familie aus Art. 6 Abs. 1 GG und das Gleichbehandlungsgebot aus Art. 3 Abs. 2 GG herausgearbeitet. Die soziale Absicherung der Beschäftigten, die eine Familienpflegezeit in Anspruch nehmen, hat ebenfalls Einfluss auf deren Inanspruchnahme und soll deshalb im Anschluss dargestellt werden (Dritter Teil). Hierbei wird herausgearbeitet, dass die soziale Absicherung im Rahmen der Familienpflegezeit in weiten Teilen außerhalb des Familienpflegezeitgesetzes geregelt ist.
Abschließend soll die Ausgestaltung der wirtschaftlichen Absicherung der Beschäftigten, die ihre Arbeitszeit zur Pflege eines nahen Angehörigen reduzieren, beleuchtet und ein Vorschlag zu einer künftigen, effizienteren Finanzierung der Familienpflegezeit unterbreitet werden. (Vierter Teil). Hierbei wird sowohl die Möglichkeit einer Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber, die vom Gesetzgeber wieder verworfene Möglichkeit der Finanzierung über ein Wertguthaben nach §§ 7b ff. SGB VI, die Finanzierung durch Steuermittel in Anlehnung an die Regelungen des Elterngeldes sowie eine Finanzierung im Rahmen der sozialen Pflegeversicherung herausgearbeitet.
1 Im Jahr 2021 sind 16,4 Mio der Bevölkerung älter als 67 Jahre; bis zum Ende der 2030er Jahre wird diese Altersgruppe – je nach Berechnungsvariante der 15. Koordinierten Bevölkerungsberechnung – voraussichtlich um weiter 4 bis 5 Mio anwachsen und mindestens 20,4 Mio betragen, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvorausberechnung/begleitheft.html, zuletzt abgerufen am: 26.5.2024. Gleichzeitig sind 2021 nur 16,5 % der Pflegebedürftigen jünger als 60 Jahre, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/12/PD22_554_224.html, zuletzt abgerufen am: 26.5.2024.
2 Statistisches Bundesamt, Bevölkerung nach Altersgruppen, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/liste-altersgruppen.html, zuletzt abgerufen am: 26.5.2024.
3 Abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Pflege/Tabellen/pflegebeduerftige-pflegestufe.html, zuletzt abgerufen am: 26.5.2024.
4 Siehe etwa: Ergebnisbericht zum Forschungsvorhaben – Männer zwischen Erwerbstätigkeit und Pflege: typische Arrangements, Ressourcen und Unterstützungsbedarfe, abrufbar unter: http://www.boeckler.de/11145.htm?projekt=2012-611-4, zuletzt abgerufen am: 26.5.2024.
5 Siehe nur Antrag des Landes Berlin, BR-Drs. 104/20.
6 Beck/Naegle/Reichert/Dallinger, Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Pflege [Hrsg. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend].
7 Beck/Naegle/Reichert/Dallinger, Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Pflege, S. 21.
8 BT-Drs. 14/8800, S. 267.
9 Art. 3 des Gesetzes zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung, BGBl. 2008 I 874.
10 BT-Drs. 16/7439, S. 90.
11 Karb, öAT 2012, 30 ff.; Glatzel, NJW 2012, 1175 ff.; Göttling/Neumann, NZA 2012, 119 ff.
12 Vgl. etwa Stellungnahme der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zur öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Gesundheit, am 21.1.2008 Ausschuss-Drs. 16 (14) 0327(29), S. 11.
13 Abgestellt wurde dabei insbesondere auf die Möglichkeit der Reduzierung der Arbeitszeit über § 8 TzBfG.
14 BT-Drs. 16/7472; Preis/Nehring, NZA 2008, 729 ff. (736); Herget, dbr 2008, 19 f. (20).
15 Art. 1 des Gesetzes zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf v. 6.12.2011, BGBl. 2011 I 2564, in Kraft getreten am 1.1.2012.
16 BT-Drs. 17/6000, S. 1 f.
17 Art. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf v. 23.12.2014, BGBl. 2014 I 2462, in Kraft getreten am 1.1.2015.
Details
- Pages
- 250
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631920183
- ISBN (ePUB)
- 9783631920190
- ISBN (Hardcover)
- 9783631920152
- DOI
- 10.3726/b21905
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (November)
- Keywords
- Elterngeld Familienpflegezeitgesetz informelle Pflege Finanzierung der Arbeitszeitreduzierung während Familienpflegezeit Familienpflegezeit Finanzielle Absicherung der Beschäftigten während Familienpflegezeit Arbeitszeitreduzierung Weiterentwicklung Familienpflegezeit
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 250 S., 0 farb. Abb., 0 s/w Abb., 0 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG