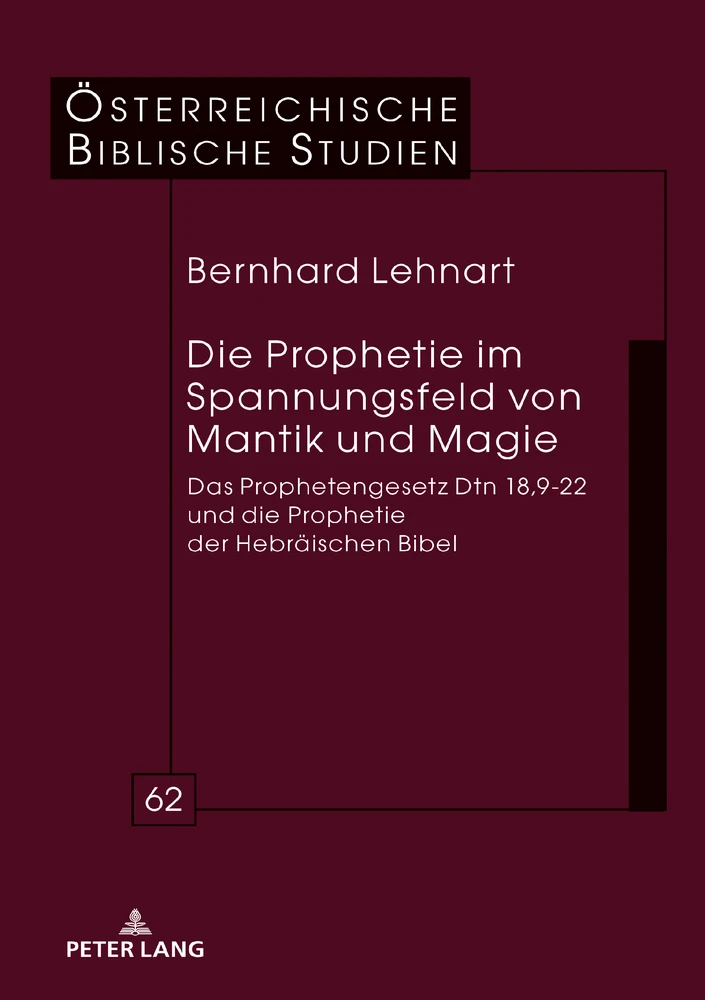Die Prophetie im Spannungsfeld von Mantik und Magie
Das Prophetengesetz Dtn 18,9-22 und die Prophetie der Hebräischen Bibel
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- 1. Forschungsgeschichtliche Skizze zur Prophetie
- Die Herausbildung des klassischen Prophetenbildes
- Parallelen zur Prophetie in der Umwelt Israels
- Paradigmenwechsel
- Ziel der Untersuchung
- 2. Analyse des Prophetengesetzes Dtn 18,9–22
- Kontext: Der „Verfassungsentwurf“ Dtn 16,18–18,22
- Die Frage der diachronen Schichtung des Prophetengesetzes
- Die einzelnen Praktiken von Dtn 18,10 f.14 und ihr Verhältnis zur Prophetie
- מעביר בנו־ובתו בא
- Sprachliche Parallelen von בא העביר
- Ähnliche Wendungen
- Menschen- bzw. Kinderopfer
- קסם
- 3. Überlegungen zum Verhältnis von Prophetie, Divination und Magie
- Das Prophetenbild des Prophetengesetzes im Kontext des Buches Deuteronomium
- Zum Titel „Nabi“
- Nabi und die Titel „Seher“ (חזה / ראה) und „Gottesmann“
- Der Titel „Nabi“ in der Hebräischen Bibel – ein survey
- Mose und die Propheten
- Die Prophetie des Prophetengesetzes im Vergleich mit den anderen „Ämtern“ im „Verfassungsentwurf“
- Zum Verhältnis von divinatorischen und magischen Erscheinungen zur Prophetie
- Zusammenfassung der Begriffsuntersuchungen
- Prophetie und Magie
- Aaron in Exodus 7
- Bileam
- 1 Kön 13
- Elija
- Elischa
- Jesaja
- Jeremia
- Ezechiel
- Prophetische Zeichenhandlungen
- 3.2.2.10 Schlussfolgerungen
- Prophetie und Divination
- Versuch einer Definition der biblischen Prophetie
- 4. Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
1. Forschungsgeschichtliche Skizze zur Prophetie
1.1 Die Herausbildung des klassischen Prophetenbildes
Betrachtet man den Anfang der Bibel, den Pentateuch, der für Juden (und Samaritaner) den höchsten Stellenwert bei den heiligen Schriften besitzt, so wird man feststellen, dass Propheten in diesem ersten Teil der Bibel eine verhältnismäßig geringe Rolle spielen. Zwar wird schon der Erzvater Abraham in Gen 20,6 als „nābî՚“ bezeichnet, ansonsten lassen aber die Erzählungen kaum erkennen, dass Abraham in einer prophetischen Rolle erscheint. Dies gilt auch für Aaron und Mirjam, die ebenfalls den Titel nābî՚ bzw nebî՚āh erhalten.1 Einzig im Buch Numeri findet sich eine längere Erzählung, die von einer prophetischen Gestalt, Bileam, handelt. Bileam ist zwar deutlich in einer prophetischen Rolle gezeichnet, erhält aber keinen prophetischen Titel2 und ist außerdem kein Israelit, obwohl Jhwh als sein Gott erscheint.
Auch im Buch Deuteronomium, das den Pentateuch abschließt, ist recht wenig von Propheten und Prophetie die Rede. In Dtn 13,2–6 wird vor falschen Propheten gewarnt und ansonsten ist es allein die Gestalt des Mose, die in einem engen Zusammenhang mit der Prophetie begegnet. Mit ihm verknüpft ist ein Prophetengesetz in Dtn 18,9–22, das die Sichtweise der Prophetie wesentlich bestimmt hat. Dieses Gesetz grenzt die Prophetie deutlich von „heidnischen“ Praktiken ab und verbindet den „Nabi“ mit Mose und der Gesetzgebung am Berg Horeb. In den Jahrhunderten vor dem Aufkommen der historisch-kritischen Exegese war es selbstverständlich, dass das mit Mose verbundene Prophetengesetz das Verständnis der Prophetie bestimmte. In einem forschungsgeschichtlichen Überblick fasst C.R. Seitz diese Sichtweise zusammen: „Prior to the nineteenth century it had of course been taken for granted that the canonical presentation mirrored the history of religion, and in that conception, prophecy was inextricably tied to law. The prophets were the successors of Moses.“3.
Obwohl demnach prophetische Gestalten und Prophetie im Pentateuch einen geringen Raum einnehmen, ist durch das Prophetengesetz in Dtn 18 das Urteil von Wellhausen nicht von der Hand zu weisen, der meint „Das Deuteronomium krönt die Arbeit der Propheten“4. Bei den Forscherinnen und Forschern des 19. bzw. des beginnenden 20. Jahrhunderts zeigt sich dennoch eine andere Erkenntnis als von der Tradition vorgegeben, die die Linie der Propheten bei Mose beginnen lässt. Der neue Grundsatz lautet: Lex post prophetas.5
Mit der Trennung vom Gesetz und dem Beginn bei Mose eröffnete sich der Raum, die Propheten, insbesondere die Schriftpropheten, als individuelle Persönlichkeiten zu begreifen, die einen eigenständigen Beitrag zur israelitischen Religion geleistet haben. Bernhard Duhm hat mit der Bezeichnung der Propheten als „Männer des ewig Neuen“6 die neue Sichtweise prägnant zusammengefasst.
Nachdem schon Heinrich Ewald 1840/1841 die Prophetie als eine Größe sui generis beschrieben und betont hat, dass sie mit Hilfe des Geistes allgemeine Wahrheiten erkennen und verkünden,7 wird der Kern ihrer Botschaft gern als „ethischer Monotheismus“ bezeichnet. Erstmalig zeigt sich diese Qualifizierung der prophetischen Tätigkeit bei Abraham Kuenen in seinem Werk „De Profeten en de Profetie onder Israël“, das 1875 erschienen ist.8 Er sieht den ethischen Monotheismus als Schöpfung der Propheten an.
Mit der Erkenntnis, dass die Propheten individuelle Persönlichkeiten darstellen mit der zentralen Aussage eines ethischen Monotheismus ist natürlich auch die Frage verbunden, welche inneren Erfahrungen diese Propheten zu ihrer Verkündigung bewegt haben.
Dies veranlasste Hermann Gunkel, sich dem Innenleben der Propheten zuzuwenden. In dem Aufsatz „Die geheimen Erfahrungen der Propheten“, der zuerst 1903 veröffentlicht wurde, sieht er die Ekstase als Grunderlebnis der Propheten an.9 Diese Erfahrung verbinde die ältesten Propheten auch noch mit den Schriftpropheten der späteren Zeit, die wie die älteren Propheten auch vom Volk als „Nebiim“ gesehen werden.10
1914 legte Gustav Hölscher ein monumentales Werk zu den Propheten vor. Er unternimmt es, die Prophetie im religionsgeschichtlichen Zusammenhang psychologisch zu verstehen.11 In dem der Religionsgeschichte zuzuordnenden Begriff der Ekstase sieht Hölscher die „mit eigentümlichen Begleiterscheinungen verbundene höchste Steigerung der Gemütsbewegung… Die psychischen und physischen Erscheinungen der religiösen Ekstase sind danach keine anderen als die jeder starken Gemütsbewegung“12. In der religiösen Ekstase unterscheidet Hölscher zwischen einer exaltierten und einer apathischen Ekstase. Er sieht exaltierte Ekstase noch bei den Propheten Ezechiel und Jeremia (Ez 6,11; 21,19; Jer 6,11). Ansonsten habe sich das ursprüngliche Schreien und Lärmen zur Kultmusik und ekstatischem Kulttanz entwickelt.13 Die apathische Ekstase sieht Hölscher. vor allem mit dem visionären Erleben eines plötzlichen Reizes verbunden, die zu Zittern und Lähmungen führen kann; auch das Hinfallen in der Vision sei ein wiederkehrendes Moment.14
Hölscher sieht als zweite Wurzel des israelitischen Propheten- und Sehertums die ältere Mantik an, die aus dem primitiven Seelenglauben und Zauberkult erwächst.15 Aus dem älteren Zauberpriestertum entstanden das höhere Priestertum der geschichtlichen Zeit und das freie Wahrsagertum, zu dem Bileam, Deborah, Samuel, Gad, Natan und Ahija gehören. Von daher unterscheidet er zwischen Prophet und Seher, wobei der Titel „Nabi“ das ursprüngliche Sehertum überformt habe (s. 1 Sam 9,9). Während es sich bei dem „Nabi“ um einen erregten Ekstatiker handele, hat der „Seher“ seine Schau ohne Ekstase.
Das ekstatische Prophetentum ortet Hölscher im syrisch-kleinasiatischen Raum, von wo aus die Nordstämme Israels diese Art der Prophetie übernommen haben. Dabei sieht er die Nebiim in Verbindung mit dem Kultpersonal an den Heiligtümern; dort unterstehen sie der Disziplin des aufsichtführenden Priesters (Am 7,10 ff.; Jer 20,1 ff.; 29,26). Auch die Begeisterungsmantik, die zu unterscheiden sei vom gewöhnlichen Wahrsager- und Sehertum, ist aus den Baalkulten in den Jhwh-Kult eingedrungen. Ihr Kennzeichen ist, dass während der Ekstase Gott durch den Mantiker spricht. Aus dem ekstatischen Tanz erklärt sich die Tendenz zur Gruppenbildung, an deren Spitze ein angesehener Prophet steht. Hölscher sieht hier Ähnlichkeiten zu den Derwischorden. „Die professionelle Pflege der Begeisterungsmantik in den Prophetengenossenschaften führte von selber zu einer Annäherung und nahen Berührung mit anderen Formen der Mantik und Magie, die nun neben der ekstatischen Rede bei den Profeten vielfach berufsmäßig geübt, gelehrt und tradiert wurden.“16 Die Wundertätigkeit der Prophetie stammt aus dieser Wurzel. Von den alten Wahrsagern und Zauberern wurde auch der Titel „Gottesmann“ übernommen.17
Große Prophetie zeichnet sich dadurch aus, dass sie aus eigener Initiative auftritt und mit ihrer Prophetie selbstständig in die Politik eingreift wie z.B. Micha ben Jimla in 1 Kön 22. „Hier wurde aus dem Mute persönlicher Wahrhaftigkeit die große Profetie geboren, die auch vor Königstronen sich behauptete.“18
Die Reformen der alten israelitischen Religion wurden nicht allein von Propheten getragen, sie brachten auch nichts grundsätzlich Neues. Trotzdem sei mit Amos Neues eingetreten. „Das Neue bei Amos und seinen Nachfolgern ist die logische Kraft der Zusammenfassung der zerstreuten Teile zum Ganzen, die Erkenntnis des großen göttlichen Gesetzes in der Flucht der Erscheinungen, die klare theoretische Fassung und Durchsetzung dieses Gedankens… Vor der Klarheit ihres Denkens schwindet mehr und mehr das altertümliche Wesen der ekstatischen Mantiker. Sie sind nicht mehr willenlose Verzückte, die im Taumel Einzelauskünfte über die verborgenen Absichten und Launen der Gottheit geben, sondern feierliche klardenkende Verkünder einer großen einheitlichen Anschauung“19.
Kritisch ist hier anzumerken, dass dieses Bild eines Propheten doch sehr an einen deutschen Professor der Kaiserzeit erinnert.
Der Blick in das Innenleben der Propheten und die religionsgeschichtliche Einordnung wurde in der Folgezeit weiter diskutiert, ohne dass hier auf die Einzelheiten eingegangen werden muss.20
Von einer anderen Richtung her hat Sigmund Mowinckel die Prophetenforschung vorangetrieben. Beim Studium der Psalmen kam er zu der Auffassung, dass es in Israel Kultpropheten gegeben habe.21 Im Psalter begegnet in etlichen Fällen Gottesrede. Dies entspreche nicht einer fiktiven literarischen Einkleidung, sondern sei auf dem Hintergrund, dass die Psalmen für den Kult verwendet wurden, als eine kultische Realität zu verstehen. „Wenn die prophetischen Stücke im Psalter eine kultische Wirklichkeit voraussetzen, so will das besagen, daß die Mitteilung göttlicher Antworten einen festen Platz im Kulte gehabt haben muß.“22 Diese Antworten wurden von Kultpropheten vorgetragen. Als persönliche Bedingung des Kultpropheten ist eine besondere Ausrüstung, die in einer Machtbegabung und in Inspiration besteht, anzunehmen. Im Psalter zeige sich nicht der Orakelstil der Priester, die tôrot verkünden, sondern der nabiistische Orakelstil, dessen charakteristische Form das vom Geist oder Jhwh getragene rhythmische Wort ist, in dem Jhwh in der ersten Person redet. Nach Mowinckel ist unter Verweis auf Dtn 18,9 ff. der Nabi als der eigentliche Träger der göttlichen Offenbarung zu sehen. Dabei geht er wie Hölscher (s.o.) davon aus, dass das Nabitum kanaanäischer Herkunft sei und ein Seherpriestertum ursprünglich israelitisch gewesen ist. Der Typus liege vor allem in Samuel vor, aber auch bei Mose. Beide sind erst später als „Nabi“ bezeichnet worden. Dieser Typus sei priesterlich tätig gewesen (1 Sam 3; 9 f.; Num 12; Ex 18; 24,8; 33,7 ff.). Auch das Nabitum habe Nähe zum Kult gehabt, obwohl es sich nicht um Priester handele.23 Dies entspricht auch den Verhältnissen in Babylon, wo es barû und maḫḫû gibt Die Kultpropheten der vorexilischen Zeit sind nachexilisch in die Leviten und Tempelsänger aufgenommen worden. Erst in makkabäischer Zeit sind sie verschwunden. Als Kultpropheten sind die Schriftpropheten Haggai und Sacharja wie auch Habakuk und Joel anzusehen.
Mit der Frage der Kultprophetie ist ein Themenfeld eröffnet worden, dessen Diskussion bis heute nicht abgeschlossen ist.24
In der Prophetenforschung stellte sich nicht nur die Frage nach der ipsissima vox der prophetischen Persönlichkeit und ihrem Innenleben; auch die Frage ihrer sozialen Rolle ist damit gegeben.
Ein wichtiger Impuls in dieser Frage gab ein Mann außerhalb der Exegetenzunft: der Nationalökonom Max Weber. Er sieht in dem Propheten einen Charismatiker. Es handelt sich um ein individuelles Charisma, das in außergewöhnlichen persönlichen Eigenschaften wurzelt, nicht in einer sozialen Rolle. „Wir wollen hier unter einem ‚Propheten‘ verstehen einen rein persönlichen Charismaträger, der kraft seiner Mission eine religiöse Lehre oder einen göttlichen Befehl verkündet“25. Dazu gehört eine persönliche Berufung. Die charismatische Herrschaftsform, zu der der Prophet berufen wird, führt ihn zur Verkündigung einer religiösen Lehre oder eines göttlichen Befehls. Dem korrespondiert die Bildung einer Jüngerschaft. Der israelitische Unheilsprophet steht im Gegensatz zu den herrschenden Eliten und hat eher eine destabilisierende gesellschaftliche Funktion. Er unterscheidet sich klar vom Priester und gehört wie die gesamte vorderorientalische Prophetie zum ethischen Typus.
In religionshistorischer Betrachtung, die Max Weber in seiner Schrift über das antike Judentum entfaltet, sieht er die Wurzel der Prophetie in der Kriegsekstase. Nach dem Aufkommen des Berufsheeres durch das Königtum entwickeln sich die Propheten von Amos an (mit Elija als Vorläufer) zu politischen Demagogen und Pamphletisten. Sie leisteten einen Beitrag zur Rationalisierung der israelitischen Religion, obwohl auch sie noch in den prophetischen Zeichenhandlungen ihre Wurzeln in magischen Handlungen wie die alten Zauberer ausdrücken können.
Alfred Jepsen gibt seiner Studie zu dem Begriff „Nabi“ den Untertitel „Soziologische Studien zur alttestamentarischen Literatur und Religionsgeschichte“26. Er unternimmt damit eine Einzeluntersuchung zu einem zentralen Begriff der Prophetie, eben dem Titel „Nabi“. Ausgehend vom Verb נבא, das im Hitpael wie im Niphal vorkommt, konstruiert Jepsen eine Geschichte, die um 800 v. Chr. mit der gemeinsamen Bedeutung „rasen“ für die beiden Stammformen beginnt, sich dann ausdifferenziert in der Zeit von 750 bis 550 v. Chr., wobei das Hitpael die Bedeutung „rasen“ behält, im Niphal dagegen die Bedeutung „verkündigen“ annimmt, um dann ab 550 v. Chr. gemeinsam „verkündigen“ zu bedeuten.27 Dem korrespondiert eine Entwicklung des Nabitums, die zunächst klar festhält, dass das Nabitum wie schon bei Hölscher einen kanaanäischen Ursprung besitzt, sich dann im Südreich als Hofprophetie, im Nordreich dagegen als freie Prophetie etabliert.28 Nach dem Ende des Nordreiches gelangen freie Nebiim in das Südreich; dabei ist es möglich, dass es auch in Juda freie, auf dem Land ansässige Nebiim gegeben hat, von denen aber kaum Spuren vorhanden sind.29 Jepsen lehnt eine eigenständige israelitische Sehertradition vehement ab; die Bezeichnungen ראה und חזה treten stets in Verbindung mit „Nabi“ auf, sind also als Synonyme aufzufassen. Dabei betone ראה die Art des Empfangs der Botschaft, חזח den allgemeinen Terminus für die nebiistische Wahrnehmung.30
Abraham Heschel legt 1936 aus jüdischer Perspektive eine Studie zum prophetischen Bewußtsein vor.31 Darin lehnt er die Ekstase als Deutekategorie für das prophetische Bewusstsein ab. Sie sei im heidnischen Kult verwurzelt und strebe nach Vereinigung mit der Gottheit. Für Heschel ergibt sich ein anderer Zugang: „Wenn auch in erster Linie praktische Erfüllung gefordert wurde, so ist die innerliche Teilnahme des Propheten am göttlichen Pathos… die zentrale persönliche Tatsache ihres Lebens. Nicht das Wort, das Gesetz an sich, sondern das Pathos Gottes stand im Mittelpunkt der prophetischen Religiosität.“32 Er vergleicht diesen Zustand mit der dichterischen Inspiration.33
Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber wendet sich dem Glauben der Propheten zu.34 Den Kern dieses Glaubens sieht Buber in der existentiellen Begegnung von Gott und Mensch. Gott ruft den Menschen zur Entscheidung, der Mensch antwortet und Gott urteilt. Dies gilt für die Anfänge der Prophetie bis hin zu Deuterojesaja. Diese Begegnung ist existentiell und geschichtlich zugleich. Schon von Abraham an finden sich die drei Elemente dieses Glaubens: das führende Mitgehen Gottes, das liebende Sichhergeben im Volk und die eifernde Forderung der Entscheidung. Der Glaube entfaltet sich dann in konkreten geschichtlichen Situationen. Historisch zeigt sich der Glaube zuerst bei der Prophetin Debora, der Ursprung liegt jedoch schon bei Josua (Jos 24) und Mose. Zurückblickend erscheint dieser Glaube auch schon bei den Patriarchen, dem Exodus, der Sesshaftwerdung Israels und den großen Spannungen in der Anfangszeit der Monarchie. Eine Wendung zum Kommenden zeigt sich dann bei Amos, Hosea und Jesaja; dies ist verbunden mit einer Zuwendung hin zum Gott der Leidenden in Micha, Jeremia, Ezechiel und Deuterojesaja wie auch bei Ijob und in Ps 73.
1.2 Parallelen zur Prophetie in der Umwelt Israels
Während die Person der biblischen Propheten im Zentrum des Interesses stand, war sich die biblische Überlieferung stets bewusst, dass es neben den Propheten Jhwhs in Israel auch Propheten außerhalb Israels gegeben hat und ebenso, dass es nicht nur Propheten des Gottes Jhwh gab. In Jer 27 wird Jeremia von Jhwh mit einer Botschaft über die in Jerusalem versammelten Gesandten der Nachbarvölker Judas an die Könige von Edom, Moab, Ammon sowie von Tyrus und Sidon beauftragt. Sie werden in V9 ermahnt, nicht auf ihre Propheten (נביאיכם) und andere divinatorischen Spezialisten zu hören, die sich dafür aussprechen, dem babylonischen König Widerstand entgegenzusetzen.35 In Num 22,5 lässt der moabitische König Balak Bileam aus einem entfernten Land rufen, um Israel zu verfluchen.36 Interessanterweise wird der „Ausländer“ Bileam von Jhwh zu seiner Botschaft ermächtigt; umgekehrt gibt es auch Propheten, die im Namen anderer Götter auftreten: Im Namen Baals und Ascheras in 1 Kön 18,19 ff. sowie in Jer 2,8. In Jes 2,6 werden die Philister mit Zeichendeutern (עננים) in Verbindung gebracht.37 Demnach sahen schon die biblischen Tradentinnen und Tradenten das Phänomen der Prophetie nicht als alleiniges Kennzeichen Israels an.
Insgesamt war jedoch das Urteil vorherrschend, dass die Prophetie Israels, insbesondere die Schriftprophetie, im Alten Orient keine adäquate Entsprechung habe.38
Julius Wellhausen hat schon früh auf Entsprechungen im vorislamischen Arabertum hingewiesen. Nach ihm gibt es Ähnlichkeiten zwischen dem altisraelitischen Seher und dem arabischen kâhin.39 Auch W.R. Smith machte auf Parallelen im griechischen und arabischen Bereich aufmerksam, wobei er jedoch diese Entsprechungen als irrelevant für die Schriftprophetie erklärte.40
Erst mit der Entdeckung der Texte aus Mari, die einem königlichen Archiv, vor allem aus der Zeit der letzten Könige von Mari, Zimri-Lim (1775–1761 v. Chr.) und Jasmaḫ-Addu (1792–1773 v. Chr.), entstammen, wurde ein vergleichbares Phänomen zur biblischen Prophetie sichtbar.41 Vorherrschend war jedoch immer noch die Unvergleichbarkeit zur biblisch bezeugten Prophetie. Noch 1966 kommt Friedrich Nötscher in einem Überblick der Prophetie im Umkreis Israels auf dem Hintergrund der damals veröffentlichten fünf Briefe zu der Feststellung: „Der Inhalt der Gottesbotschaften mag, gemessen an den religiös-sittlichen Forderungen der atl. Propheten, äußerlich und unbedeutend erscheinen, er wird aber von den Beteiligten offenbar sehr wichtig genommen.“42. Hier zeigt sich deutlich eine bibelzentrierte Sicht, die heute nicht mehr angebracht ist.43
In dem am häufigsten in den Briefen von Mari erwähnten Titel muḫḫûm bzw. dem weiblichen Pendant muḫḫūtum wurde aufgrund des etymologischen Zusammenhanges mit dem Verb maḫû, das „rasen“ bedeutet,44 eine Parallele zum israelitischen nābîc gesehen; Gleiches gilt für den Titel āpilum / āpiltum, der wohl von der ursprünglichen Wortbedeutung her als „Übersetzer“ oder „Sprecher“45 zu bezeichnen ist.
Neben diesen beiden Titeln und ihren weiblichen Entsprechungen begegnen noch andere Titel, die mit prophetischen Handlungen in Verbindung gebracht werden. Dazu gehören assinnu, qammatum und nabû46 sowie bārû, der vor allem mit der technischen Divination der Eingeweideschau betraut ist. Stökl sieht keine Verbindung zu dem meist mit „Seher“ übersetzten bārû. Er meint: „I will not consider the bārû (‚seer‘) in this study, as, being a technical diviner, he is not involved in intuitive divination.“47. Im Lauf der weiteren Untersuchung wird deutlich werden, dass die Trennung zwischen technischer und intuitiver Divination nicht länger haltbar ist und ebenso magische Elemente mit Prophetie verbunden sind. Von daher müssen sowohl bārû als auch der Beschwörer āšipu in einen Vergleich mit der biblischen Prophetie zukünftig einbezogen werden. Die maßgeblichen Veröffentlichungen für die Vergleichstexte aus Mari stellen unter der Voraussetzung eines zu engen Prophetiebegriffes die „Archives épistolaires de Mari“ von Jean-Marie Durand und Dominique Charpin dar.48
Etwa aus der gleichen Zeit wie die Texte aus Mari stammen zwei Orakel, die an IIbāl-pī-El II., den König von Ešnunna (1778–1765 v. Chr.), gerichtet sind.49 Es handelt sich um ein Orakel der Göttin Kititum, die wohl eine lokale Manifestation der Göttin Ištar darstellt. Dieses Orakel ist wohl im Tempel in Nērebtum (= Išḫali) ergangen. Eine menschliche Mittlertätigkeit wird nicht erwähnt, aber ist wohl vorauszusetzen.50 Inhaltlich handelt es sich um ein Heilsorakel.51
Ein zweites großes Corpus von prophetischen Texten liegt in der so genannten „Neuassyrischen Prophetie“ vor. Die Texte waren schon teils seit dem 19. Jahrhundert bekannt, jedoch nur selten mit prophetischen Phänomenen verbunden worden.52 Dies änderte sich erst in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Für den deutschsprachigen Raum ist hier vor allem Manfred Weippert zu nennen, der anlässlich eines Kolloquiums einen Vortrag unter dem Thema „Assyrische Prophetien der Zeit Asarhaddons und Assurbanipals“ veröffentlichte.53 Die maßgebliche Textedition wurde dann erst 1997 von Simo Parpola veröffentlicht, mit einer Ergänzung von Martti Nissinen durch weitere neuassyrische Texte, die das Phänomen der neuassyrischen Prophetie beleuchten.54
Wichtige Titel für den prophetischen Bereich sind raggimu / raggintu und maḫḫû / maḫḫûtu.55
Anders als in den Texten von Mari liegen Prophezeiungen in der neuassyrischen Periode auch in Sammeltafeln vor, die einen Einblick geben können in den Verschriftlichungsprozess von Prophezeiungen. Auch hier stellt sich allerdings wie bei den Texten von Mari die Frage, dass bei einem Vergleich mit der biblischen Prophetie der gesamte divinatorische Bereich einschließlich der technischen Divination einbezogen werden sollte. Gerade die neuassyrische Prophetie bietet sich aufgrund der zeitlichen Nähe zu dem biblischen Phänomen als Vergleichsobjekt an.56
Neben diesen umfangreichen Corpora aus altbabylonischer und neuassyrischer Zeit gibt es im keilschriftlichen Traditionsbereich noch weitere Zeugnisse prophetisch-divinatorischen Handelns, die deutlich machen, dass dieses Phänomen sich nicht begrenzen lässt auf wenige Orte bzw. eine bestimmte Zeit.
In einer Anweisung des Königs von Ur, bei dem es sich wahrscheinlich um Amar-Sîn (2046–2038 v. Chr.) handelt, wird der Gouverneur Ur-Lisi von Umma aufgefordert, einem namentlich nicht genannten muḫḫûm der Göttin eine Ration Getreide zu liefern.57 Dieser Text stammt aus dem 21. Jahrhundert v. Chr. Weitere von Nissinen aufgeführte Texte der altbabylonischen Epoche erwähnen den Titel muḫḫûm / muḫḫātum, einer der Empfänger ist ein muḫḫûm des Gottes Adad von Aleppo. Dabei zeigt sich eine mehr oder weniger starke Bindung an einen Tempel.58
In mehreren Texten werden „Propheten“ als Zeugen benannt.59 Die Beziehung zum Kult wird dokumentiert in einer mittelassyrischen Liste, in der muḫḫûm neben assinnu auftaucht; die institutionelle Beziehung zu den assinnu und anderen gender-neutralen Personen wie den kurgarrû zeigt sich in einer Liste aus neubabylonischer Zeit.60
Prophetie in altbabylonischer Zeit ist auch belegt in einem Dialog zwischen einem Propheten, der hier keinen Titel erhält und nicht namentlich genannt ist und der Göttin Nanaya von Uruk sowie ebenfalls in einem Text aus Kiš.61 Beate Pongratz-Leisten zieht das Fazit: „Auch wenn sich das bisherige Textmaterial in der altbabylonischen Zeit bisher auf Textzeugen aus Uruk, Kiš, Babylon und Ešnunna beschränkt, legen diese doch Zeugnis von einer etablierten Institution des Orakels auch in Zentralmesopotamien ab, die der Beleglage im westsemitischen und syrisch-hethitischen Bereich entspricht. Zwar setzen die Belege erst wieder mit Asarhaddon im 7. Jahrhundert v. Chr. verstärkt ein, jedoch sind die vereinzelten Hinweise dahingehend zu werten, daß das Orakelwesen durch die Zeiten hindurch weiter existierte“62.
Innerhalb der Amarna-Korrespondenz wird in einem Brief des Königs Tušrattu von Mitanni an seinen Schwiegersohn Pharao Amenophis III. (1390–1352 v. Chr.) ein Orakel der Göttin Šauška von Ninive erwähnt.63 Die Göttin will nach Ägypten und wieder zurück. Diesem Wunsch entspricht Tušrattu. Wie dieses Orakel zustande gekommen ist, wird nicht näher erläutert; eine wie auch immer geartete Vermittlung dieses Wunsches muss aber vorausgesetzt werden.
Räumlich näher ist ein Text in akkadischer Sprache, der in Ugarit gefunden wurde. Er erwähnt neben verschiedenen Divinationsarten auch den Titel maḫḫûm und verbindet mit ihm das Baden im Blut, d.h. wohl außergewöhnliche Bewusstseinszustände, vielleicht auch Selbstverwundungen.64
Damit nähern wir uns der südlichen Levante, wo es etliche – allerdings vereinzelte – Textzeugnisse gibt, die sich mit biblischer Prophetie vergleichen lassen.
Das erste Zeugnis ist ein ägyptischer Text in hieratischer Schrift, der aus dem 11. Jahrhundert v. Chr. stammt.65 Der Text berichtet von der Reise des Tempelbeamten Wenamun im Auftrag des Gottes Amun an die syrische Küste, um Bauholz für den Bau einer Barke zu besorgen. Die Reise führt zunächst nach Dor und dann nach Byblos; der Text endet abrupt mit einem Aufenthalt von Wenamun in Zypern. Weder in Dor noch in Byblos stößt das Anliegen Wenamuns auf Gegenliebe; erst das Auftreten eines jungen Mannes in einem alternierenden Bewusstseinszustand gibt klar den Auftrag Amuns an Wenamun wieder. Die Bezeichnung des Ekstatikers (cḏdꜤꜢ) ist wörtlich eigentlich als „großer Junge“ zu übersetzen. Am wahrscheinlichsten ist, dass es sich hierbei um ein semitisches Lehnwort handelt, das auch in der Stele des Zakkur vorkommt.66
Seit der Entdeckung des Textes ist umstritten, inwieweit er als historisch oder fiktiv anzusehen ist. Die Studie von Schipper macht deutlich, dass dieser Text weder nach der einen noch nach der anderen Seite hin aufzulösen ist. „Von daher erweist sich die Erzählung des Wenamun als ein Literaturwerk, das im Spannungsfeld von Politik, Geschichte und Religion zu verorten ist. Es handelt sich um einen theo-politischen Text, der klare historische Bezüge erkennen läßt und einer konkreten Situation in der frühen Dritten Zwischenzeit zugeordnet werden kann“67.
Näher an die Zeit der biblischen Prophetie führt ein aramäischer Text. Es handelt sich um die Siegesstele des Königs Zakkur von Hamath und Lucaš.68 Ihre Entstehungszeit ist gegen 800 v. Chr. anzusetzen; Anlass war der Sieg König Zakkurs über eine Koalition von 17 Königen, die von Bar-Hadad III. von Damaskus angeführt wurde.69 Diese Stele, die vor dem Gott Ilu-wer wahrscheinlich in Tel Afis (= Hazrak) aufgestellt wurde, beschreibt die Unterstützung, die König Zakkur vor allem durch die Gottheit Bacalšamem erfahren hat. Dieser Beistand ist durch prophetische Gestalten vermittelt worden. In Zeile 11–12 heißt es:
„Aber ich erhob meine Hände zu Becelsche[may]n, worauf Becelschemay[n] mir antwortete… Becelschmayn [wandte sich] zu mir [b]yd. ḥzyn. wbyd. cdd[n].
ḥzyn – „Seher“ ist auch biblisch als Titel für prophetische Gestalten belegt: 2 Sam 24,11; 2 Kön 17,13; Jes 30,10; Am 7,12; Mi 3,7; 1 Chr 21,9 u.ö; er verweist auf das vielfach mit der Prophetie verbundene visionäre Geschehen.70 Funktionell ist er auf der biblischen Ebene nicht von einem nābî՚ zu unterscheiden.71
Schwierig ist der zweite Ausdruck cdd[n]. zu bestimmen. Die größte Zustimmung hat die Übersetzung mit „messenger“ bzw. „Bote“ gefunden, wobei Ross eine Nähe zur akkadischen Bezeichnung apilum – „Antworter“ erkennt.72 Jedoch ist auch diese funktionale Bestimmung spekulativ. Barstad stellt zu Recht fest, dass diese Bezeichnung etwas zu tun hat mit divinatorischen Phänomenen.73 Aussagen darüber hinaus sind kaum möglich. Wenn der Titel in der Wenamun-Erzählung tatsächlich ein semitisches Fremdwort ist, dann kann man annehmen, dass auch alternierende Bewusstseinszustände mit dieser Bezeichnung verbunden sein können (s.o.). Ob eine Verbindung von cddn mit dem meist als Namen gelesenen côded (2 Chr 15,1; vgl. 2 Chr 15,8; 28,9) bzw. cIddô (2 Chr 12,15; 13,22) vorliegt und côded in 2 Chr 15,1.8; 28,9 als Appellativum gelesen werden kann, ist unwahrscheinlich. côded ist kein biblisch belegter Titel für einen Propheten bzw. Divinator.74
Die Einleitung der Gottesbotschaft in Zeile 13 mit ՚l t[z]ḥl – „Fürchte dich nicht“ entspricht biblischem Sprachgebrauch und ist ebenso in der neuassyrischen Prophetie beheimatet. Es handelt sich um ein „Erhörungs- und Beistandsorakel“75. Insofern entspricht diese Prophetie der auch in Mari und in der neuassyrischen Prophetie anzutreffenden Unterstützung der jeweiligen königlichen Dynastie.76 In dieses Bild fügt sich auch die einleitende Bemerkung, dass Bacalšamem Zakkur zum König gemacht habe (Z. 3). Auch hier sind menschliche Vermittler anzunehmen. Es liegt nahe, an prophetisch-divinatorischen Gestalten zu denken, die vermittelnd am Werk sind. Diese Funktion steht im Einklang mit der biblisch bezeugten Prophetie. (z.B. 1 Sam 9 f.,16; 1 Kön 1–2; 11,29 ff.; 2 Kön 9–10).
1976 wurden bei Ausgrabungen in Deir cAlla im Jordangraben in einem wahrscheinlich durch Erdbeben zerstörten Raum die Reste einer auf Verputz mit schwarzer und roter Tinte aufgetragenen Inschrift gefunden, die die auch aus der Bibel bekannte prophetische Gestalt des Bileam erwähnt.77 Die genaue Rekonstruktion des Textes ist Gegenstand der wissenschaftlichen Debatte. Im Wesentlichen sind es zwei Textteile, Kombination A,78 in der Bileam die zentrale Figur ist und Kombination B, die man wohl am ehesten mit Blum als „Weisheitlicher Dialog über Vergänglichkeit und Verantwortung“ bezeichnen kann. Der Text der Kombination I beginnt mit „Warnungen79 der Schrift (ספר) von Bileam“. Dies deutet auf eine Schriftrolle hin. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass der Text von einer Schriftrolle auf den Verputz übertragen wurde.80
Der Raum, in dem die Inschrift gefunden wurde, gehört zu Phase IX. Die materielle Hinterlassenschaft und Radiokarbon Analysen ordnen diese Phase am ehesten der Zeit um 800 v. Chr. Zu.81 Nimmt man hinzu, dass DAPT wohl von einem vorgegebenen Text kopiert wurde, dessen Alter nicht zu bestimmen ist, ist es möglich, dass dieser Text noch zum ausgehenden 9. Jahrhundert gehört, auf jeden Fall aber der terminus ad quem um 750 v. Chr. anzusetzen ist.82 Demzufolge liegt mit DAPT ein Text vor, der gleichzeitig mit der israelitischen Prophetie ist, der Schriftprophetie zeitgenössisch ist oder ihr sogar vorausliegt.
Die Einordnung der Sprache von DAPT ist nicht ganz klar.83 Neuerdings hat sich Blum aufgrund der in den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts entdeckten Tel Dan Stele entschieden für „Aramäisch“ ausgesprochen, das in Damaskus entwickelt wurde.84 Auch Schüle sieht die Nähe zum Aramäischen, jedoch nicht zu dem Aramäisch der Stadtstaaten im Norden.85 So wird man am ehesten an lokale Entwicklungen mit Bezug zum Aramäischen denken können.
Details
- Pages
- 292
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631919439
- ISBN (ePUB)
- 9783631919446
- ISBN (Hardcover)
- 9783631919422
- DOI
- 10.3726/b21908
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (November)
- Keywords
- Altes Testament Deuteronomium Pentateuch Mose Magie Mantik Bibel Christentum
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 292 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG