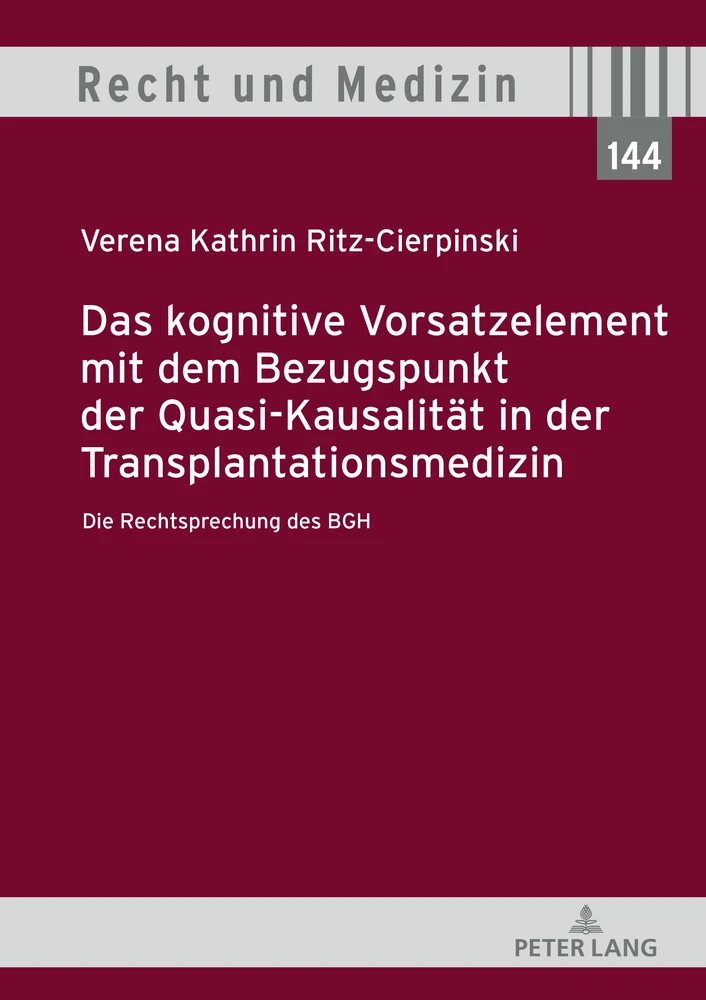Das kognitive Vorsatzelement mit dem Bezugspunkt der Quasi-Kausalität in der Transplantationsmedizin – Die Rechtsprechung des BGH –
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Abkürzungen
- Abkürzungen
- A) EINLEITUNG UND PROBLEMAUFRISS
- I. Einleitung
- II. Die widerstreitende Rechtsprechung und offene Fragen
- III. Ablauf des Transplantationsverfahrens
- IV. Zu den einzelnen Fällen im Transplantationsskandal
- B) ANALYSE
- I. Der dolus eventualis und seine Anforderungen
- 1. Definition und ratio des dolus eventualis
- 2. Der dolus eventualis in der Rechtsprechungspraxis
- 3. Der dolus eventualis beim Transplantations-Fall
- 4. Die vom 5. Senat zum Vorsatz zitierte Rechtsprechung
- 5. Der dolus eventualis im Tatentschluss
- 6. Zwischenfazit
- II. (Quasi-)Kausalität im objektiven Tatbestand als Bezugspunkt des Vorsatzes
- 1. Einordnung der Sicherheitsklausel
- 2. Kausalitätsdogmatik und Anwendung auf den Transplantations-Fall
- 3. Zwischenfazit
- III. Abweichung von der Spiegelbildfunktion des Vorsatzes
- C) Fazit
- Literatur
A) EINLEITUNG UND PROBLEMAUFRISS
I. Einleitung
Zwei Juristen, drei Meinungen – Zwei Ärzte, drei Meinungen.
Eine Gemeinsamkeit von Juristen1 und Ärzten ist es, dass beiden die sinnhaft gleiche Redewendung auf den fachlich versierten Leib geschrieben wird.
Kombiniert man diese nun im Rahmen eines interdisziplinären Austauschs, wenn Denkweisen über einen Fachbereich hinaus in Verständigungsprozesse gebracht werden müssen, ist die Auswirkung der Potenzierungen, jedenfalls für eine geneigte Juristin, kaum bezifferbar.
Gesetzgeber und Gesetzesanwender sehen sich im Bereich des Medizinrechts vor ein Spannungsfeld von primär unterschiedlichen Sichtweisen gestellt. Für den Arzt bedeutet das Heil des Kranken als oberstes Gesetz (salus aegroti suprem lex), dass sein Wille diesem zu helfen primär prognostisch geprägt und auf einen künftigen, oftmals nur unter Inkaufnahme von Risiken geprägten Heilungserfolg gerichtet ist. Eine nicht erfolgreiche Behandlung wird daher auch als Resultat der Komplexität des Lebens eingestuft.
Der Jurist hingegen sieht den Willen des freiverantwortlich handelnden Kranken als oberstes Gesetz (voluntas aegroti suprema lex). Im Fokus stehen hier Steuerung, Kontrolle, und Risikominimierung. Schlägt eine Behandlung fehl, geht es um Vergangenheitsbewältigung und gegebenenfalls um die Suche nach einem Behandlungsfehler.2
Die Konzertierung der unterschiedlichen Interessen wird mit dem Fortschreiten medizinischer und medizintechnischer Erfahrungen und Erkenntnisprozesse stetig komplexer. So zielt bei der Transplantation (TX)3 von Organen die Verantwortung des Arztes neben dem Schutz des Patienten vor, durch oder bei einer Behandlung außerdem darauf ab, für seinen Patienten die Chance auf den Erhalt eines Organs bestmöglich zu bewahren. Dass dieser Zugriff der Ärzte auf fundamentale Rechtgüter der Patienten die Notwendigkeit einer (straf-)rechtlichen Steuerung und Kontrolle birgt, liegt auf der Hand. Zuvörderst jedoch wird dem Gesetzgeber die Aufgabe zuteil, überhaupt erst den Rahmen für eine gerechte Teilhabe bei der Verteilung knapper Güter, nämlich der zur Verfügung stehenden Spenderorgane, zu kreieren.
Mit der in den Medien rasch als „Göttinger Transplantations-Skandal“4 betitelten Aufdeckung der Manipulation von Patientendaten durch einen TX-Arzt im Jahr 2012 wurde diese Problematik in das Licht der Öffentlichkeit geradezu katapultiert. Der Mediziner hatte dabei das Ziel verfolgt, eigenen Patienten schneller ein Organ zu verschaffen, als es den Regelungen für die Wartelisten entsprechend der Fall gewesen wäre.
Bereits die Vorgeschichte dieses Falles birgt einigen Zündstoff.
Der palästinensische Arzt Aiman O. strebt bis zu der Aufdeckung der Vorgänge eine steile Karriere als TX-Mediziner in Deutschland an. Einer der ersten Schritte hierfür ist der Wechsel vom Klinikum in Hannover nach Regensburg, gemeinsam mit seinem Mentor. Hier ist O. als Oberarzt tätig und erreicht 2004 über seine Verbindungen in die arabische Welt eine Kooperation des Uni- Klinikums Regensburg mit dem Jordan-Hospital in Amman. In diesem Rahmen sind O. und sein Mentor auch in Jordanien tätig. Am 29. März 2005 operieren dort beide eine Araberin. Es stellt sich im Laufe der Operation heraus, dass die vor Ort zur Verfügung stehende Teilspende nicht genügt; es wird eine ganze neue Leber benötigt. Die darauffolgenden Ereignisse werden nicht vollständig aufgeklärt. Fest steht, dass O. bei Eurotransplant,5 der Stiftung für internationale Organvermittlung in acht europäischen Ländern6 mit Sitz in Leiden/Niederlande, wahrheitswidrig angibt, die Patientin, die sehr dringend eine neue Leber benötige, befände sich in Regensburg. Mit der daraufhin vermittelten Leber fliegt er nach Amman und transplantiert diese dort. Die Empfängerin verstirbt dennoch. Eurotransplant bemerkt Auffälligkeiten und stellt Erkundigungen an. Über verschiedene Stationen gelangt der Vorgang auf den Tisch der Staatsanwaltschaft. Diese befindet, es sei keine Straftat begangen worden. Es wird spekuliert, dahinterstecke, dass in den bayerischen Ministerien nicht gewünscht werde, dass das wichtige TX-Zentrum Regensburg einen Imageschaden davontrage. In den folgenden Jahren werden dort so viele Lebern transplantiert wie nie zuvor. 2008 wechselt O. nach Göttingen. Am 2. Juli 2011 geht bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) ein anonymer Anruf ein, in dessen Folge ein Jahr später an die Öffentlichkeit gelangt, was dann Gegenstand des Gerichtsverfahrens vor dem LG Göttingen wird, und womit sich schließlich auch der BGH zu befassen hat. Es besteht der Verdacht, dass O. in mindestens 23 Fällen falsche Patientendaten an Eurotransplant gefaxt habe.7
O. wird im November 2011 beurlaubt. Die Vorgänge werden medial heiß diskutiert. Lilie äußert sich 2012 als Professor für Straf-, Strafprozess- und Medizinrecht an der Universität Halle und damaliger Vorsitzender der Ständigen Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer (StäKo) zu dem Göttinger Komplex als schwerwiegendstes ihm bekanntes Fehlverhalten im Bereich der Organ-TX.8 Er habe sich nicht vorstellen können, dass ein Arzt in Deutschland so agiere.9
Die Vorfälle werden zu einer Zäsur in der deutschen TX-Medizin. Ihr Zutagetreten fällt zeitlich zusammen mit der Einführung der Entscheidungslösung in das TPG mit dem Ziel der Erhöhung der stets zu knappen Anzahl an Spenderorganen.10 Die Vorgänge und die darauf folgenden Prozesse gegen O. lösen jedoch einen eklatanten Einbruch der Spendebereitschaft infolge des massiven Vertrauensverlustes der Öffentlichkeit in das System der Organspende aus.
Dabei gesellt sich zu dem ohnehin nicht spannungsfreien Verhältnis von Juristen und Medizinern noch eine höchst emotionsbeladene Diskussion innerhalb der Bevölkerung. „Nur wer jemals einem Menschen gegenüberstand, der auf diese letzte Möglichkeit der Medizin für sich persönlich gehofft hat, wird verstehen, dass unsere Sprache viel zu arm ist, um den Gegensatz zwischen der Todesangst beim Warten auf ein Spenderorgan und der tiefen Dankbarkeit nach einer erfolgreichen Transplantation zu beschreiben“11 – so formuliert Lilie die gänzlich von juristischen Fragen losgelöste Wirklichkeit der Betroffenen.
O. wird 2015 vom Landgericht Göttingen12 von der Anklage wegen versuchten Totschlags freigesprochen. Mit dem Vorwurf, er habe eine versuchte Tötung an den durch seine Falschangaben auf der Warteliste „überholten“ Patienten begangen, hatte die Staatsanwaltschaft juristisches Neuland betreten. 2016 wird die durch sie eingelegte Revision verworfen, der Freispruch durch den BGH13 bestätigt. Das Urteil sorgt erneut für enormes Aufsehen. Es erntet Zuspruch, jedoch durchaus einiges an Kritik. Diese betrifft unter anderem das vom zuständigen Senat angenommene Vorsatzverständnis.
Die Anforderungen des Vorsatzes haben per se nichts mit einer Verknüpfung mit medizinischen Fragen zu tun; sie entstehen, beziehungsweise bestehen, aus der reinen Rechtsdogmatik heraus. Subsumiert werden jedoch über den zugrundeliegenden Sachverhalt eben auch jene Fragen. Hinzukommt dabei eine Verbindung mit der Auslegung weiterer Rechtssätze.
Zurückblickend auf das eingangs angeführte, für Juristen wie Ärzte geltende Zitat treffen hier nun, je nachdem, ob diesem ein positiver Inhalt abgewonnen oder darin eine Kritik gesehen werden möchte, juristische Gestaltungsspielräume und Flexibilität auf umfangreiche medizinische Aufklärungs- und Diagnosemöglichkeiten, oder eben der Vorwurf der Beliebigkeit auf eine Idee von Gesundheit als Glückssache.
Dabei zeigt sich die Herausforderung für Gesetzgeber und Gesetzesanwender, genau abzuwägen und festzustecken, wie eng oder wie weit ein rechtlicher Rahmen für bestimmte Fragen des Medizinrechts, hier insbesondere solche des TPG, idealerweise gesteckt sein sollte. Es muss entschieden werden, ob und inwieweit Gestaltungsfreiräume zugesprochen, oder vielmehr umfangreiche Feinsteuerung betrieben werden sollte.
Mit dem BGH-Urteil endet die strafrichterliche Befassung mit dem Göttinger TX-Fall.14 Jedoch sind mit den Nachwehen der Vorgänge und des Urteils noch weitere Gerichte bis ins Jahr 2023 befasst.
Zunächst bestätigte das OLG Braunschweig15 am 28. Oktober 2020 in einem Berufungsprozess das Urteil des LG Braunschweig16 vom 13. September 2019, das O. einen Schadenersatz in Höhe von 1,16 Millionen Euro gegen das Land Niedersachsen aus dem StrEG zugesprochen hatte. Der größte geltend gemachte Posten der Vermögensschäden, die ihm durch die Untersuchungshaft und weitere Strafverfolgungsmaßnahmen entstanden sein sollen, waren dabei Einnahmeverluste, die ihm durch eine gut dotierte Stelle in Amman (50.000 US-Dollar pro Monat) entgangen seien. Kurz vor der Abreise nach Jordanien war er im Januar 2013 in Deutschland festgenommen und später angeklagt worden.17
O. arbeitet nach eigenen Angaben seit 2017 für das Krankenhaus in Jordanien.18
Am 7. März 2023 hat der 1. Senat des BSG19 entschieden, dass die Krankenkasse das behandelnde Klinikum für eine TX auch dann bezahlen muss, wenn falsche Angaben an Eurotransplant weitergegeben und die Warteliste für Organspenden dadurch manipuliert wurden. Es stehe der Krankenkasse nicht zu, das gezahlte Geld für die vorgenommene Operation zurückzufordern. Unabhängig von straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen stehe es für den Klinikleiter fest, dass die durchgeführten Operationen medizinisch indiziert und einwandfrei durchgeführt worden waren.
II. Die widerstreitende Rechtsprechung und offene Fragen
Am 9. März 2022 hat die sowohl juristisch als auch medial heiß diskutierte Entscheidung des 5. Strafsenates des BGH zum „Göttinger Transplantations-Skandal“ neue, aktuelle Relevanz erfahren. Durch einen Anfragebeschluss des 4. Strafsenates20 nach § 132 III 1 GVG ist die Diskussion um die Anforderungen des kognitiven Vorsatzelementes auf die Quasi-Kausalität neu entflammt.
Der oben bereits dargestellte, dem Urteil im TX-Fall aus dem Jahr 2017 zugrunde liegende Sachverhalt lautet vereinfacht wie folgt. Ein TX- Mediziner manipulierte21 medizinische Daten seiner auf eine Spenderleber wartenden Patienten, um diesen eine höherrangige Einordnung auf der Warteliste für Spenderorgane zuteil werden zu lassen, als diese mit korrekt angegebenen Daten erreicht hätten. Ihm war dabei bewusst, dass dadurch tatsächlich vorrangige Patienten überholt würden.
Prüfungsgegenstand des damaligen 5. Strafsenates des BGH war ein versuchter Totschlag an den überholten Patienten. Im Ergebnis habe es dem Angeklagten laut Urteil jedoch am Tatentschluss gefehlt, genauer am dafür notwendigen kognitiven Element bezüglich der Quasi-Kausalität. Dieses erfordere, dass „dem Täter bewusst sei, dass der Rettungserfolg mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit eintreten würde“.22
Zwar habe es der Angeklagte für „denkbar“23 gehalten, dass einer der überholten Patienten versterben könnte. Jedoch habe er eben nicht mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass bei diesen ihm unbekannten Patienten durch die TX eine Lebensverlängerung erreicht worden wäre, aufgrund des ihm bekannten hohen Sterberisikos bei oder unmittelbar nach einer TX, sowie weiterer Verwerfungen des Allokationsverfahrens.24
Am 19. August 2020 hatte sich der 1. Strafsenat des BGH in einem von der juristischen Öffentlichkeit wenig wahrgenommenen Urteil (Palliativ-Fall)25 explizit ablehnend gegen den vom 5. Strafsenat angenommenen Bezugspunkt des Vorsatzes auf die Quasi-Kausalität geäußert. Konkret ging es dabei um die Anforderungen an das kognitive Element des dolus eventualis mit dem Bezugspunkt der Quasi-Kausalität.
Der 1. Senat hatte sich mit der Prüfung eines versuchten Mordes zu Lasten einer Altenpflegerin zu befassen, nachdem es zu einer Medikamentenverwechslung bei dem palliativmedizinisch versorgten Bewohner eines Pflegeheimes gekommen war. Dabei nutzte der Senat im obiter dictum die Gelegenheit, sich zu den Anforderungen an den Vorsatz bei Quasi-Kausalität zu äußern.
In den redaktionellen Leitsätzen, die dem Urteil zuweilen beim Abdruck oder der digitalen Wiedergabe unter verschiedenen Fundstellen hinzugefügt werden, wird diese Befassung mit der Problematik unter dem Stichwort „Gegenstand des Vorsatzes“ direkt herausgestellt.26
Details
- Pages
- 220
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631922798
- ISBN (ePUB)
- 9783631922804
- ISBN (Hardcover)
- 9783631922576
- DOI
- 10.3726/b22050
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (November)
- Keywords
- Ethik und Recht in der Organspende rechtliche Aufarbeitung der Manipulation von Wartelisten Organspende Organtransplantation „Organspendeskandal“ Gesetzgebung im Bereich Organspende TPG
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 220 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG