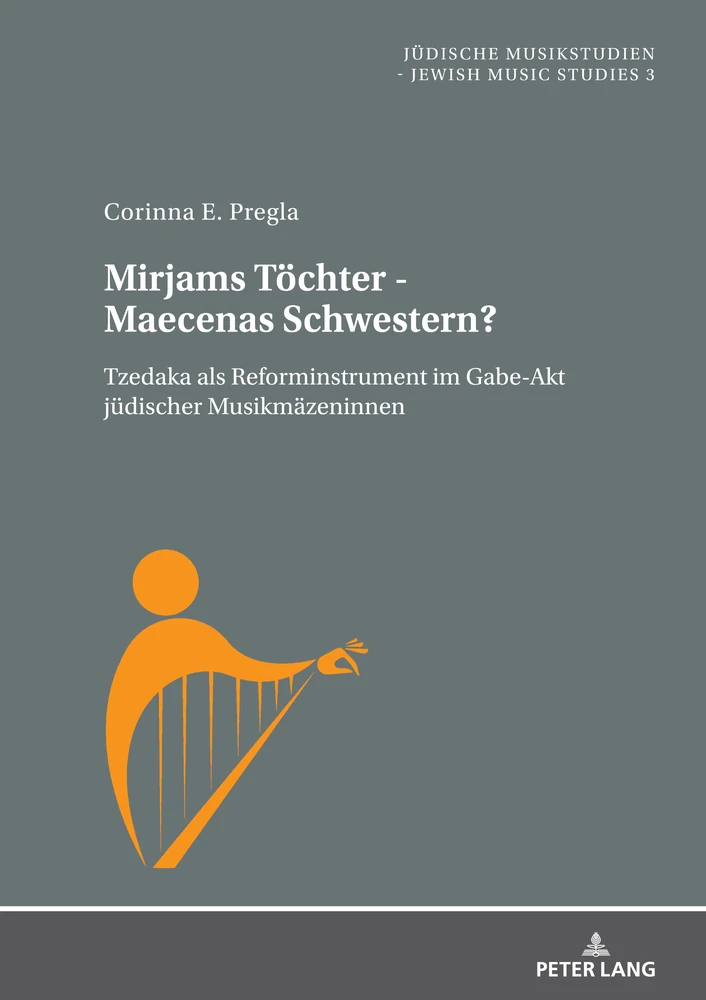Mirjams Töchter - Maecenas Schwestern?
Tzedaka als Reforminstrument im Gabe-Akt jüdischer Musikmäzeninnen
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Dank
- Inhalt
- Einleitung
- 1. Das Neue im tradierten Raum: Mäzenatentum als Förderform und neue Musik als Fördergegenstand
- 1.1 Gaius Cilnius Maecenas: Vom Urbild zum Abbild
- 1.2 Zum Begriff des Neuen in der Musik
- 1.3 Musik als Fördergegenstand
- 1.4 Der Salon als Förderort des Neuen
- 2. Vermögen und Vermögen: Gabe und Weitergabe zwischen philosophischem Phänomen und sozialer Praxis
- 2.1 Selbsterhalt und Humanitas: anthropologische und motivationale Aspekte der Gabe
- 2.2 Tzedaka und Tikkun Olam: Die Gabe als doppelte Handlungsmaxime
- 2.3 Gabe und Weitergabe in den jüdischen Kontexten von Generation, Tradition und Reform
- 3. Mirjams Klang: Weiblichkeit und Musik im Kontext jüdischer Tradierung
- 3.1 Zur Bedeutung von Musik für jüdisch-kulturelle Überlieferungszusammenhänge
- 3.2 Narrative und Performanzen in weiblichen Musik- und Bildungsbezügen
- 3.3 »Tochter der Gebote«: Zu jüdischen Selbst- und Fremdbildern der Weiblichkeit
- 3.4 Intersektionalität als Einflussfaktor weiblich-jüdischen Mäzenatentums
- 4. Zwischen generationalem Auftrag und Autonomie: Sara Levy (1761- 1854)
- 4.1 Spielen, Sammeln, Sichern, Schenken: Formen des Förderns bei Sara Levy
- 4.2 Lieder ohne Worte
- 4.3 Auswahl und Adressiertheit: Gattung und Instrumentation in Sara Levys Musiksammlung
- 4.4 Stimme als Gabe und Gegengabe: Tzedaka im musikmäzenatischen Handeln Sara Levys
- 4.5 Vom Begleiten zur gleichberechtigten Stimme: Doppelte Autonomie als Auftrag
- 5. Zwischen Alter und Neuer Welt: Amalie Beer (1767 - 1854)
- 5.1 Alte Rollen - Neue Bilder
- 5.2 Neue Klänge für die Reformsynagoge
- 5.3 Tikkun Olam zwischen Bethaus und Bühne
- 6. Zwischen Neuer und Alter Welt: Alma Morgenthau Wertheim (1878-1953)
- 6.1. Reform als Erbe
- 6.2 Ambiguität und innere Ordnung
- 6.3 Erbe und Gabe
- 7. Zwischen Autonomie und Experiment: Betty Freeman (1921-2009)
- 7.1 Tikkun Olam und Countercultures: Betty Freemans Biografie im Kontext der Zeit
- 7.2 »On Patronage«: Fünf Selbstpräsentationen einer Musikmäzenin
- 10. Juni 1987, New York: »Speech by Betty Freeman at the American Symphony Orchestra League Award Luncheon - June 10, 1987 Grand Ballroom, Waldorf Astoria, New York City«
- 1. August 1988, Darmstadt: »Betty Freeman Adress at New Music Summer School of the International Music Institute, Darmstadt. August 1, 1988 - - «
- 19. Januar 1990, Kyoto und Tokyo: »A Creative Approach To New Music«
- 5. März 1992, Santa Monica: »On Patronage«
- 21. Juni 2001, Washington D. C.: »Clifford Still 1904-1980«
- 7.3 Musik-mäzenatische Positionierung als dialogisches Aushandeln des Selbst
- »I’ve been a music patron ever since«
- »Composers…the most important people in the world«
- »We owe it to young people to stretch their ears« - »Why should we?«
- 7.4 Aufbruch und Umkehr im musikmäzenatischen Handeln Betty Freemans
- 7.5 Tzedaka-Persistenzen im Zwischenraum
- 8. Mirjams Töchter - Maecenas Schwestern?
- 8.1 Mirjams Töchter: Musik als Sprachersatz
- 8.2 Maecenas Erb*innen: Urbild, Abbild und Abwandlung
- 8.3 Maecenas Schwestern? Tzedaka als Reforminstrument
- 8.4 Tzedaka im musikbezogenen Gabe-Gegengabe-Akt
- 8.5 Die musikmäzenatische Gabe als soziale Aufgabe
- Dem Zwischen Raum geben (Reflexion)
- Bibliographie
Einleitung
Ein Patron (Mäzen), so ist es im Dictionary of the English Language von 1755 zu lesen, sei wie folgt zu definieren: »One who countenances, supports or protects. Commonly a wretch who supports with insolence and is paid with flattery« (Johnson, 1755; Crystal, 2021). Bei dem Verfasser dieser provokanten Definition handelt es sich um keinen Geringeren als den berühmten Schriftsteller und Lexikografen Samuel Johnson (1709-1784). Dem Eintrag war ein empörter Brief vorausgegangen, den er an seinen Mäzen, den 4. Earl of Chesterfield, sendete, um seiner Enttäuschung über dessen mangelnde Unterstützung in von Armut gekennzeichneten Jahren während der Entstehung der Enzyklopädie, einem heutigen Standardwerk, Ausdruck zu verleihen. Erst als sich der Erfolg der Publikation einstellte, so wirft er dem Mäzen vor, habe der Widmungsträger des Werkes sich zu seinem Protegé bekannt (Crystal, 2021).
In deutlichem Kontrast dazu stehen die Worte, die der Musiktheater-Regisseur Max Reinhardt 1923 an seinen Mäzen Otto Hermann Kahn (1867-1934) schrieb: »Was aber sehr wenige Leute außer Ihnen und mir wissen …, daß Ihre geistige und intellektuelle Hilfe mir immer mehr bedeutete als Ihre monetäre Unterstützung. Sie haben mich ermutigt, mein Bestes zu geben ohne mich unkünstlerischen Kompromissen zu beugen…. In tiefster Bewunderung Ihres unerschrockenen Idealismus… Ihr dankbarer Max Reinhardt« (Fuhrich-Leiser & Prossnitz, 1976, S. 99). Und in einer noch umfassenderen, die Dimension der Einzelförderung übersteigenden Würdigung sprach der Dirigent Esa-Pekka Salonen posthum von der Musikmäzenin Betty Freeman (1921-2009): »I cannot think of many individuals whose actions would have had a more profound effect on our art form or culture in general« (Salonen, 2009, zitiert nach Woo, 2009).
Diese kurzen Beispiele historischen Mäzenatentums aus den Bereichen Literatur, Theater und Musik zwischen dem 18. und 21. Jahrhundert, die Probleme und Chancen um Abhängigkeit, Zuverlässigkeit und Tragweite mäzenatischer Gabe-Akte ansprechen, werfen zugleich die Frage auf, welche Faktoren und Bedingungen es sind, die zu solch unterschiedlichen Förderausprägungen führen. Obgleich Mäzenatentum in Europa eine jahrtausendealte Geschichte hat, blieb eine Kulturgeschichte des Mäzenatentums, die diese Aspekte berücksichtigen könnte, bislang ungeschrieben; was u.a. damit zusammenhängen mag, dass eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Ab-Gabe-Formen und Fördervorstellungen unter der Bezeichnung Mäzenatentum firmieren. Durch die Digitalisierung kommen neue Förderkonzepte wie das Crowdfunding hinzu, welche Selektions-Dynamiken durch 1:1 Beziehungen ganz generell infrage stellen. Sie werden heute, bezogen auf die Ermöglichung und Verbreitung von Musik, unter anderem als Demokratisierungsinstrumente eines hierarchisch strukturierten (Klassik-)Musikbetriebs diskutiert (vgl. Lehmann, 2012). Es stellt sich mithin die Frage, ob bei einem möglichen Aussterben herkömmlichen Mäzenatentums, gerade im Bereich der klassischen Musik, nicht mehr verloren geht als eine Einzelpersonen-zentrierte Fördertradition?
Abhängig von den jeweiligen ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen sind in Europa zeitliche und örtliche Cluster-Bildungen hinsichtlich der Dichte an dezidiert mäzenatisch benannten Förderaktivitäten festzustellen. Mit der europäischen Aufklärung beginnend, findet sich eine solche Konzentration mäzenatischen Gebens z.B. ab Mitte des 18. Jahrhunderts und bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Es fällt bei der hohen Förderfrequenz dieser Zeit zum einen ein spartenübergreifendes Geben in Sozial- Wissenschafts- und Kulturbereichen auf, zum anderen, dass die in diesem zeithistorischen Ausschnitt agierenden Erb*innen des Maecenas überzählig häufig jüdischer Abstammung sind (Zeller, 2006; Schoeps, 2012; Alexander, 1998).
Die sogenannten Berliner Jüdischen Mäzene, die v.a. zwischen dem Kaiserreich und der Weimarer Republik öffentlich und privat ein ungewöhnlich starkes Engagement zeigten, waren keineswegs ausschließlich Männer, doch die fördernden Frauen unter ihnen sind erst in den letzten Jahren zunehmend erforscht bzw. wiederentdeckt worden. Und auch die vorher Benannten kamen erst durch die Forschung der vergangenen rund drei Jahrzehnte vermehrt in das deutsche öffentliche Bewusstsein zurück.1
Etwa zeitgleich rückten die Berliner jüdischen Salonnières in den Fokus der Forschung. Beeinflusst von französischen Vorbildern und hervorgegangen aus der großen jüdischen Gemeinde Berlins, wurden die bereits ab 1780 initiierten Kultursalons dieser Berliner Frauen zu international rezipierten Orten und zu einem Sinnbild weiblich-bürgerlicher Emanzipation (Hertz, 1991; Gradenwitz, 1991; Beci, 2000). Als Pionierin im Bereich der Literatursalons wurde der Name Henriette Herz bekannt, und auch die Impulse einer Rahel Varnhagen fanden hinsichtlich neuer kultureller Kommunikationsformen würdigende Erinnerung in den Geistes- und Kulturwissenschaften des späten 20. Jahrhunderts.2 Das Jüdische Museum New York zeigte 2005 eine Ausstellung mit dem Titel Jewish Women and their Salons (vgl. Bilski & Braun, 2005). 2018 präsentierte das Jüdische Museum in Wien The place to be. Salons als Orte der Emanzipation (vgl. Hanak, Peterle & Spera 2018).
Der von Jüdinnen initiierte Musiksalon in der Zeit der Berliner Haskala, der jüdischen Aufklärungsbewegung, wurde umfassender u.a. im Kontext der Mendelssohn-Forschung dargestellt (u.a. Mendelssohn-Studien 1972-2007; Lackmann, 2005; Schoeps, 2009; Panwitz, 2018). Darüber hinaus finden sich vereinzelt Biographien und digitale Kurzportraits zu historischen und (seltener zu) lebenden Musikmäzeninnen.3 Doch obgleich bekannt ist, dass der Musiksalon nach Berliner Vorbild über seine Blüte zur Zeit der Berliner Haskala hinaus bis in das späte 20. Jahrhundert hinein mit einflussreichen Ausläufern in Europa und den USA fortbestand, ist die Bedeutung der dort konkret aufgeführten Musik, als Instrument für mögliche kulturelle und gesellschaftliche Veränderungsprozesse, bislang kaum betrachtet worden.4 Der Aspekt des weiblich-jüdischen Musiksalons als einem musikmäzenatischen Förderort neuer Musik blieb bislang sogar weitgehend unbeachtet. Lange wurden die Leistungen der Musikmäzeninnen unter den jüdischen Salonnières, die oftmals selbst professionelle Musikerinnen oder engagierte Amateurinnen waren, auf den in seiner wissenschaftlichen Relevanz insgesamt umstrittenen Forschungsbereich einer bürgerlichen Salonkultur reduziert.
Dabei wirft allein die Variable der spezifischen Fördersparte Musik Fragen nach einer u. U. abweichenden mäzenatischen Haltung zur Gabe bei diesen Frauen auf, denn die Förderung und Aufführungsermöglichung gerade neuer Kompositionen ist, mehr als etwa bei der Unterstützung eines literarischen oder bildnerischen Kunstwerks, von Momenthaftigkeit geprägt. Die hier interessierenden jüdischen Musikmäzeninnen unterstützten zudem nicht das der jeweiligen Mode entsprechende Repertoire, sondern sie konzentrierten sich auf die Entstehung und Präsentation noch nicht gehörter Musik sowie auf die Tradierung solcher vergessener Werke, die sie für ein kollektives Musik-Erinnern als relevant erachteten. Auffallend ist, dass die von ihnen protegierten Komponist*innen zu einem überwiegenden Anteil nicht dem Kultur-Establishment ihrer jeweiligen Zeit angehörten, sondern gerade unangepasste und experimentelle Positionen vertraten; mit anderen Worten: oftmals »Außenseiter« waren. Diese Tatsache deutet auf ein Unterstützungs-Interesse der Mäzeninnen, das offenbar abseits gesellschaftlicher Anerkennung respektive vorhersehbarer Ergebnisse angesiedelt war.
Auch ein möglicher Zusammenhang zwischen dem spezifischen Musikhandeln dieser Frauen und ihrem kulturell jüdischen Erfahrungshorizont wurde, besonders hinsichtlich zweier prägnanter Aspekte, bislang noch nicht untersucht: zum einen in Bezug auf die Sozialtradition der Tzedaka-Abgabe als einer jahrtausendealten spezifisch-jüdischen Gabe-Tradition, zum anderen in Bezug auf ihren übereinstimmenden aschkenasischen Prägungshintergrund. Letztere ethnisch-religiöse Zugehörigkeit verbindet deutsche und osteuropäische Jüdinnen und Juden und unterscheidet sich fundamental von Prägungsformen anderer jüdischer Kulturen in der Welt (Lowenstein, 1997).
Als Primi inter pares weisen die Musikmäzeninnen Sara Levy (1761-1854) und Amalie Beer (1767-1854) als Repräsentantinnen der Salonnières zur Zeit der Berliner Haskala sowie Alma Morgenthau Wertheim (1878 -1953) und Betty Freeman (1921-2009), zwei Nachfahrinnen deutsch-osteuropäisch-stämmiger jüdischer Einwanderer-Familien in die USA, das zuvor beschriebene Profil auf. Das Musikmäzenatische Handeln dieser Frauen erzielte auch jenseits des Musiksalons einen derartigen Wirkungsgrad, dass es mit einer »nachhaltigen Hör-Beeinflussung« charakterisiert werden kann: So reichte ihr Engagement (zeitchronologisch und ausschnitthaft dargestellt) nicht allein von einer Förderung des »unangepassten« J.S. Bach-Sohns Wilhelm Friedemann Bach und der revolutionären Implementierung gemischt-geschlechtlicher Synagogen-Gesänge über amerikanische Erst- und Uraufführungen von Werken Arnold Schönbergs oder Charles Ives sowie Unterhaltszahlungen an John Cage bis hin zu der Ermöglichung neuer Kompositionsstile wie der Mikrotonalen Musik eines Harry Partch, sondern es hatte auch Auswirkungen auf nachfolgende Musiker*innen-Generationen unterschiedlicher Genres insgesamt. Mehr noch: Es veränderte die Wahrnehmung von Musik in der westlichen Welt grundlegend.
So ist die gesellschaftliche Akzeptanz heutiger nicht-normativer künstlerischer Ausdrucksformen und ein weitgehend selbstverständlicher Hör-Umgang mit nicht tonalen Klängen in vielfältigen künstlerischen sowie lebenspraktischen Zusammenhängen mit dem nachdrücklichen Implementieren einer anderen Avantgarde in Verbindung zu bringen, die diese Musikmäzeninnen durch einen konsequenten Bruch mit Hörtraditionen, zeitbedingten Setzungen und Aufführungs-Konventionen provozierten. Dennoch wurde bislang nicht untersucht, was dieses nachhaltige Wirken ihres Musik-Förderns im Einzelnen hervorgerufen hat.
Es ergibt sich somit bei allen vier Frauen eine ungewöhnliche Diskrepanz zwischen ihrer Rezeptions- und Wirkungsgeschichte, deren Ursache in diesem Buch mit der unaufgearbeiteten Frage eines Wie ihres Förderns in Zusammenhang gebracht wird. Von den Töchtern der Haskala, den Berliner Jüdinnen der 1760er Generation, bis hin zu den Nachfahrinnen deutsch-osteuropäischer, jüdischer Einwanderer-Familien in die Neue Welt bildet die aschkenasische Prägung und Enkulturation in unterschiedlichen historischen Phasen ein gemeinsames soziokulturelles Vorzeichen der vier ausgewählten Musikmäzeninnen und verweist damit auf einen weiteren, sie verbindenden Sub(kon)text: Auf die Entwicklung der jüdischen Reformbewegung, die sich, ausgehend von den Aschkenasim zur Zeit der Haskala in Deutschland und Osteuropa, im Zuge mehrerer jüdischer Migrationswellen in Nordamerika weiterentwickelte.
So entstammen alle vier Mäzeninnen Familien, die nicht konvertierten und die auf unterschiedliche Weise in die jüdische Reformbewegung eingebunden waren. Dieser gemeinsame Hintergrund ist für die Betrachtung konstitutiv, und die Relevanz des Themas wird deutlich: Im Zentrum steht die Frage, ob sich Querverbindungen und Ähnlichkeiten zwischen Haltungen und Ausprägungen im Musikmäzenatentum der Frauen bestimmen lassen, die mit dem kulturell vorgeprägten Erbe der Tzedaka-Tradition in Verbindung stehen.
Unter Berücksichtigung des zeithistorischen Kontextes der Reform sowie der soziokulturellen Prägung der Frauen werden ihr Gabe-Verhalten überprüft und ihre Konzepte von Gabe und Gegengabe analysiert: Wie verhält sich ihr Geben zu den Variablen Herkunft, Prägung und Reform-Erbe aus weiblicher Perspektive? Wie konstruierten die Mäzeninnen ihre Gabe-Gegengabe-Akte, welche Art von Gratifikation erwarteten sie und welche Relevanz hat ihre Form des Förderns hinsichtlich aktueller Gabe-Diskurse? Im Zentrum dieser Überlegungen steht die Frage, inwieweit Merkmale, Anklänge oder Persistenzen einer Tzedaka-Tradition, als spezifisch jüdischer Gabe-Technik, in ihren mäzenatischen Selbst- und Fremdpräsentationen sowie in ihrem mäzenatischen Musikhandeln sichtbar werden.
Das Förderresultat der Berliner Pianistin Sara Levy (1761-1854) wird maßgeblich über ihre umfangreiche Musiksammlung dargestellt; bei der Betrachtung des Förderverhaltens der in Chicago geborenen Pianistin und Fotografin Betty Freeman (1921-2009) geben selbstverfasste Reden Auskunft über ihr Musikmäzenatentum. Der Weg von der Berliner Haskala zu den Nachkommen der Reformbewegung, d.h. der Übergang von der »Alten« zur »Neuen« Welt, wird durch die beiden Musikmäzeninnen Amalie Beer (1767-1854) und Alma Morgenthau Wertheim (1878-1953) nachgezeichnet. Bei diesen beiden Musikmäzeninnen bildet der Gesang einen eigenen, musikpraktischen Bezug zum Fördergegenstand. In der Rahmung durch die beiden großen Primärquellen-Analysen zu Sara Levy und Betty Freeman, wie auch in den etwas weniger umfänglichen »Binnen-Analysen« zu Amalie Beer und Alma Morgenthau, begegnet sich jeweils ein Repräsentantinnen-Paar, das sich, neben der zeitlichen Gegenüberstellung, in zwei Aspekten unterscheidet: zum einen in dem Grad der eigenen Ausübung von Musik als Disposition des Förderns (öffentlich auftretende Musikerin bzw. privat Konzertierende), und zum anderen in dem Grad ihres Einbezogen-Seins in eine jüdisch-religiöse Praxis und einer damit verbundenen Selbstauffassung (Religionsausübung vs Säkularisierung). Alle Einzelanalysen münden inhaltlich und formal in einer individuellen Konklusion zu motivationalen Faktoren des Gebens (in Selbst- und Fremdpräsentationen) und ihrem Bezug zur Gabe-Technik der jüdischen Tzedaka.
Das Anliegen dieses Buches ist es, die historischen Ausprägungen eines wiederkehrenden Gabe-Verhaltens zu verstehen, dessen spezifische Konfiguration für eine nachhaltige Förderung neuer Musik von Bedeutung zu sein scheint. Das Erkenntnisinteresse liegt folglich nicht darin, biographische Portraits der Mäzeninnen zu zeichnen oder Stereotypien weiblicher Mitglieder einer zweifelsfrei inhomogenen gesellschaftlichen Gruppe zu entwerfen, sondern vielmehr darin, fortbestehende Musikmäzenatische Förderkonstrukte auf ihre mögliche Beeinflussung durch tradierte religiöse Zeichensysteme und kulturelle Praktiken, die auch in säkularisierter Ausprägung Permanenz aufweisen könnten, nachzuzeichnen. Die dafür erforderliche Rekonstruktion individueller und gesellschaftlicher Narrative ist in den Kontext religions- und zeitgeschichtlicher Aspekte einer jüdischen Kulturgeschichte eingebunden.
Obgleich der Salon als Förderort in Bezug auf das Moment des Austauschs von Gabe und Gegengabe in diesen Narrativen eine Rolle spielt, fokussiert sich der vorliegende Beitrag ausdrücklich nicht auf den Aspekt der Musikmäzeninnen als Salonnièren. Eine solche primäre Rollenzuschreibung verkürzte das Profil und den tatsächlichen Wirkradius der ausgewählten Repräsentantinnen und würde dem in seiner Natur ortsunabhängigen Fördergegenstand Musik zudem nicht ausreichend gerecht.
Der die Mäzeninnen ebenfalls vorwertende Begleitumstand, dass es sich bei ihnen um eine sehr kleine und nicht-repräsentative Gruppe wohlhabender Frauen in ihrem jeweiligen Gesellschaftsausschnitt handelt, ist nicht nur dem Forschungsthema Mäzenatentum inhärent, sondern wird in die Überlegungen bewusst mit einbezogen: So interessiert, wie sich gerade die privilegierten und solventen Töchter als Erbinnen vormals nicht-vermögender Einwanderer-Familien in dritter Generation mittels ihrer musikbezogenen Gabe-Akte zu ihrem kulturellen Erbe, der jüdischen Tzedaka-Gabe, verhalten.
Außerhalb einer Abgrenzung zu anderen Gabe-Vorstellungen im Abschnitt der Begriffsdefinitionen verfolgt die Besprechung der Tzedaka als kultureller Gabe-Tradition nicht das Ziel eines intra- oder interreligiösen Vergleichs. Als Kategorie untersucht, soll demnach auch keine ideologische oder religionswissenschaftliche »insider/outsider-Debatte« (Rohrbacher) angestoßen werden. Vielmehr interessiert die allgemeinere Frage, ob sich in dem übereinstimmend nachhaltigen Musikhandeln dieser Frauen eine spezifisch jüdische Gabe-Tradition als gemeinsamer Prägungskontext ausmachen lässt, und wie sich ein solcher in der Musik-mäzenatisch-praktischen Ausübung gestaltend auswirkt. Demgemäß wird nicht angestrebt, mäzenatische Leistungen von Einzelpersonen zu exponieren, sondern zu überprüfen, wie bzw. wodurch ihre Gabe-Akte zu einer heutigen Vielfalt klanglicher Erscheinungsformen beigetragen haben.
Musik-Fördergeschichte wird daher auch nicht als eine »Erfolgsgeschichte« im Sinne einer linearen Abfolge von »best practitioners« verstanden, sondern als die Ermöglichung eines kollektiven Klanggedächtnisses, welches sich aufgrund der jeweiligen Stelle des Ausblick-Punktes der individuellen Gedächtnisse stets verändert; im Sinne einer »sozio-musikalischen Klangformation«, die überdies einem permanenten Wechsel unterschiedlicher Beziehungskonstellationen unterliegt.5
Nach Charles S. Peirce (1839-1914) sucht abduktive Forschung nach einer sinnstiftenden Regel, welche das Überraschende an den betrachteten Fakten beseitigt (Reichertz, 2003, zitiert nach Halbmayer & Salat, 2011). Nach Brockmeier ermöglicht Kultur eine Sichtweise oder Perspektive, um menschliches Handeln, Sprache und Bewusstsein sowie andere materielle und symbolische Praktiken in einem Zusammenhang zu sehen, ohne den sie unverständlich bleiben würden (Brockmeier, 2006, S. 17).
Ziel dieser Untersuchung ist es demgemäß, Rückschlüsse auf Sinnsetzungs-Akte der Musikmäzeninnen zu ziehen, Tendenzen und Entwicklungen ihrer Förderpraxis aufzuzeigen und so bislang unbekannte Aspekte, Blickpunkte und Perspektiven Musik-mäzenatischer Gabe-Gegengabe-Akte als mögliche realistische Denkfiguren zu entwickeln. »Erkenntnis« meint hier demnach eine »Deutung des Unverstandenen« (Barberowski), welche Ricoeur eine »Übung des Zweifels« nennt (Ricoeur, 1974, zitiert nach Baberowski, 2014, S. 100).
Die Tatsache, dass sich die aus dem Material hervorgehende Kenntnis auf Vergangenes bezieht, schließt die Problematik ein, dass sich die zu untersuchenden Quellen bereits aus ihrem Kontext gelöst haben. Daher muss beim Lesen und Auswerten eine Einbettung in den ursprünglichen Zusammenhang erfolgen; auch, um ein Verstehen symbolischer Lebensäußerungen zu gewährleisten.
Aus diesem Grund wird im zweiten Kapitel eine kurze Einführung zum »Urbild« der Förderform, zum Namensgeber Gaius Cilnius Maecenas, zu seinem Fördermodell und zu der Einordnung des Begriffes Mäzenatentum vorangestellt Auch für das Thema zentrale Begriffe werden hier erläutert: allen voran die Gabe als anthropologisches Phänomen; Tzedaka als jüdische Traditionsauslegung eines »gerechten Gebens von Generation zu Generation«; mithin die Begriffe Generation und Tradition als wissenschaftliche Untersuchungskategorien, ergänzt um den Aspekt der Transgenerationalität als zu überprüfende Möglichkeit einer Weitergabe-Form gemäß der hypothetischen Vorannahme der vorliegenden Untersuchung; zudem der Fördergegenstand Neue Musik sowie der Begriff des Musiksalons als Förderort.
Da ein »größeres Ganzes« von Vergangenem als Sinnzusammenhang im »Hier und Jetzt« nur verstanden werden kann, wenn die individuellen Praxen vor dem Hintergrund der sie umgebenden Verhältnisse und Vorbedingungen betrachtet werden, bereitet das dritte Kapitel die Einzelbetrachtungen zu den Mäzeninnen vor, indem es die in dem Buchtitel verwobenen Parameter von Weiblichkeit und Musik im Kontext jüdischer Tradierung definiert und historisch einbettet. Diese Hinführung enthält bereits interpretative Elemente zu den Förder-Bedingungen der Mäzeninnen und bildet das Fundament, auf dem die sich anschließenden Analysen und Konklusionen stehen.
Details
- Seiten
- 356
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631914410
- ISBN (ePUB)
- 9783631914427
- ISBN (Hardcover)
- 9783631905272
- DOI
- 10.3726/b21720
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (Oktober)
- Schlagworte
- Kulturförderung L’dor v’dor Geschlechtergerechtigkeit jüdische Musikgeschichte bedeutende Frauen Tzedaka Jüdische Tradition Mäzenatentum Musikförderung Musik und Gender Haskala jüdische Emanzipation
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 356 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG