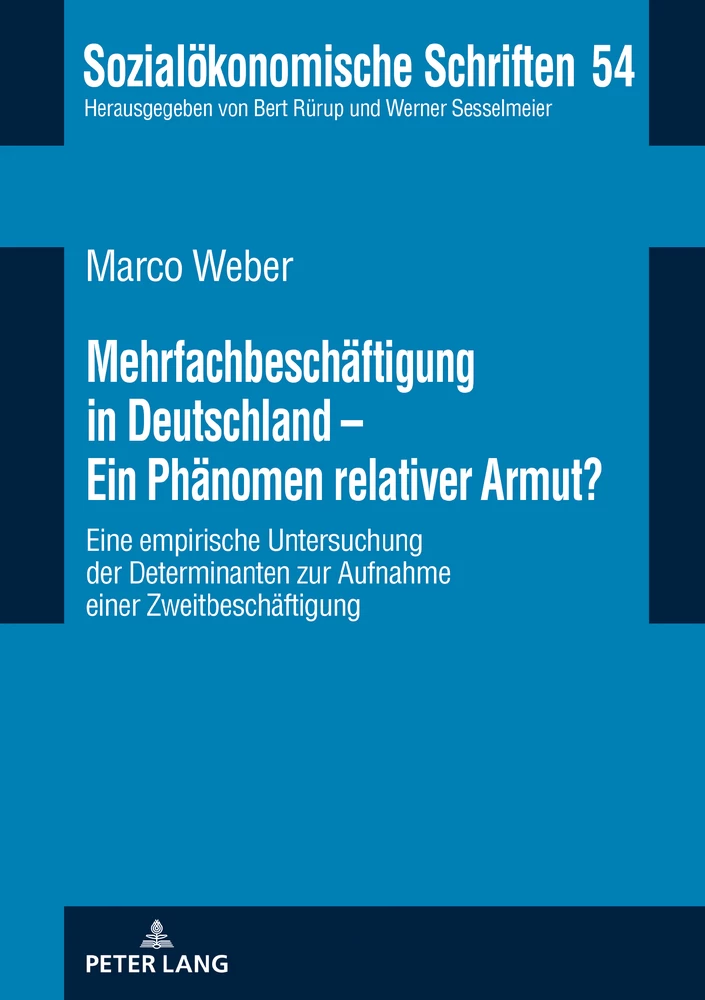Mehrfachbeschäftigung in Deutschland - Ein Phänomen relativer Armut?
Eine empirische Untersuchung der Determinanten zur Aufnahme einer Zweitbeschäftigung
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Mehrfachbeschäftigung in der Theorie
- 2.1. Definition und Abgrenzung von Mehrfachbeschäftigung
- 2.2. Formen von Mehrfachbeschäftigung
- 2.3. Der theoretische Zusammenhang von Mehrfachbeschäftigung und Atypischer Arbeit
- 2.3.1. Unterscheidung von Normalarbeit und Atypischer Arbeit
- 2.3.2. Mehrfachbeschäftigung und Atypische Arbeit
- 2.3.3. Zwischen-Fazit: Mehrfachbeschäftigung und Atypische Arbeit
- 3. Theoretischer und Empirischer Forschungsstand zu den Motiven für Mehrfachbeschäftigung
- 3.1. Finanzielle Motive für Mehrfachbeschäftigung
- 3.2. Nicht-Monetäre Motive für Mehrfachbeschäftigung
- 3.3. Forschungslücke und Entwicklung der Arbeitshypothesen
- 4. Empirische Erfassung der Mehrfachbeschäftigung im Sozio-oekonomischen Panel und Abgleich mit anderen Datenbasen
- 4.1. Beschreibung des Sozio-oekonomischen Panels
- 4.2. Operationalisierung von Mehrfachbeschäftigung im SOEP
- 4.2.1. Mehrfachbeschäftigung nach Selbsteinstufung
- 4.2.2. Mehrfachbeschäftigung im SOEP anhand Aktuellem Einkommen
- 4.2.3. Mehrfachbeschäftigung im SOEP anhand Vorjahres-Einkommen
- 4.3. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der nebenberuflichen geringfügigen Beschäftigung
- 4.4. Entwicklung der Mehrfachbeschäftigten auf Basis des SOEP
- 4.4.1. Validierung der verwendeten Operationalisierungskonzepte für Mehrfachbeschäftigung auf Individual-Ebene
- 4.4.2. Zwischenfazit: Operationalisierung von Mehrfachbeschäftigung im SOEP
- 4.5. Verifikation der Ergebnisse anhand anderweitiger Datenbasen
- 4.5.1. Mehrfachbeschäftigung im Mikrozensus / Labour Force Survey
- 4.5.2. Mehrfachbeschäftigung in der BA-Beschäftigungsstatistik
- 4.5.3. Mehrfachbeschäftigung in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR)
- 4.5.4. Zwischenfazit: Datenabgleich und Datenquellen
- 5. Armutsdefinition und Armutsmessung
- 5.1. Allgemeine Definition von Armut
- 5.2. Armutsmessung anhand des Einkommens oder des Konsums (Direkte versus Indirekte Armutsmessung)
- 5.3. Armutsmessung – subjektive versus objektive Armut und absolute versus relative Armutsmessung
- 5.3.1. Bestimmung des relativen Armutsbegriffs – Wahl des Einkommensbegriffs
- 5.3.2. Bestimmung des relativen Armutsbegriffs – Zuordnungsproblematik und Skalenerträge
- 5.3.3. Bestimmung des relativen Armutsbegriffs – Mittelwertkonzept und Abstand vom mittleren Einkommen
- 5.4. Zwischenfazit: Armutsmessung und Armutskonzepte
- 5.5. Operationalisierung von Armutsgefährdung mit SOEP Daten
- 6. Deskriptive Beschreibung Einfach- und Mehrfachbeschäftigte
- 6.1. Individuelle Merkmale
- 6.2. Haushaltsbezogene Merkmale
- 6.3. Berufs- und Branchenzugehörigkeit
- 6.4. Dauer von Mehrfachbeschäftigung
- 7. Armutsgefährdung, atypische Beschäftigung und Mehrfachbeschäftigung – Bivariate Untersuchung
- 7.1. Armutsgefährdung und Mehrfachbeschäftigung
- 7.2. Mehrfachbeschäftigung, atypische Arbeitsformen und Einkommensarmut
- 7.2.1. Verbreitung atypischer Beschäftigung in der ersten Erwerbstätigkeit von Mehrfachbeschäftigten
- 7.2.2. Verbreitung atypischer Beschäftigung in der zweiten Erwerbstätigkeit von Mehrfachbeschäftigten
- 7.2.3. Verbreitung atypischer Beschäftigung in Haupt- und Nebenerwerb von Mehrfachbeschäftigten
- 7.3. Prävalenz von Armutsgefährdung unter ausgewählten Formen atypischer Mehrfachbeschäftigung
- 8. Ökonometrische multivariate Untersuchung zur Kausalität zwischen Einkommensarmut und Mehrfachbeschäftigung
- 8.1. Beschreibung der Methode zur Feststellung von Kausalität mittels Längsschnittsanalysen
- 8.2. Einkommensarmut als Folge von atypischer Mehrfachbeschäftigung
- 8.2.1. Hypothesenformulierung und Operationalisierung
- 8.2.2. Resultate Fixed-Effects-Logit-Regressionen
- 8.3. Einkommensarmut als Auslöser für Mehrfachbeschäftigung
- 8.3.1. Hypothesenformulierung und Operationalisierung
- 8.3.2. Resultate Fixed-Effects-Logit-Regressionen
- 8.3.3. Sensitivitätsanalyse
- 9. Zusammenfassung der Ergebnisse, Wirtschaftspolitische Empfehlungen und Forschungsausblick
- 9.1. Messung von Mehrfachbeschäftigung
- 9.2. Messung von Armut
- 9.3. Deskriptiver Vergleich Einfach- und Mehrfachbeschäftige
- 9.4. Mehrfachbeschäftigung und Einkommensarmut
- 9.4.1. Atypische Mehrfachbeschäftigung und Einkommensarmut
- 9.4.2. Einkommensarmut als Auslöser für die Aufnahme einer Mehrfachbeschäftigung
- 9.5. Zufriedenheit mit HH-Einkommen (subjektive Armut) / „hours-constraints“ und Kreditschulden
- 9.6. Nicht-monetäre Motive: „hedging“, „heterogeneous -jobs“ und Berufliche Veränderungen
- 9.7. Fazit und wirtschaftspolitische Folgerungen
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Abbildung 1: Unterscheidung Nebenerwerbstätigkeit und Mehrfachbeschäftigung
Abbildung 2: Formen von Mehrfachbeschäftigung
Abbildung 3: Monetäre und Nicht-Monetäre Motive für Mehrfachbeschäftigung
Abbildung 4: Mehrfachbeschäftigung – Neoklassisches Arbeitsmarktmodell
Abbildung 5: Zeitlicher Verlauf der durchgeführten Befragungen zum SOEP 1992 bis 2015
Abbildung 6: SOEP Personenfragebogen mit Kodierungsbeispiel Mehrfachbeschäftigung
Abbildung 7: Auszug SOEP-Personenfragebogen 2015 –Arbeitsverdienst Haupt- und Nebeneinkommen im letzten Monat
Abbildung 8: Auszug SOEP-Personenfragebogen 2014 – Vorjahres-Einkommen im Jahr 2013
Abbildung 9: Durchgeführte Interview-Befragungen des SOEP in den Jahren 1999 und 2003
Abbildung 10: Mehrfachbeschäftigung im SOEP – 1992 bis 2015
Abbildung 11: Vergleich Übereinstimmung Mehrfachbeschäftigung auf Personenebene nach Operationalisierungskonzepten
Abbildung 12: Vergleich der Übereinstimmung der ungewichteten Stichprobe des SOEP – Mehrfachbeschäftigung auf Personenebene nach Vormonats- und Vorjahres-Einkommen
Abbildung 13: Erhebung Einkommensklassen im Mikrozensus
Abbildung 14: Mehrfachbeschäftigung im Vergleich: EUROSTAT/LFS und SOEP – 1992 bis 2015
Abbildung 15: Zeitliche Verteilung des Befragungsvolumens Mikrozensus – Umstellung von Fester auf Gleitender Berichtswoche
Abbildung 16: Mehrfachbeschäftigung im Vergleich: EUROSTAT und SOEP nach Regelmäßigkeit – 1992 bis 2015
Abbildung 17: Mehrfachbeschäftigung im Vergleich: Bundesagentur für Arbeit und SOEP – 2003 bis 2015
←11 | 12→Abbildung 18: Einzelformen von abhängiger Mehrfachbeschäftigung im Vergleich: Bundesagentur für Arbeit und SOEP – 2003 bis 2015
Abbildung 19: Mehrfachbeschäftigung im Vergleich: IAB-Arbeitszeitrechnung, EUROSTAT–Arbeitskräfteerhebung(LFS), BA-Beschäftigungsstatistik, und SOEP – 1992 bis 2015
Abbildung 20: Ausschnitt SOEP-Haushaltsfragebogen 2015
Abbildung 21: Schematische Darstellung Bildung „pre-/post-government income“ im SOEP
Abbildung 22: Armutsgefährdungsschwelle pro Monat 1992 bis 2015 (SOEP) – nach aktuellem und Vorjahreseinkommen – in Preisen von 2010
Abbildung 23: Abweichung Wunscharbeitszeit und tatsächliche Wochenarbeitszeit im Haupterwerb von Einfach- und Mehrfachbeschäftigten im Vergleich – Ø 1995 bis 2014
Abbildung 24: Abweichung Wunscharbeitszeit und tatsächliche Wochenarbeitszeit im Haupterwerb –Mehrfachbeschäftigte nach Phasen
Abbildung 25: Verbleibsanalyse von zwischen 1995 und 2014 ausgeübten Mehrfachbeschäftigungsverhältnissen (Vormonats- und Vorjahresdaten) in den Folgejahren
Abbildung 26: Verbleibsanalyse von zwischen den Jahren 1995 und 2014 ausgeübten Mehrfachbeschäftigungen (Vormonats- und Vorjahresdaten) in den Folgejahren – Vergleich gewichtete und ungewichtete Stichprobe
Abbildung 27: Armutsgefährdungsquote von Einfach- und Mehrfachbeschäftigten nach Vormonatseinkommen (1995–2015) und Vorjahreseinkommen (1992–2014)
Abbildung 28: Jahresmittelwerte Atypische Erwerbsformen bei Mehrfachbeschäftigten im Haupterwerb (Vormonatseinkommen)
Abbildung 29: Jahresmittelwerte Mehrfachbeschäftigte nach Erwerbsformen im Haupterwerb (Vormonatseinkommen)
Abbildung 30: Vergleich Anteile Erwerbsformen an Kernerwerbstätigen – Mehrfachbeschäftigte und Einfachbeschäftigte (Haupterwerbsform nach Vormonatseinkommen) – Mittelwerte Phasen I-III 1995 bis 2015
Abbildung 31: Arbeitszeit im Nebenerwerb – 1995 bis 2015
←12 | 13→Abbildung 32: Erwerbsformen im Nebenerwerb – 1995 bis 2015
Abbildung 33: Kombination der Haupt- und Nebenerwerbsform kompakt – Mehrfachbeschäftigte 1995 bis 2015 (Vormonatseinkommen)
Abbildung 34: Anteil ausgewählte Kombination Haupt- und Nebenerwerbsform an Mehrfachbeschäftigten 1995 bis 2015 (Vormonatseinkommen)
Abbildung 35: Armutsgefährdungsquoten Mehrfachbeschäftigte (Vormonatseinkommen) nach Erwerbskombinationen 1995 bis 2015.
Abbildung 36: Armutsgefährdungsquoten Mehrfachbeschäftigte (Vormonatseinkommen) nach detaillierten atypischen Erwerbskombinationen – Durchschnittswerte 1995 bis 2015.
Abbildung 37: Fixed-Effects Logit (Conditional-Fixed-Effects) Modell – Beispiel
Abbildung 38: Einflussfaktoren Berechnung Einkommensarmut
Abbildung 39: Anteil im Vorjahr Armutsgefährdeter Einfach- und Mehrfachbeschäftigter (Vormonats- und Vorjahresdaten)
Abbildung 40: Armutsgefährdungsquote einfach- und Mehrfachbeschäftigte – inklusive / Exklusive Nebeneinkommen – Sensitivitätsanalyse
Abbildung 41: Armutsgefährdungsquote einfach- und Mehrfachbeschäftigte – inklusive / Exklusive Nebeneinkommen – Sensitivitätsanalyse nach Phasen
Abbildung 42: Schematische Darstellung eines unmittelbaren und zeitlich verzögert eintretenden Effekts in jährlichen Erhebungen.
Abbildung 43: Erhebung Variablen zur beruflichen Veränderung in zwei Jahren im SOEP
Abbildung 44: Einflussfaktoren Berechnung Einkommensarmut
Abbildung 45: Sensitivitätsanalyse des Effekts des Nebeneinkommens auf den Zusammenhang von Armutsgefährdung und Mehrfachbeschäftigung.
Abbildung 46: Einfluss Äquivalenzgewichtetes Haushaltseinkommen ohne Nebenerwerb (in Quintilen) auf die Nebentätigkeitswahrscheinlichkeit
Tabelle 1: Unterscheidung Nebenerwerb und Haupterwerb
Tabelle 2: Kodierung Mehrfachbeschäftigung im SOEP anhand subjektiven Beschäftigungsumfangs. Um den Anforderungen der jeweiligen Zeit gerecht zu werden, variieren die Antwortmöglichkeiten bezüglich der derzeitigen Erwerbstätigkeit im SOEP über die Erhebungsjahre hinweg
Tabelle 3: Alternative Kodierung Mehrfachbeschäftigung im SOEP anhand Vorjahreseinkommensarten.
Tabelle 4: Monatliche Geringfügigkeitsgrenzen in der Sozialversicherung in den Jahren 1992 bis 1998
Tabelle 5: Übereinstimmungsmatrix der Mehrfachbeschäftigung nach Vorjahreseinkommen 2015 und Vormonatseinkommen 2014
Tabelle 6: Vergleich der Kernindikatoren der Armutsmessung des 4. und 5.Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung sowie Indikatoren zu Armut und sozialer Exklusion der Europäischen Kommission
Tabelle 7: Bestandteile des verfügbaren Einkommens nach dem OECD-Rahmenwerk
Tabelle 8: BSHG-Skala und Bedarfsgewichtung der Regelbedarfssätze nach Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch
Tabelle 9: Vergleich Äquivalenzskalen
Tabelle 10: Äquivalenzgewichtetes Haushaltsnettoeinkommen auf Basis ausgewählter Äquivalenzskalen
Tabelle 11: Soziodemografie von Einfach- und Mehrfachbeschäftigten– 1995 bis 2014
Tabelle 12: Beschäftigungsform Haupt- und Nebenerwerb von Einfach- und Mehrfachbeschäftigten im Vergleich – 1995 bis 2014
Tabelle 13: Wochenarbeitszeiten von Einfach- und Mehrfachbeschäftigten im Vergleich – 1995 bis 2014
Tabelle 14: Individuelles Arbeitseinkommen (netto, preisbereinigt) von Einfach- und Mehrfachbeschäftigten im Vergleich – 1995 bis 2014
Tabelle 15: Nebeneinkommen und Stundenlohn (netto, preisbereinigt) von Einfach- und Mehrfachbeschäftigten im Vergleich – 1995 bis 2014
←15 | 16→Tabelle 16: Verfügbares äquivalenzgewichtetes Haushaltseinkommen (preisbereinigt) von Einfach- und Mehrfachbeschäftigten im Vergleich – 1995 bis 2014
Tabelle 17: Haushaltszusammensetzung und Familienstand von Einfach- und Mehrfachbeschäftigten im Vergleich – 1995 bis 2014
Tabelle 18: Branchenverteilung des Haupterwerbs von Einfach- und Mehrfachbeschäftigten im Vergleich – 1995 bis 2014
Tabelle 19: Branchenverteilung des Haupt- und Nebenerwerbs von Mehrfachbeschäftigten im Detail – 1998 bis 2007
Tabelle 20: Berufshauptgruppen des Haupt- und Nebenerwerbs (ISCO88) von Einfach- und Mehrfachbeschäftigten im Vergleich – 1995 bis 2014
Tabelle 21: Übereinstimmungsmatrix der Berufshauptgruppen (ISCO88) des Haupt- und Nebenerwerbs von Mehrfachbeschäftigten – 1995 bis 2014
Tabelle 22: Beispiel Transformation Variablen mit Vorjahresbezug
Tabelle 23: Armutsgefährdungsrisiko nach Wechsel der Erwerbsform – 1995 bis 2014/15
Tabelle 24: Ökonometrische Untersuchung der Einflussvariablen zur Aufnahme einer Zweitbeschäftigung im aktuellen bzw. im nächsten Jahr
Tabelle 25: Ökonometrische Untersuchung der Einflussvariablen zur Aufnahme einer Zweitbeschäftigung im aktuellen bzw. im nächsten Jahr, inklusive imputierter Werte beruflicher Veränderung
Tabelle 26: Einkommensklassen Mehrfachbeschäftigte nach Nebenerwerbsform – 2003/04 bis 2014
Tabelle 27: Haushaltseinkommen 2003 bis 2014 bei Abschaffung des Steuer- und Abgabenprivilegs
In der modernen Leistungsgesellschaft kommt nur wenigen Bereichen ein vergleichbarer Stellenwert zu wie der Erwerbstätigkeit. Über die reine Versorgung mit materiellen Gütern und Sicherung des persönlichen Wohlstands hinaus, bestimmt die Erwerbstätigkeit in erheblichem Maße die Stellung in der Gesellschaft und ist gerade im deutschen Sozialstaat der zentrale Bezugspunkt für die Einbindung in die sozialen Sicherungssysteme.1 Es kann daher kaum überraschen, dass gerade Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in besonderem Maße dem kritischen Auge der Öffentlichkeit unterliegen. Neben der Höhe der Arbeitslosigkeit ist hier auch die Qualität der bestehenden Arbeitsplätze ein ausschlaggebender Faktor. In diesem Sinne wird der mit Beginn der 1990er Jahre zunehmend sichtbare Wandel der Arbeitsformen2 – in Form des vermeintlichen Rückgangs des Normalarbeitsverhältnisses zu Gunsten einer gestiegenen Anzahl sogenannter „atypischer“ Beschäftigungsformen – in der breiten Bevölkerung mit Sorge beurteilt. Insbesondere die im Zuge der Hartz-Reformen eingeleitete Deregulierung auf dem Arbeitsmarkt wird hierbei als Zäsur empfunden, die zu einer wahrgenommenen Verschlechterung der Einkommens- und Arbeitsbedingungen geführt hat. Die auf den Empfehlungen der Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ beruhenden Reformen, sahen die „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit als vorrangige Aufgabe der Gesellschaft“,3 deren hohes Ausmaß aufgrund des im internationalen Vergleich als rigide angesehenen deutschen Arbeitsmarktes gesehen wurde.4 Um die bestehende konjunkturunabhängige Sockelarbeitslosigkeit zu bekämpfen, wurde zu einer umfassenden Reform der Lohnersatzleistungen, der Sozialhilfe sowie einer Flexibilisierung des institutionellen Rahmenwerkes auf dem Arbeitsmarkt geraten.5 Der in den Folgejahren zu verzeichnende Rückgang der Arbeitslosigkeit wurde kritischen Stimmen zufolge jedoch unter Inkaufnahme zunehmender Prekaritätsrisiken und einer weitreichenden Segmentierung der Beschäftigungsverhältnisse durchgeführt. Demnach zeichnen sich die neugeschaffenen, überwiegend ←19 | 20→atypischen Beschäftigungsverhältnisse durch höhere Beschäftigungsunsicherheit und Niedriglohnbeschäftigung aus und stehen damit im Gegensatz zu dem bisher als „Normalfall“ wahrgenommenen Modell der Wohlstandssicherung aus einem einzigen Beschäftigungsverhältnis. Die Gleichsetzung des Normalarbeitsverhältnisses als „quasi-Standard“ der Beschäftigung hält einer historischen Betrachtung jedoch nicht stand, da dieses vielmehr eine geschichtlich einmalige Erscheinungsform der wirtschaftlichen Boom- und Wachstumsjahre, denn den historischen Normalfall darstellt.6 Ein weiter reichender Blick auf die Entwicklung der Erwerbsarbeit zeigt eher die Normalität den Lebensunterhalt aus verschiedenen Einkommensquellen zu bestreiten, wie zum Beispiel in Form der nebenberuflichen Landwirtschaft.7 Diese „income mixes“8 verschoben sich erst im Zuge der stärker werdenden Industrialisierung und Abwendung von der Landwirtschaft hin zu einer einzigen (Lohn-)Einkommensquelle. Das Normalarbeitsverhältnis, mittels dessen die gesamten Ausgaben des Haushaltes zu decken waren, steht insofern scheinbar in starkem Kontrast zur Notwendigkeit einer zusätzlichen Nebenerwerbstätigkeit. Angesichts der laut Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2016 annähernd 3,1 Millionen Mehrfachbeschäftigten9 kann damit argumentiert werden, dass die Normalität des Erwerbslebens für einen nicht unwesentlichen Teil der Erwerbsbevölkerung von diesem Ideal abweicht. Aufgrund des bisherigen Schattendaseins in der Arbeitsmarktforschung ergibt sich jedoch bislang keine eindeutige Bewertung der Rolle des Nebenerwerbs im Gesamteinkommensgefüge, so dass unklar bleibt, „ob Mehrfachbeschäftigte freiwillig nach flexiblen Erwerbsformen suchen oder ob sie schlicht der Not gehorchen“10. Die Diskussionslinien verlaufen hierbei ähnlich wie bei atypischen Beschäftigungsformen im allgemeinen eher schemenhaft in der als „good jobs“ betrachteten Normalarbeit und den als „bad jobs“ klassifizierten, davon abweichenden Tätigkeiten.11 Die Nebenerwerbstätigkeit wird in der öffentlichen Wahrnehmung ebenfalls im Zusammenhang mit prekären Beschäftigungsverhältnissen gesehen oder implizit mit der Annahme gleichgesetzt, dass ein Job allein nicht ausreicht, einen auskömmlichen Lebensunterhalt zu gewährleisten. Unterstützung erhält diese Ansicht durch die Befunde der Arbeitsmarktforschung, welche die atypischen Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang ←20 | 21→mit Niedriglohnbeschäftigung und dem bis dato im deutschen Wohlfahrtsstaat wenig beachteten Phänomen der Einkommensarmut12 diskutieren.13 Inwieweit auch die Mehrfachbeschäftigung in diesem Kontext zu sehen ist, bleibt bislang allerdings unklar und ist Gegenstand dieser Dissertation. Insbesondere ist dabei die Frage zu beantworten, ob die Aufnahme einer zusätzlichen Erwerbstätigkeit als Anpassungsreaktion genutzt wird, um die mit atypischen Erwerbsformen einhergehenden Charakteristiken Unterbeschäftigung, Beschäftigungsunsicherheit und ein niedriges Einkommensniveau zu kompensieren.14 Damit wird die bislang eher statische Betrachtung der Erwerbsform und deren Auswirkungen auf die Beschäftigungsstabilität und das Wohlstandsniveau um ein dynamischeres Moment ergänzt. Gerade den sich durch reduzierte Wochenarbeitszeit auszeichnenden atypischen Erwerbsformen Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäftigung kann aus zeitökonomischer Betrachtung die Möglichkeit einer Zweitbeschäftigung unterstellt werden. Eben diese Formen zeichnen sich jedoch vor allem für den Anstieg der atypischen Beschäftigung verantwortlich. So stieg die Zahl der Teilzeitbeschäftigten zwischen den Jahren 1991 und 2016 von ca. 4,3 Millionen auf annähernd 8,4 Millionen an, während sich die geringfügig entlohnte Beschäftigung (geB) im gleichen Zeitraum von 654.000 auf über 2,2 Millionen fast vervierfachte.15 Diese Entwicklung koinzidiert mit dem gleichfalls feststellbaren Anstieg nebenberuflicher Tätigkeiten. Allein die nebenberufliche geringfügige Beschäftigung wuchs nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit seit ihrer erstmaligen Ausweisung im Juni des Jahres 2003 kontinuierlich von circa 1 Millionen auf mittlerweile circa 2,7 Millionen Personen im März 2018.16 Da die auf Meldungen der Sozialversicherung beruhenden Daten Beschäftigungsgruppen wie Beamte und Selbstständige jedoch nicht beinhalten, geben diese Zahlen nur einen Teilausschnitt der Mehrfachbeschäftigung wieder. Um das tatsächliche Ausmaß der Mehrfachbeschäftigung für den deutschen Arbeitsmarkt quantifizieren zu können, werden in dieser Arbeit potenziell geeignete Datenbasen identifiziert und hinsichtlich der Vollständigkeit der Erfassung von Mehrfachbeschäftigungsverhältnissen überprüft. Damit soll auch nachgezeichnet werden, inwieweit deren Anzahl durch die regulatorischen Veränderungen ←21 | 22→der nebenberuflichen Erwerbstätigkeit in Form der Abschaffung der Sozialversicherungsfreiheit im Jahr 1999 und deren spätere erneute Wiedereinführung im Zuge der Hartz-Reformen im Jahr 2003 beeinflusst wurde.
Details
- Pages
- 384
- Publication Year
- 2019
- ISBN (Hardcover)
- 9783631794777
- ISBN (PDF)
- 9783631798263
- ISBN (ePUB)
- 9783631798270
- ISBN (MOBI)
- 9783631798287
- DOI
- 10.3726/b15999
- Language
- German
- Publication date
- 2019 (August)
- Keywords
- Atypische Beschäftigung Längsschnittsuntersuchung Panel-Analyse Motive Einkommensarmut Armutsgefährdungsrisiko Working Poor SOEP Nebenerwerbstätigkeit Nebenbeschäftigung
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019. 384 S. 46 s/w Abb., 27 s/w Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG