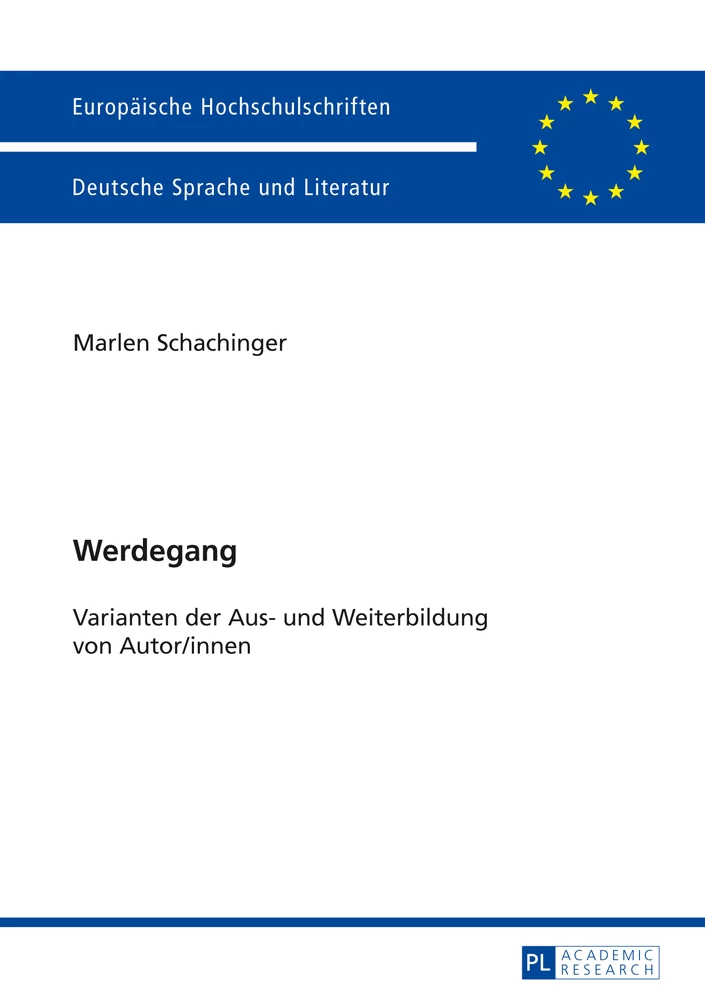Werdegang
Varianten der Aus- und Weiterbildung von Autor/innen
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Werdegänge außerhalb institutioneller Ausbildung
- 2. 1. Lernwege der Autodidakt/innen
- 2. 1. 1. Lektüre literarischer Werke
- 2. 1. 2. Essays, Poetiken, Tage- und Notizbücher, Briefwechsel
- 2. 1. 3. Handbücher
- 2. 1. 4. Von der Nachahmung und der eigenen Stimme
- 2. 1. 5. Kontakte zu Kolleg/innen und Lektor/innen
- 2. 1. 5. 1. Gruppierungen, Zirkel
- »Forum Stadtpark«
- Die »Wiener Gruppe«
- »Gruppe 47«
- 2. 1. 5. 2. Interessensgemeinschaften
- 2. 1. 5. 3. Die Rolle des bzw. der Erstleser/in
- 2. 1. 6. Das Bedürfnis nach Zeit
- 2. 1. 7. Prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse
- 2. 1. 8. Umgang mit Kritik
- 2. 1. 9. Schreibend in der Welt sein
- 2. 2. Schlussfolgerungen
- 3. Angehende Autor/innen in institutioneller Ausbildung – Eine vergleichende Analyse
- 3. 1. Von den Anfängen institutioneller Ausbildung und der Frage der Lehrbarkeit
- 3. 2. Die Frage der Existenz eines Institutstons
- 3. 3. Diverse Lehrkonzepte: Chancen & Unmöglichkeiten
- 3. 3. 1. ›Read, read, read!‹ Von der Lektüre, dem Textfeedback zur Inneren Kritiker/in
- 3. 3. 2. Entwicklungszeit, Entwicklungsraum
- 3. 3. 3. Handwerk, téchnē, craft
- 3. 3. 4. Netzwerke
- 3. 3. 5. Vollblutautor/in oder Literat/in im Nebenberuf?
- 3. 3. 6. Der Autor, die Autorin als Lehrende
- 3. 3. 7. Welthaltigkeit
- 3. 4. Schlussfolgerungen
- 4. »European Association of Creative Writing Programmes«
- Exkurs: Fernlehrgänge
- 5. Deutschland & Schweiz
- 5. 1. »Deutsches Literaturinstitut Leipzig«
- 5. 1. 1. Entstehungsgeschichte & Organisationsstruktur
- 5. 1. 2. Lehrkonzept
- 5. 1. 3. Die Frage der Lehrbarkeit
- 5. 1. 4. Chancen und Unmöglichkeiten
- 5. 1. 5. Netzwerke
- 5. 1. 6. Echo
- 5. 1. 7. Ausblicke auf…
- 5. 2. »Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus«, Hildesheim
- 5. 2. 1. Entstehungsgeschichte & Organisationsstruktur
- 5. 2. 2. Lehrkonzept
- 5. 2. 3. Die Frage der Lehrbarkeit
- 5. 2. 4. Chancen & Unmöglichkeiten
- 5. 2. 5. Netzwerke
- 5. 2. 6. Echo
- 5. 2. 7. Ausblicke auf…
- 5. 3. »Literarisches Colloquium Berlin« (»LCB«)
- 5. 3. 1. Entstehungsgeschichte & Organisationsstruktur
- 5. 3. 2. Lehrkonzept
- 5. 3. 3. Die Frage der Lehrbarkeit
- 5. 3. 4. Chancen & Unmöglichkeiten
- 5. 3. 5. Netzwerke
- 5. 3. 6. Echo
- 5. 3. 7. Ausblicke auf…
- 5. 4. »Schweizerisches Literaturinstitut«, Biel
- 5. 4. 1. Entstehungsgeschichte & Organisationsstruktur
- 5. 4. 2. Lehrkonzept
- 5. 4. 3. Die Frage der Lehrbarkeit
- 5. 4. 4. Chancen & Unmöglichkeiten
- 5. 4. 5. Netzwerke
- 5. 4. 6. Echo
- 5. 4. 7. Ausblicke auf…
- 6. Die Frage nach einer Dominanz des Marktes
- 7. Conclusio
- I. Quellen
- I. I. Primärliteratur
- I. II. Sekundärliteratur
- I. II. I. Poetiken
- I. II. II. Interviews, Fragebögen
- I. II. II. I. »Deutsches Literaturinstitut Leipzig«
- I. II. II. II. Hildesheim
- I. II. II. III. »Literarisches Colloquium Berlin«, Deutschland
- I. II. II. IV. »Schweizerische Literaturinstitut«
- I. II. II. V. Literaturbetrieb im deutschsprachigen Raum
- I. II. II. VI. Andere Universitäten, Institute international
- I. II. II. VII. Weitere Autor/innen
- I. II. III. Tagebücher, Briefwechsel
- I. II. IV. Allgemeine Sekundärliteratur
- I. II. V. Handbücher zu »Creative Writing«
- I. II. VI. Filme, Hörbeiträge
- I. II. VII. Webseiten
- I. II. VIII. Sammelbände
- I. II. IX. Einzelne Essays, Artikel in Zeitschriften, Zeitungen
- I. II. XI. Unveröffentlichtes
- I. II. XII. Methodik
- I. III. Siglenverzeichnis
- Danksagung
| 9 →
Alle Wege führen nach Rom, besagt eine Redewendung. Im Hinblick auf den Werdegang von Autor/innen ließe sich als Äquivalent konstatieren, dass sie ihr berufliches Ziel über zahllose Wege erreich(t)en, die dennoch gemeinsame Merkmale aufweisen und letztlich am gleichen Punkt enden: Ein Werk wird publiziert. Diese Merkmale herauszufiltern ist Schwerpunkt des ersten Abschnitts dieser Publikation. Im zweiten Teil wird der Fokus auf der Frage liegen, wie sich die institutionelle Lehre international derzeit gestaltet und inwiefern sie Wissen um autodidaktische Werdegänge aufnimmt und für sich nutzt.
Dass Lektüre als eines der wesentlichsten Element der Werdegänge interpretiert wird, erstaunt wohl kaum und lässt sich in zahllosen Autor/innenbiographie nachlesen. Die Faszination der geschriebenen Welt ist für Literat/innen nicht primär thematisch oder inhaltlich gebunden, sondern sie fokussiert die Frage nach dem Handwerk, nach einem Wie des Schreibens1 und die Suche nach Sprachvarianten und -bildern; Hanns-Josef Ortheil nennt es sehr treffend ein „[…] Ablauschen der ferneren, sich in mir festsetzenden Frequenzen […],“2 die ins eigene Sprachuniversum eingegliedert werden. Resultat daraus ist „[…] ein immer tieferes Abtauchen in das unabsichtliche Sprechen-wie-ein-Anderer, das ich in meinen eigenen Schreibübungen fixierte.“3 Auf Basis dieser Erfahrung ist es wohl nicht erstaunlich, dass im Hildesheimer Studiengang »Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus«, den Ortheil initiierte, besonderer Wert auf Referenztexte, deren Analyse und Imitationsübungen gelegt wird. Die Lektüre dient der Suche nach Vorbildern sowie nach Reibeflächen, gegen die es sich abzugrenzen lohnt, ebenso wie der Erforschung der Frage, was möglich ist, sei es strukturell, sprachlich oder inhaltlich.
← 9 | 10 →
Das Erlebnis der Lektüre lässt oftmals den Schreibwunsch entstehen und nährt ihn,4 ebenso bewirkt es den Wunsch, einen bestimmten Schauplatz der Weltliteratur aufzusuchen, sei es Rom5 oder Paris, wo man sich seinen genius loci erhofft: „[…] als würde dann das Bild oder der Vers wie von selbst sich aufdrängen. Eine naive Vorstellung; wie die meisten meiner anderen auch […],“6 schreibt er rückblickend in »Die Erde ist blau wie eine Orange«. Auch Ingo Schulze wählt sich aufgrund seiner Lektüre träumend Paris:
„Ich las Hemingway und wollte zum zweiten Mal Schriftsteller werden. Nichts erträumte ich inbrünstiger, als von der kalten, vom Sturm gepeitschten Rue de l’Odéon an den großen Ofen von Sylvia Beach zu treten, oder im Herbst, wenn das Licht im Luxembourg schwand, durch die Gärten hinaufzugehen, und in der Atelierwohnung Rue Fleurus 27 bei Gertrude Stein vorzusprechen. Manches war offensichtlich im Kapitalismus doch einfacher gewesen.“7
Dass Ingo Schulze 1993 aus beruflichen Gründen nach St. Petersburg ging und dort, aufgrund seiner Beobachtungen, Lebenserfahrungen und seiner Lese-Besessenheit zu schreiben begann, ist bereits der Beginn einer weiteren Geschichte.8
Beide Faktoren, die Lektüre ebenso wie der Wunsch, den eigenen genius loci aufzusuchen, haben mit der Schreibsehnsucht zu tun, mit dem Traum der eigenen Autor/innenschaft. Von diesem »Iwannabe«-Status wird später noch detaillierter die Rede sein. Es bedarf dieses anvisierten Traums der Autor/innenschaft, u.a. hervorgerufen und genährt durch die Lektüre, der in weiterer Folge bewusst gestaltet wird, um in ein reales Werk zu münden. So werden Lesen und Schreiben für Literat/innen zu zwei nahe beieinander liegenden Aktivitäten, die kaum getrennt von einander betrachtet werden können, Martin Walser nennt Lesen und Schreiben ← 10 | 11 → sogar „[…] eine [Hervorhebung i.O.] Tätigkeit […], ein[en] [Hervorhebung i.O.] Bewußtseinszustand […],“9 denn beide Tätigkeiten entstünden aus einem Mangel, einer existenten Leerstelle im eigenen Leben, oftmals aus einer inneren Einsamkeit.10 Beiden, dem Lesen und dem Schreiben, ist das Nach-Spüren eigen.11 Die Lektüre dient auch der Suche nach eigenen Vorbildern unter anerkannten Kolleg/innen, nährt den Traum und bewirkt allmählich ein Hinausgehen in jene Welt, die sie jeweils umgibt, in der sich nach und nach diese von Literatur faszinierten Leser/innen als das etablieren, was sie in sich schon längst waren: Literat/innen. Dass es des Talents bedarf, stellt keine/r in Abrede; dass es nicht genüge, sprachliches und narratives Talent aufzuweisen, ebenso wenig. Niemand, so Michael Schneider, beginne zu schreiben, weil er oder sie dafür talentiert sei, sondern es müssen andere Faktoren außerdem hinzukommen:12 „Am Anfang war nicht das Wort, sondern das Schweigen und Verschweigen, nicht das Talent, sondern die Not, die schiere Ausdrucks- und Mitteilungsnot. [Hervorhebung i. O.] Und das, was ich, was meine Erzieher und Lehrer später als meine ›angeborene Sprachbegabung‹ mystifizierten, war erst das Ergebnis einer permanent geübten Notwehr und Notlösung im Medium der Schrift.“13 Michael Schneider zieht für sich den Schluss, man werde aus Angst vor Konflikten zum Autor, zur Autorin:
„Denn es ist viel bequemer und erfordert viel weniger Mut, seine widerspenstigen Gedanken und Empfindungen dem Papier anzuvertrauen (das sich nicht wehren kann) als den Menschen, auf die sie sich ursprünglich und unmittelbar beziehen. Jeder vermiedene Konflikt aber erzeugt (wie Adolf Muschg in seinem Essay ›Literatur als Therapie‹ gezeigt hat) seinen Doppelgänger im Werk, das man mit Fug und Recht ›gesammeltes Fluchtwerk‹ nennen kann. Nach meiner Erfahrung übrigens sind die meisten Literaten professionelle Konfliktvermeider [Hervorhebung i. O.], weswegen ich auch die neokonservativen Mystifikationen und esoterischen ← 11 | 12 → (Selbst) Stilisierungen des [Hervorhebung i. O.] Künstlers und Schriftstellers als Repräsentant einer ›höheren Daseinsweise‹ für zutiefst verlogen halte.“14
Manche wie Antonio Fian führen ihren Erzählwunsch auf ein „[…] übersteigerte[s] Mitteilungsbedürfnis […]“15 zurück oder auf ein einschneidendes Erlebnis, das versprachlicht werden muss und sich deshalb in das Werk einprägen wird.16 Manche Literat/innen widersprechen dieser Sichtweise, die den Schreibwunsch ja auch in einem psychischen Defizit oder Schockerlebnis verankert, vehement und betonen, man müsse weder Genie, noch traumatisiert sein, um Autor/in zu werden.17
„Even the most talented and experienced writers have to labour at writing […]. Writing is a craft, the elements of which can be learned. Like every other art, writing requires practice, an idea taken for granted by musicians and painters but sometimes doubted by readers and aspiring writers alike. Nor is writing the exclusive preserve of the wounded or those who have had unusual lives. Imagination and empathy enable writers to enter experiences they have never had. The loneliness of the long-distance writer has also been exaggerated. Writing is indeed necessarily a solitary business but any writer as cut off as a lighthouse keeper might soon run out of subjects to write about. There is a good solitude for writers and a bad one. The good one is when you become so immersed in your writing that you lose track of time and forget your normal worries. The bad one sometimes occurs afterwards when you doubt the value of what you have written or don’t know how to progress it.“18
Andere, wie Carl Zuckmayer, erklären ohne Umschweife, sie wüssten es schlichtweg nicht zu sagen, weshalb sie schrieben: „Also, Sie haben mich nicht gefragt […], warum mein Hund bellt. Wir [Hervorhebung i. O.] würden dafür vielleicht eine Erklärung finden, der Hund bestimmt nicht, der weiß es nicht. Wenn er es wüßte, dann würde er vielleicht aufhören zu bellen … Sehen Sie, so ist das.“19 Schreiben sei, so führt Zuckmayer weiter aus, eine Arbeit, die keine Urlaubszeiten ← 12 | 13 → vorsehe: „Aber das ist ja das Ärgerliche an diesem Beruf, daß wir keine Ferien machen können! Der Kopf reist immer mit, und das Herz erst recht.“20 Die Unkenntnis der Beweggründe des Schreibens bedeute jedoch nicht per se, dass Schreiben einem leicht falle, und Zuckmayer verweist auf Thomas Manns Aussage: „›Ein Schriftsteller ist ein Mensch, dem es schwerfällt, zu schreiben.,‹“21 um alsdann kommentierend hinzuzufügen: „Das halte ich nicht für Koketterie. Das geht mit jeder Kunst so. Wer die Materie kennt, der stößt sich an ihr. Darin liegt beides: Ärger und Spaß, […] Qual und Genuß.“22
Sten Nadolny betont gleichfalls jenen Status der Suche, das stets als mangelhaft zu bezeichnende Wissen, welches jedes Mal aufs Neue den Entstehungsprozess eines neuen Werks begleite: „Ein weiteres Problem ist dies: Ich weiß nicht, nach welchen Gesetzen wirklich Romane entstehen, ich habe das auch nicht studiert und mir nie richtig überlegt. Was ich weiß, ist nur, daß meine Schriftstellerei aus einer Liebe entsteht.“23
Es bedarf des Talents, darüber herrscht Konsens. Ebenso darüber, dass keine/r Autor/in werde, der nicht eine Vorliebe für das Lesen habe. In zeitgenössischen Werken findet sich wiederholt, die Aussage „Dichterpersönlichkeiten“24 seien „[…] [eine] biographisch bedingte Symbiose aus Können und [Hervorhebung i. O.] Talent.“25 Handwerk kommt hier ins Spiel, und Handwerk kann erlernt werden. Das Genie, welches seit der Romantik nur allzu gerne zur Erklärung herangezogen wurde, hat hingegen als einziger Bezugsrahmen weitestgehend ausgedient.
Ab wann jedoch darf man sich Autor/in nennen? Wer ist noch »Iwannabe«, also lesende/r, träumende/r Lernende/r und wer ist bereits Literat/in? Wo wird die Grenze zwischen beiden Stadien gezogen? Gibt es diese überhaupt? Wie verhält es sich damit, wenn jedes neue Arbeitsvorhaben eine/n Autor/in erneut in jenen Status versetzt? Entwächst man dem »Iwannabe«-Status jemals oder wäre dies gar nicht wünschenswert? Bedarf es eines Debuts, ist der kommerzielle Erfolg nötig, müssen bejubelnde Rezensionen gesammelt werden oder ist gar ein umfassendes Oeuvre, welches zudem für die Ewigkeit Bestand hat, von Nöten, um sich Dichter, Literatin nennen zu dürfen? Eine Frage, die vielfache Antworten ← 13 | 14 → nach sich zieht; und keine davon ist eindeutig oder befriedigend. Hier vorerst einige wenige mögliche Varianten dazu: Ray Bradbury definiert Autor/in-Sein primär über die Leidenschaft für Literatur; zudem warnt er junge Kolleg/innen vor einem Blick auf den Markt oder dem Schielen nach den literarischen Felder der Macht:
„Wenn Sie ohne Leidenschaft, ohne Gusto, ohne Liebe, ohne Freude schreiben, sind Sie kein echter Schriftsteller. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, ein Auge auf den kommerziellen Markt zu werfen oder ein Ohr für erlesene Zirkel der Avantgarde zu haben, dass Sie nicht wirklich Sie selbst sind. […] Denn was ein Autor zuallererst sein sollte, ist – erregt! Aus Fieber und Enthusiasmus sollte er bestehen. Ohne solche Energie kann er eben sogut Pfirsiche pflücken oder Spargel stechen; Gott weiß, es wäre besser für seine Gesundheit.“26
Vargas Llosa formuliert pointiert, Autor/in werde, wer sich dazu ernenne.27 Der Genie-Gedanke der Romantik sei heutzutage obsolet,28 aber die Notwendigkeit der Berufung sei hingegen seines Erachtens Realität; und literarisch berufen sei der- bzw. diejenige, der oder die „[…] in der Ausübung seine schönste Belohnung […]“29 erkenne, wer also schreiben müsse, „[…] [um] mit sich selbst ganz im Einklang zu sein, das Beste zu geben, das sie besitzen, ohne das traurige Gefühl haben zu müssen, ihr Leben zu vertun.“30 Früher habe Vargas Llosa, beeinflusst von Sartres Existenzialismus, daran geglaubt, Literat/in zu werden sei eine freie Wahl,31 heute beweifle er jene Sichtweise:
„Auch wenn die literarische Berufung nicht etwas Schicksalhaftes, in den Genen des zukünftigen Schriftstellers Festgelegtes ist, sondern eher Disziplin und Ausdauer in einigen Fällen das Genie formen, so bin ich doch überzeugt, daß sich die literarische Berufung nicht nur als eine freie Wahl erklären läßt. Die Wahl oder Entscheidung gehört für mich unbedingt dazu, aber erst an zweiter Stelle, nachdem eine erste subjektive Voraussetzung erfüllt ist, die angeboren oder in der Kindheit und frühesten Jugend erworben wurde und durch die rationale Entscheidung gestärkt, aber nicht hervorgerufen werden kann.“32
← 14 | 15 →
Vargas Llosa entwickelt die These, dass jeder Mensch als Kind die Veranlagung habe, sich in seiner Phantasie Geschichten zu erzählen,33 diese seien der „[…] Ausgangspunkt für das, was man später als literarische Berufung [zu] bezeichnen […]“34 pflege, selbst wenn zwischen dem kindlichen Entwickeln der Phantasiewelten und dem Literarischen Schreiben ein Abgrund liege; diesen würden die meisten nicht überwinden.35 Wer dies jedoch tue, treffe eine freie Wahl, und ohne diese Entscheidung sowie die Unterordnung des eigenen Lebens unter diese Berufung werde keine und keiner zur Schriftsteller/in.36 Literatur, so ließe sich Vargas Llosas Gedanke mit Peter Stamms Worten fortsetzen, ist diesen Menschen „Lebensmittel,“37 das Schreiben wird von ihnen als Glück38 und/oder als Lebensnotwendigkeit begriffen. Natalie Goldberg treibt es auf die Spitze: „Selbst wenn Sie gerade nicht schreiben, bleiben Sie Schriftsteller. Es steckt in Ihnen drin.“39 Und sie vergleicht es mit dem alltäglichen Vorgang des Atmens, den wir selten bewusst registrieren, der sich unserem Willen entzieht: „Schreiben ist wie Atmen. Sie hören nicht damit auf.“40
Auch Lewis Lapham stellt den Gedanken einer freien Wahl in Abrede: „Make the mistake of thinking that you can decide to become a writer and you’ve already lost the bet. Writers happen by accident, not by design. They have as little choice ← 15 | 16 → in the matter as lemmings toppling over cliffs.“41 Ähnlich auch Clarence Major, der in der Notwendigkeit, sich schreibend auszudrücken, eine grundsätzliche Bedingung für Autor/innenschaft sieht.42 Bei Kit Reed, welche die Tätigkeit des Schreibens selbst als primäre Voraussetzung nennt, schließt sich wieder der Kreis, denn unabhängig davon, ob es nun eine Wahl sei oder eine (Über-)Lebensnotwendigkeit wie das Atmen, Tatsache ist, nur wer schreibe sei Autor/in.43
„Die eigentliche Aussage, dass nämlich der Akt des Schreibens einen Menschen zum Schriftsteller macht, kommt vielen […] am wenigsten in den Sinn. Stattdessen haben wir so Vorstellungen wie ›Richtige Schriftsteller werden veröffentlicht‹ oder ›Richtige Schriftsteller können von ihrer Arbeit leben‹. Auf gewisse Weise bringen wir damit zum Ausdruck: ›Ein richtiger Schriftsteller ist man erst dann, wenn einen andere als solchen anerkannt haben.‹ Statt ein Visum im Ausweis erhält man ein Gütesiegel, das einen zum Schriftsteller macht. Da heißt es dann: ›veröffentlicht bei X und zitiert von Y.‹“44
Zudem werden im deutschsprachigen Raum auch heute noch ab und an Zweifel geäußert, ob Autor/innenschaft als ein Beruf betrachtet werden könne,45 denn ein solcher sehe Urlaub und Pension vor, eine mit jenem Tun automatisch einhergehende finanzielle Grundsicherung des Lebens, Zustände, die einer Literatin, einem Literaten jedoch (wesens)fremd sind. Daraus zu schlussfolgern es sei keine Arbeit oder man könne dem Schreiben nicht den Zustand der Erwerbsarbeit zuschreiben, weil es als einzieg Einnahmequelle zumeist nicht ausreiche, weil Begabung nötig sei oder weil es eventuell als einzige Berufsidentität schlichtweg als problematisch ← 16 | 17 → bezeichnet werden könne, wäre dennoch zu kurz gedacht. Ist Schreiben wie Atmen, eine Lebensnotwendigkeit, ein Muss,46 so schließt sich der Kreis zu Vargas Llosas Rede von der Unterordnung des gesamten Lebens; oder, wie Hermann Burger es nennt, Schreibend-Sein wird zur einzig möglichen Existenzform, damit aber steht dann – so Hesse – schreibend auch alles auf dem Spiel.47 Ähnlich Peter Bichsel: „Wer sich auf das Erzählen einläßt, der tut es nicht, um sein Leben zu retten, er tut es, um sein Leben zu leben.“48 Schreiben ist ein Beruf, der zugleich keiner ist. Oder wie Daniel Kehlmann es in einer Selbstbefragung zu Beginn seiner Poetik-Vorlesung formuleirt: „Ganz im Ernst, haben Sie nicht manchmal ein schlechtes Gewissen, oder vielleicht eher: ein Triumphgefühl, daß Sie es geschafft haben, dem Lebensernst so davonzulaufen und einen Beruf zu ergreifen, der eigentlich die Flucht vor einem Beruf ist? [Hervorhebung i. O.] Durchaus.“49 Denn jeder andere Beruf, den man ergreift, bedeutet eine Wahl, die getroffen zu werden hat und die per se andere Arbeitsbereiche ausschließt; im Gegensatz dazu steht die Autor/innentätigkeit, die tagtäglich vom ›was-wäre-wenn‹ genährt werden will, ein Zustand, der unabdingbar notwendig ist, um in den Werken eine „[…] phantastisch[e] Pararealität […]“50 gestalten zu können. Schreibend wird die/der Literat/in zum Koch, zum Dieb, zur Mätresse, zur Vorleserin, zu Mann oder Frau, im Jetzt oder vor tausend Jahren; hinzufügen ließe sich außerdem, dass Schriftsteller/innen häufig in ihren Recherchen – oder aufgrund ihrer mangelhaften finanziellen Ressourcen – Jobs nebenher ergreifen, die sich im breiten Spektrum von ›vernünftig‹ bis ›obskur‹ ansiedeln lassen und die zudem ihr Lebenswissen vermehren, was wiederum ihr Schreiben nährt. Das spielerisch klingende ›was-wäre-wenn‹ ist kein Widerspruch zu der Aussage, Schreiben bedeute in die Tiefe zu gehen, auch in die eigenen (Un-)Tiefen:
„If you want to write you need to be able to take risks – in your life and in your writing. If you only want to stay where you are, safe and secure, then you will only ever be a mediocre writer. You have to be prepared to stretch yourself; to look into the dark places, to be moved to tears and laughter, to be honest and truthful, to write about ← 17 | 18 → your anger, your pain, your memories, your fear, as well as your loves, your joys, your triumphs. Not that these things will necessarily go into your novels; merely that you’ll be writing from a superficial place if you’re not prepared to fully experience life and write from the depths of that experience.“51
Schreibend Sein, als Existenzform, als Notwendigkeit, und dies mit dem Anspruch nach einem das Sein ermöglichenden finanziellen Auskommen aufgrund des eigenen Tuns, hierin definiert sich wohl am ehesten das berufliche Autor/innenbild des 21 Jahrhunderts, denn der Spitzwegerische arme Poet mit seiner Zipfelmütze in der Dachkammer, entrückter Blick hinter bebrillten Augen hat für zeitgenössische Literat/innen als Vorbild weitestgehend ausgedient. Waren für den Schreibprozess aus Sicht der Romantik Inspiration und Muse noch wesentliche Elemente,52 ergänzt durch das Bild des unverstandenen Künstlers, der über seiner Zuhörerschaft steht, so bereitet diesheute vielen Unbehagen:
„Yet, rather oddly, the Romantic notion, at the same time as it appears to make the individual something of a unique case, denies the notion of the artist as the origin of his or her creation, since the artist is merely the medium through which the work of art comes. It places artists in a paradoxical position: wanting to lay claim to possession of the fruits of their labour, yet avowing that the driving force is not theirs at all. Whilst the Romantic notion of the artist continues to permeate contemporary culture, eighty or so years later a new grouping of artists advanced the idea that the artist was an irrelevance and that the work of art itself was what was most important.“53
Ebenso lässt sich wie Steven Earnshaw weiter ausführt mit dem Beginn der Moderne in Selbstaussagen von Autor/innen ein unangenehmes Berührt-Sein bis hin zu einer Abwehrhaltung hinsichtlich eines vermuteten autobiographischen Textbezugs festhalten:54
„This contemporary separation of the work of art from the artist derives mainly from the modernists. The modernists saw a different world from their immediate forebears, one that placed greater emphasis on subjective experience, on the workings of the mind, and on the building blocks of art itself: language, narrative, form, colour, sound. To get at the newly perceived reality demanded attention to inner worlds and the artistic tools at hand to represent those worlds. One consequence was that art from the modernists moved away from an art that always had its audience in mind.“55
← 18 | 19 →
Das Kunstwerk spreche für sich: „The modernist aesthetic is determined to make the work of art stand alone, to be autonomous. […] The work of art remains a law unto itself, each piece unique and with it its own set of rules, completely independent of the writer and its audience, self-directed, ›autotelic‹.“56 Das Werk werde unabhängig von seinem/seiner Urheber/in in die Welt entlassen;57 dieser Gedanke hat aber in weiterer Folge für die philologischen Disziplinen gleichfalls Konsequenzen:
„Once the work of art is finished and in the public domain the artist is no longer required either by the work of art, the artist or its audience. Following on from this, literary criticism from the 1920s onwards appeared to take the writers at their own words and argued that yes, indeed, writers were of no importance when it came to evaluating or interpreting literature. In practice ›Practical Criticism‹ in the UK and ›New Criticism‹ in the US became an ideal model for teaching and scholarship – the critic approaches the text as a verbal construct full of ambiguity, linguistic balance, and nuanced meaning organically organised, which then requires the wit of a trained academic to uncover and explicate.“58
Earnshaw setzt die von Wimsatt und Beardsley in ihrem Essay »The Intentional Fallacy« (1946) dargelegte Ansicht, Leser/innen vermögen die Intentionen des Autors/der Autor/in niemals zu kennen und selbst der oder die Autor/in könnte Schwierigkeiten haben, sie zu erläutern, in Bezug zu Roland Barthes Aussage zum Tod des Autors und schlussfolgert hieraus:59
„We cannot know ›who is speaking‹, or, put another way, we cannot identify ›an author‹, because writing itself, or text, or textuality, has a certain characteristic which removes ›voice‹ and ›origin‹. This is a poststructural viewpoint, that everything exists as an interrelated text, unpickable, everything is text, including the world (pretty much). There is no such thing as individual identity, either for writers or for texts. In the poststructural view we, you and I, are ›subjects‹, constructed out of a myriad of historical and cultural forces. There is nothing unique about any of us, therefore there can be no unique individual called ›an author‹ to which or to whom we can refer if we want to understand what a text is saying.“60
Hinzugefügt werden müsste, dass an die Stelle des Spitzwegerischen armen Poeten und das Unbehagen über die Hierarchie sich ebenjene Hierarchisierung über die Hintertür erneut hereinschlich; es ist eine des Marktes und der (Selbst-) ← 19 | 20 → Vermarktung, seien es Homestories, Autoren als Unterwäschemodels oder ähnliche Inszenierungen.61 Man ist heutzutage hauptberufliche/r Autor/in – zumindest nach außen hin. Wer seinen Brotberuf aufgab, verwendet fürderhin viel Schreibzeit für Marketing- und PR-Aktivitäten, was der Brite Levin Michael wie folgt kritisch kommentiert: „It is possible that some writers find these supplementary activities as demanding as the work they gave up in the first place.“62 Dennoch bleibt das Einkommen aufgrund der künstlerischen Arbeit für die meisten von ihnen relativ dürftig und muss mittels anderer Jobs gestützt werden, die oftmals in artverwandten Tätigkeiten des Literarischen Schreibens, u.a. in der Lehre als Dozent/in in Schreibstudien- und Schreiblehrgängen, gesucht werden.63 Michael Levin bringt das Dilemma der beruflichen Unsicherheit der Literat/innen in seinem Resümee auf den Punkt: „Writing is a profession, rather than a job, though it rarely pays a professional salary and most other professional careers are simply too demanding to be combined effectively with writing.“64 Bedenkt man, dass Literat/innen heute mehrheitlich ihr Dasein als Autor/in – unabhängig von der Frage, ob und in welchem Ausmaß sie einer weiteren Erwerbstätigkeit in einem sogenannten Brotberuf nach(zu)gehen haben – als Berufstätigkeit definieren, stellt sich dennoch die Frage, welcher Art ein solcher Beruf ist, wenn er einzig in Ausnahmefällen dazu dient, das Alltagsleben der Künstler/innen zu finanzieren.65 John Milne verwehrt sich daher auch einer in Gleichsetzung von Einkommen und Professionallität: „If earning your main living from writing was the test of professionalism there would be few of us indeed.“66
Gehen wir noch einmal zu Vargas Llosas freier Wahl bzw. zum Traumstatus »Iwannabe« zurück, der dieser Entscheidung zuvor geht, denn was David Bradley für die USA konstatiert, lässt sich auf andere Länder gleichfalls übertragen: „American society doesn’t like writers, but loves to pass judgment on a writer’s legitimacy, and, worse, it uses piss-poor criteria, like how frequently and/or ← 20 | 21 → lucratively your work is published.“67 Ein/e Möchte-Gern-Autor/in68 zu sein, das sei einzig Kindern gestattet,69 danach jedoch setze unweigerlich die Frage nach Erfolgen ein – auch nach finanziellen; hinzu kommt, dass für Literat/innen jener Sehnsuchts-Status nie aufhören kann, denn er gilt für jedes nächste Werk erneut, es solle ›besser‹ gelingen, das heißt es soll näher an die ursprüngliche, imaginierte Vorstellung heranreichen.70
Das Bemühen, die eigene Ich-Identität, nach der man sich bereits Autor/in nennt, während das Debüt erst entstehen muss, in Einklang mit den alltäglich üblichen Begriffen von Arbeit oder Arbeitsprozess zu bringen, setzt sich in einem permanenten Scheitern verglichen mit dem zuvor imaginierten Werk ebenso fort, wie im Wunsch, das eigene Tun nach außen hin zu legitimieren, und dies teilweise über Jahrzehnte bis erreicht wird, was man gemeinhin ›Durchbruch‹ nennt. Es sollte daher nicht verwundern, dass sich unter diesen Umständen für viele zumindest ab und an der Schreibprozess selbst zu einem „Ringen“71 um jeden einzelnen Satz entwickelt und fehle dieser quälerische Prozess, sogleich die Qualität in Frage gestellt wird.72 Angst erklären manch andere ebenfalls als „[…] wichtige[n] Antrieb […]“73 des Schreibens, selbst wenn sie betonen, es handle sich dabei um eine besondere Form der Besorgnis: „Aber die Art Angst, aus der heraus ich ← 21 | 22 → schreibe, macht mir Spaß.“74 Eine Angst, die zahllose Literat/innen thematisieren ist jene, die ihnen am Beginn einer Arbeit begegnet: Die Sorge nicht oder nie mehr schreiben zu können,75 die Angst vor dem Versagen.76
Wie sehr die innere, emotionale Einstellung zum ergriffenen Beruf differiert, zeigt sich in nachstehenden Äußerungen. So betonen manche wie Martin Walser77 das Vergnügen, der zudem mit dem Kommentar, „Wer sich schreibend verändert, ist ein Schriftsteller.“78 eine auffallende Definition trifft. Diese Selbstaussage begründet Walser damit, dass man einzig die Auswirkung auf sich selbst beobachten könne; ob das Werk auf andere Menschen Einfluss habe und wenn ja welchen, ließe sich hingegen niemals verifizieren,79 „[…] leidend [zu] reagier[en], das ist das Handeln des Schriftstellers.“80
Ist für die einen das Schreiben die Existenz und changiert dadurch von Lust zur Qual und zum Vergnügen, so wird es manchen zur „[…] furchtbare[n] Sklaverei […]“,81 wie z.B. Wolfgang Koeppen es nennt, sobald man von den hierdurch erzielten Einkünften leben müsse: „Der Zwang des Schreibens quält unter anderen Qualen. Es ist nicht der Schreibtisch, es ist das Leben. Es ist auch ein ständiges Glück.“82 Für Hermann Burger ist Schreiben ein Dialog mit dem verinnerlichten ← 22 | 23 → Idealleser, der ihm Lektor wird;83 für Hans Christoph Buch ist es „[…] Auseinandersetzung mit der je gegebenen Umwelt […]“84 – also mit der einen umgebenden Wirklichkeit;85 und darüber hinaus zudem „[…] ein Dialog mit der Literatur der Vergangenheit […].“86 Für manche ist Schreiben auch eine Möglichkeit sich des eigenen Da-Seins zu versichern:
„Warum also schreiben? Ich habe plötzlich damit angefangen, vor Jahren, als mir langweilig war, als ich mir abhanden zu kommen drohte, als ich im Elternhaus unters Dach gezogen war, als ich mit einem Mal aufgehört hatte, mich mitzuteilen (oder ist das bereits Selbstmystifikation?), als mir die Gesprächspartner abhandengekommen waren, als ich in die Pubertät kam und mir war so eigenartig, als mir langweilig war, als ich traurig war; als ich ein anderes Spiel spielen wollte; als ich meiner rechten Hand zuschaute, wie sie auf einem Blatt Papier ein paar Worte anordnete. Schreiben ist eine Krankheit, die man gerne loswerden würde. Schreiben und Trinken laufen oft parallel, damit das Schreiben nicht so allein ist. Spazieren gehen in der Natur zum Beispiel ist ein Ausweg, der nur wieder zum Schreiben führt.“87
Wie auch immer Einzelne das Schreiben für sich sehen mögen, wie sie zur Frage nach Autor/innenschaft als Beruf stehen, in einem Punkt herrscht auffallender Konsens: Jedes Werk, das mit einem Wunschtraum beginne, werde verglichen mit dem intendierten Werk ein Dokument des Scheiterns. An diesem Charakterzug eines Kunstwerks ändere sich auch dann nichts, wenn man es, wie von Earnshaw ← 23 | 24 → dargelegt, für autonom erkläre, es von sich selbst abspalte, sich auf die Position der unerklärbaren Schaffensprozesse zurückziehe. Schreiben sei nach Andrew Cowan ein „[…] on-going process, perfection impossible, completion elusive […].“88 Ebenso Georg Bydlinski:
„Und manchmal habe ich beim Schreiben den Eindruck, dass jeder Text, den man verfasst, auf seine Art ein erstes Manuskript [Hervorhebung i. O.] ist – eine neue Herausforderung, für die man das Bisherige vergessen muss, um wieder ganz frei zu sein. Ein neuer Weg auf einer Landkarte, die man erst beim Gehen zeichnet. Ein Expeditionsbericht vom Blick auf eine neue ›Welt‹ […].“89
Oder Daniel Kehlmann, der zudem den seitens der literarischen Welt zunehmenden Zwang zur Selbstaussage in seiner Poetikvorlesung kritisiert:
„Ich habe keine Ahnung. […] Es gibt keine Professionalität beim Schreiben. Jeder Autor ist bei jedem Projekt wieder am Anfang, es existieren keine Meisterprüfungen, die einen davor schützen würden, beim nächsten Mal die dümmsten Anfängerfehler zu machen. Man tastet immer. Das literarische Milieu jedoch drängt uns in die Rolle der selbstbewußten Auskunftgeber. Jeder hoffnungsvolle Schöpfer von zwei Kurzgeschichten und drei Gedichten, der das Glück hatte, seine ersten Zeilen in einer Literaturzeitschrift zu veröffentlichen, wird bereits vor ein Mikrofon gezerrt, wo man ihm Erklärungen abfordert, was das Schreiben an sich sei und wie er es damit halte.“90
Neuland zu betreten, so Melanie Thon, das sei jedes Mal die Aufforderung, die im Beginn impliziert sei: „Every story presents its own problems. For twenty-two years I’ve done this work, but I’m a beginner every time, searching for a new voice and a path that will lead to territory I haven’t charted.“91
Auch dass sich viele Etablierte nicht als solche fühlen, der Blick auf sie von außen nicht mit dem Empfinden des/der jeweiligen Autors/Autorin korrespondiere, ← 24 | 25 → erklärt sich gleichfalls dadurch, dass man immer am Anfang stehe:92 „No matter what the books behind one have achieved in the way of awards and recognition, one starts from scratch with each new act of creation.“93 Oder Clarence Major: „Each act of writing becomes a whole new experience, which is why it’s so difficult. It’s not like a nine-to-five job where you know what you’re supposed to do every day […].“94
Eben wegen jenes permanenten sich am Beginn Befindens definiert Richard Yates, der an der »Columbia«, der »Boston University« sowie am »Iowa Writers’ Workshop« »Creative Writing« lehrte,95 Schreiben als Beruf und fügt hinzu: „It’s the hardest because you’re self-taught, because each story implies the ending of its own craft and you have to start over. It’s the loneliest because no one can help you.“96 Von Interesse ist hier außerdem die Betonung der autodidaktischen Notwendigkeit und der hierdurch begrenzten Lehrbarkeit aus dem Mund eines langjährigen Dozenten des Fachbereichs. Auch Charles Baxter legt den Fokus auf diese Schwierigkeit in seinem nachfolgenden Statement, das sich an junge Autor/innen richtet:
„It seems a shame to say so, but the hardest part of being a writer is not the long hours of learning the craft, but learning how to survive the dark nights of the soul. There are many such nights, far too many, as you will discover. I hate to be the one bring you this news, but someone should. Part of the deal of having a soul at all includes the requirement that you go through several dark nights. No soul, no dark nights.“97
Die erste Stufe des beruflichen Weges nennt er „[…] pretending to be a writer […]“98, denn man sitze ja zuerst und versuche zu schreiben:99 „The trouble is that the first stage […] never quite disappears. And there is, in this art, no ultimate ← 25 | 26 → validation […].“100 Darüber hinaus sei es auch eine permanente Auseinandersetzungen nicht nur mit sich selbst und dem imaginierten Idealwerk, sondern ebenso mit dem oft auch abwertenden und negative Echo, das von außen kommt und kommen muss: Irgendwer werde immer besser sein und/oder etwas zu kritisieren haben.101
Wallace Stegner unterstreicht durch seinen Vergleich des Entstehungsprozesses eines literarischen Werks mit dem begrenzten Einfluss, den man auf das Wachstum verschiedener Pflanzen habe, das Irreversible sowie das sich dem eigenen Willen Entziehende bestimmter Abläufe:
„l don’t know how books grow, but they have a seedtime and a growing time and a harvest time, like other plants. Sometimes you have to dig up a subject and sometimes you don’t know where you’re going when you start. You start it and it wants to go another way; you resist, and very often it goes its own way in spite of you. But it had better not go entirely its own way, because then you’re out of control.“102
Über diesen Aspekt einer dem Arbeitsprozess innewohnenden eigenen Dynamik, die folglich außerdem bei jedem Werk differiert, herrscht, im Gegensatz zu den sonst stark divergierenden Äußerungen hinsichtlich einer beruflichen Definition sowie einer Schreibmotivation und dem Empfinden des Schreibprozesses, in auffallender Weise Konsens.
Christoph Meckel weist in seiner Darstellung seiner persönlichen Konfrontation mit der Frage nach den Beweggründen seines Schreibens außerdem auf nationale Unterschiede hin:
„Die beliebte Frage ›Warum schreiben Sie?‹, mit der jeder Autor in Deutschland beworfen wird (in dieser von Fortschritt und Nützlichkeitszwang erschöpften, von Angst und Therapie gequälten Gesellschaft), ist nicht möglich in einem Land, wo Mangel herrscht, nicht zu hören dort, wo das Dasein in Frage steht. Das Selbstverständliche wird dort nicht befragt, es wird dort nicht bezweifelt, es wird gebraucht. Ich wurde in Brasilien nicht gefragt, in Italien, Polen und Israel nicht gefragt. Ich wurde in USA und Australien gefragt, ich wurde an keiner Stelle von Kindern gefragt.“103
Trotz aller Divergenzen in diesen Selbstaussagen von Autor/innen zum Schreibprozess, zur Motivation ihrer Autor/innenschaft und zur Frage, ob sie Beruf genannt ← 26 | 27 → werden kann, sind zwei Gemeinsamkeiten auffallend, die hier nochmals zusammengefasst werden sollen, da sie beide sich in die Lehrhaltung im Fachbereich einprägen: einerseits die Begeisterung für das Lesen sowie andererseits das Erleben, in ihrem Schreiben mit jedem neuen Werk stets wieder am Anfang zu stehen. Beide Erfahrungen kennzeichnen Werdegänge; die erstere führt oftmals zum Hinweis, ohne Lektüre werde keine/r zum oder zur Autor/in.104 Die andere Erfahrung ist diejenige, dass in der Kunst kaum allgemeingültige Regeln existieren, und – verglichen mit anderen wissenschaftlichen Gebieten – ein Wissen nur teilweise vermittelt werden kann; die Aussage „Wenn es eine Regel für das Schreiben gibt, dann die, dass es keine Regeln gibt. Immer wenn mir jemand von einer Regel erzählt, nehme ich mir sofort vor, sie zu brechen.“105 ist symptomatisch für diesen Lehrbereich.
Implizit zeigt obige Zusammenschau auch die nebeneinander existierenden, divergierenden Werdegänge in ihrer widersprüchlichen Pluralität oder – um den Bogen zur anfänglich erwähnten Redensart erneut zu spannen –: Alle Wegen führen nach Rom. Ob diese Annahme korrekt ist, welche Umwege gegangen werden, ob jene von Vorteil oder möglicherweise nachteilig für den/die Autor/in sind, soll in dieser Arbeit geprüft werden.
Ausgangspunkt der Arbeit war, die pädagogischen Rahmenbedingungen im Bereich der Lehre Literarischen Schreibens zu untersuchen, um die These zu prüfen, dass das elementare Prinzip der Ausbildung in einem institutionellen Rahmen keine anderen Grundzüge aufweist als der autodidaktische Weg: Die Auseinandersetzung mit Literatur anderer Autor/innen, ein Einüben des bewussten Lesens sowie die Erfahrung der Textkritik zu ersten eigenen Arbeiten; dennoch gibt es Unterschiede – eventuell in der Effizienz, im Tempo, besonders auch im Renommee und den hierdurch zur Verfügung stehenden Netzwerken –, die sich signifikant auf den weiteren beruflichen Weg der Autor/innen auswirken können. Sie prägen nicht nur die Differenz zwischen autodidaktischem und institutionellem Weg, sondern sie wirken sich auch in einer bevorzugten Wahl eines bestimmten Ausbildungsortes aus, dessen Ansehen gleichfalls auf diese Entscheidung Einfluss nimmt.
Im Rahmen der hier vorgelegten Arbeit kann nur ein grober Überblick über einzelne Positionierungen im literarischen Feld der Schreibstudiengänge gegeben werden. Für eine vertiefte Analyse hätte der Fokus der Fragestellung enger gesetzt werden müssen, was hinsichtlich mangelnder wissenschaftlicher Untersuchungen ← 27 | 28 → zum deutschsprachigen Raum sowie zu einer vergleichenden Analyse der pädagogischen Haltung nicht möglich war. So manche Fragestellung wird daher in diesem Forschungsvorhaben unbeantwortet bleiben müssen oder nur angerissen werden können, wird von anderen später vielleicht in Einzeldarstellungen untersucht werden können.
Auf eine kurze Vorstellung von Varianten des autodidaktischen Wegs, der nach wie vor neben dem institutionellen Lernen existiert, den pädagogischen Grundprinzipien und Thesen im institutionellen Bereich folgt eine detaillierte Darstellung der einzelnen universitären Angebote im deutschsprachigen Raum.
Neben der klassischen Recherche in Primär- und Sekundärwerken zum Thema, wobei ich auch unveröffentlichtes Material nutzen konnte, das mir dankenswerterweise von den jeweiligen Autor/innen zur Verfügung gestellt wurde, arbeitete ich außerdem nach der qualitativen Methode mit narrativen Interviews, die für die Fragestellungen am sinnvollsten schienen.
Ein Frage-Antwort-Verfahren wäre nur bei den Eingangsfragen nützlich zu erachten gewesen, da eine Differenz der Aussagen zu erwarten war und es obendrein das hauptsächliche Motiv der Interviews war, das persönliche Erleben der Einzelnen in seiner Komplexität zu erforschen. Vollstandardisierte Interviews schieden von vornherein aufgrund divergierender Strukturen der einzelnen Institute als nicht zielführender Modus Operandi aus. Das halbstandardisierte Interview, bei Instituten mit einer außergewöhnlichen Schwerpunktsetzung eventuell um ein oder zwei zusätzliche Fragen zu ebenjenen Spezifika ergänzt, schien geeigneter zu sein.
Davon abgesehen folgte der Fragenkatalog des mündlichen Interviews sowie jener für den schriftlich zu beantwortenden Fragebogen einer für alle Institute identen Struktur in Form von Expert/innen-Interviews. Als Gesprächseinstieg wurden sehr klare, einfache Fragestellungen genutzt, damit die Interviewpartner/innen in Fluss kommen konnten. Nachgehakt wurde erst bei Verstummen der oder des Sprechenden, oftmals erst im späteren Verlauf des Gesprächs falls eine Blockade spürbar wurde.
Um aufgrund der durchschnittlich recht langen Interviewdauer von ca. 2 Stunden einer Ermüdung vorzubeugen, wurden im mittleren Teil überraschendere und emotionalere Fragen eingefügt. Die Reihenfolge der Fragen des Leitfadeninterviews wurde teilweise an den Gesprächsverlauf angepasst, da eine bewusste Unterbrechung des narrativen Charakters, der sich etablierte, nicht Anliegen der Interviewerin war. Alle Gespräche wurden digital aufgenommen und zugleich auch währenddessen protokolliert.
Bei den schriftlich zu beantwortenden Fragebögen, die per E-Mail über Institute oder Autor/innenverbände ausgesandt wurden, stellte sich der benötigte narrative ← 28 | 29 → Charakter als Problem heraus. Zum einen sollte die Fragestellung bewusst offen gehalten werden, weshalb Modelle wie multiple choice-Verfahren von vornherein ausschieden, um den Absolvent/innen nicht indirekt eine Antwort nahe zu legen. Es wurde versucht, zum einen durch in Klammer gesetzte themenbezogene Stichwörter die Bandbreite des in jener Frage angesprochenen Gedankenkomplexes anzudeuten, ohne jedoch in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Von den vierzehn gestellten Fragen beziehen sich neun explizit auf das jeweilige Institut bzw. den jeweiligen Verein, den der oder die Absolvent/in sich auswählte. Zwei Punkte fokussieren die Vor- und Nachteile einer Ausbildung im Allgemeinen, zwei weitere bitten beim Besuch mehrerer Institute oder Vereine um einen Vergleich sowie um eine konkrete in Bezug Setzung zum eigenen Werdegang. Die beiden abschließenden Fragen beziehen sich auf die Zukunft: Wie sieht er oder sie die eigene Zukunft als Autor bzw. Autorin? Glaubt er oder sie, dass sich die literarische Szene durch die Zunahme an Bildungsangeboten im deutschsprachigen Raum verändern wird und in welcher Hinsicht seiner bzw. ihrer Ansicht nach.
Manchmal ergaben sich in weiterer Folge regelrechte Korrespondenzen mit Student/innen und Absolvent/innen, die teilweise auch auf ein Konvolut von 50 Seiten im Austausch über eine bestimmte Fragestellung anwachsen konnten, u.a. weil die Interviewten sie mit eigenen Essays ergänzten.
Die Fragebögen für Studierende und Absolvent/innen wurden aus Gründen des Datenschutzes über die Institute verteilt, wodurch auch die Menge der zurück erhaltenen Bögen variierte. An manchen Instituten, so zum Beispiel in Hildesheim und am »LCB«, entstanden außerdem auch Dialoge mit Studierenden, die in ein oder mehrere Interviews mündeten.
Die Auswertung der Fragebögen folgte der qualitativen Inhaltsanalyse. Nach einem Raster wurde zuerst geprüft, ob Auffälligkeiten hinsichtlich einer besonderen Dominanz oder eines Fehlens eines gewissen Aspekts bestanden, alsdann wurden die einzelnen Aussagen der jeweiligen Interviewten zu jenem Aspekt nach Instituten gesammelt, nebeneinander gestellt, ohne Widersprüche, die sich eventuell zu anderen Lehrhaltungen oder Werdegangsbeschreibungen ergaben, aufzulösen, sondern allenfalls darauf hinzuweisen.
Jede Wertung der Aussagen wäre einer Interpretation gleich gekommen; diese wurde der in Kapitel 6 vorgenommenen Beschreibung möglicher Werdegänge im 21. Jahrhundert vorbehalten. In jenem Abschnitt wird versucht, aus den erhaltenen Informationen aller Institute sowie der Aussagen autodidaktischer Literat/innen eine möglichst ideale Form einer Autor/innen-Aus- und Weiterbildung zu entwickeln. Eine Interpretation in der Darstellung der Initiativen verbat sich auch aufgrund der Tatsache, dass die Autorin selbst als Lehrende tätig ist und allfällige subjektive ← 29 | 30 → Wertungen, zu denen es hierdurch kommen könnte, im Sinne einer objektiven Darstellung ausgeschlossen werden sollten. Im Hinblick auf eine Innensicht auf das Seminargeschehen als solches, die üblicherweise angewandten Techniken sowie in die sich entwickelnde Gruppendynamik in Textwerkstätten waren diese Kenntnisse der Verfasserin sicherlich von Vorteil, ebenso in der Verflochtenheit mit den Kolleg/innen; nachteilig wirkten sie sich in den Möglichkeiten der interpretativen Beurteilung aus.
Bedauerlicherweise war es in dieser Überblicksarbeit nicht möglich, das Gruppengeschehen in den Werkstätten der einzelnen Institute über einen längeren Zeitraum aktiv zu begleiten. Manche Lehrende verbaten sich dies mit dem Hinweis, es störe das Gruppengeschehen; wäre eine Teilnahme für diese Untersuchung notwendig, könne das übliche Bewerbungsprozedere und fallweise eben auch die Entrichtung der Lehrgebühr versucht werden, über eine Aufnahme der Verfasserin werde alsdann genau so entschieden wie bei jeder anderen Bewerbung auch; bei anderen Lehr- bzw. Studiengängen wie zum Beispiel am »LCB« und am »DLL« wurde die Möglichkeit des zeitlich begrenzten Hospitierens eingeräumt. Im Hinblick auf die für Interviews ausgewählten Lehrenden gestaltete sich das Auswahlprozedere – neben dem Wunsch nach einer möglichst breiten Fächerung im Hinblick auf Alter, Hintergrund und Fachgebiet – auch nach den Zeitplänen der Dozent/innen, da manche ihr Sabbatjahr nahmen oder einen Forschungsaufenthalt tätigten, andere zum Zeitpunkt meines Eintreffens am Ort des Instituts leider erkrankten oder schlicht ihre Zeitpläne durch andere Erfordernisse torpediert worden waren.
Jene Interviews, deren Aufnahmeort in den Fußnoten nicht vermerkt ist, fanden ausnahmslos in Wien statt. Alle Interviews, die in der Quellenangabe keine/n zweite/n GesprächspartnerIn verzeichnet haben, wurden von der Autorin dieser Arbeit selbst geführt. Ein Abdruck aller transkribierten Interviews in ihrem Gesamttext war aufgrund der Fülle des gewonnenen Materials nicht möglich. Die zusammengefassten Inhalte wurden den Kolleg/innen, welche dies wünschten, zur Einsichtnahme vorgelegt, um etwaige durch Raffung entstandenen Fehlinterpretationen auszuräumen.
Jene, die nur bereit waren, anonym einen Fragebogen auszufüllen bzw. die einzelne Antworten anonymisiert wissen wollten, weil sie aufgrund ihres Status als Student/in an einem Institut bei negativen Aussagen Konsequenzen fürchteten, wurde dies gewährt. Manche erbaten eine Anonymisierung, obgleich keine einzige Aussage objektiv betrachtet kritisch genannt werden kann, er/sie [Durch diese Schreibweise soll auch ein Rückschluss auf das Geschlecht der Interviewten verunmöglicht werden.] berief sich auf die Sensibilität der Künstler/innen,106 man ← 30 | 31 → wisse nie, mit welcher Aussage man in ein Fettnäpfchen tappe. In dieser Angst anzuecken bildet sich auch das hierarchische System der universitären Institute ab, welches – sobald eine Form der hierarchischen Wechselbeziehung z.B. durch Benotung oder Abhängigkeit von Netzwerken entsteht – die anvisierte Begegnung auf Augenhöhe, die sich im pädagogischen Konzept des Workshops grundsätzlich als arbeitsrelevante Ausgangsbedingung beschrieben findet, verunmöglicht. Die hinter den chiffrierten Fragebögen stehenden Personen sind der Autorin namentlich bekannt.
Dass Interviews, wie die Germanistin Konstanze Fliedl kritisch anmerkte,107 stets nur eine persönliche Meinung wiedergeben, ist der Autorin bewusst. Um etwaige Stimmungen als Grund für eine Aussage auszuschließen wurde deshalb versucht, mit so zahlreichen Personen wie irgend möglich mehrmals zu sprechen, bzw. ihnen ihre Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt nochmals schriftlich zur Durchsicht und allfälligen Korrektur oder Ergänzung zukommen zu lassen. Interessante Auffälligkeiten bei den Interviews waren auf Seiten der Dozent/innen im gesamten deutschsprachigen Raum aber auch in den Schulen, die in der »EACWP« versammelt sind, die Abgrenzungsmechanismen durch Abwertung anderer Initiativen, teilweise ohne detaillierte Kenntnisse derselbigen. Bei Autor/innen außerhalb der Institute war eine allgemeine Skepsis gegenüber der Lehrbarkeit spürbar sowie im Laufe der Interviews die häufig geäußerte Erkenntnis, man wisse eigentlich nicht wirklich, was ›dort‹ geschehe, man habe keine Innensicht.
Seitens der Studierenden bzw. Absolvent/innen war auffallend, dass sie sich beinahe vollständig von ihren ehedem eingereichten Bewerbungstexten distanzierten, diese als ›peinlich‹ oder als mittlerweile längst hinter sich gelassene erste Versuche titulierten.
Da es sich bei den Interviewten größtenteils um Autor/innen handelt, die Tag für Tag mit Sprache arbeiten, erschien es auch angebracht, ein Augenmerk auf Auffälligkeiten im Duktus der Institute zu legen, wenn dieser besonders auffallend war, sei es im Hinblick auf die Pädagogik oder auf eine bestimmte Haltung gegenüber der literarischen Arbeit an und für sich. In Zitaten aus Interviews oder Fragebögen markierte ich diese Passagen daher mit [!] und bezog diese Aspekte in die schlussfolgernde Auswertung in Kapitel 6 mit ein.
Um auch für diejenigen, die zu Beginn der Lektüre dem Thema noch fremd gegenüberstehen, die Lesbarkeit zu erhöhen, war es ein Anliegen, eine einheitliche Zeichensetzung insbesondere auch im Hinblick auf die zahlreichen Namen der Institute und Initiativen einzuführen, die ich mit doppelten Guillemets (»…«) ← 31 | 32 → bzw. in Primärzitaten, wenn sie als Eigennamen nicht ausgewiesen wurden, mit einfachen Guillemets in eckigen Klammern ([›]…[‹]) markierte. Ebenso wurden nationale und persönliche Vorlieben in divergierender Zeichensetzung vereinheitlicht, falls jene die Lesbarkeit erschwert hätte: Für Interviewpassagen, die Teil eines Artikels waren, nutzte ich einfache Guillemets, ebenso für Ironisierungen, die in Zitaten vorgenommen wurden. Etwaige spezifische Kürzel, die in dieser Arbeit verwendet werden, finden sich in einem Siglenverzeichnis am Ende aufgeschlüsselt.
1 Vgl.: Ortheil, Hanns-Josef: Das Element des Elephanten. Wie mein Schreiben begann. München, Zürich: Piper 1994. S. 179.
2 Ebenda. S. 181.
3 a.a.O.
4 Vgl.: Lodge, David: Write on. Occasional Essays ’65–’85. London: Secker & Warburg 1986. S. 77. Vgl. auch: Schulze, Ingo: Lesen und Schreiben oder […]. In: Zuerst bin ich immer Leser. Prosa schreiben heute. Hg.innen: Krupp, Ute-Christine; Janssen, Ulrike. Frankfurt am Main: edition suhrkamp 2000. S. 81.
Vgl. auch: Martin Walser. Lesen und Schreiben. Das ›letzte‹ Interview. In: Ndl. Neue deutsche literatur. Zeitschrift für deutschsprachige Literatur. Aufbau-Verlag. 46. Jg., 517. Heft, Januar/Februar 1998. S. 8.
5 Hanns-Josef Ortheil. Vgl.: Ortheil, Hanns-Josef: Das Element des Elephanten. Wie mein Schreiben begann. München, Zürich: Piper 1994. S. 189.
6 Schrott, Raoul: Die Erde ist blau wie eine Orange. München: dtv 1999. S. 135.
7 Schulze, Ingo: Lesen und Schreiben oder […]. In: Zuerst bin ich immer Leser. Prosa schreiben heute. Hg.innen: Krupp, Ute-Christine; Janssen, Ulrike. Frankfurt am Main: edition suhrkamp 2000. S. 82.
8 Vgl.: Ebenda. S. 91.
9 Martin Walser. Lesen und Schreiben. Das ›letzte‹ Interview. In: Ndl. Neue deutsche literatur. Zeitschrift für deutschsprachige Literatur. Aufbau-Verlag. 46. Jg., 517. Heft, Januar/Februar 1998. S. 8.
10 a.a.O.
11 Vgl.: Schulze, Ingo: Lesen und Schreiben oder […]. In: Zuerst bin ich immer Leser. Prosa schreiben heute. Hg.innen: Krupp, Ute-Christine; Janssen, Ulrike. Frankfurt am Main: edition suhrkamp 2000. S. 89.
12 Vgl.: Schneider, Michael: Am Anfang war nicht das Wort, sondern das (Ver)schweigen. In: Es muss sein. Autoren schreiben über das Schreiben. Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch 1989. S. 155.
13 Schneider, Michael: Am Anfang war nicht das Wort, sondern das (Ver)schweigen. In: Es muss sein. Autoren schreiben über das Schreiben. Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch 1989. S. 155.
Details
- Pages
- 577
- Publication Year
- 2014
- ISBN (Softcover)
- 9783631639146
- ISBN (PDF)
- 9783653038958
- ISBN (MOBI)
- 9783653996968
- ISBN (ePUB)
- 9783653996975
- DOI
- 10.3726/978-3-653-03895-8
- Language
- German
- Publication date
- 2013 (December)
- Keywords
- Creative Writing AutodidaktInnen Narrative Kunst Lehrbarkeit Literarischen Schreibens Schreibstudiengänge
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. 577 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG