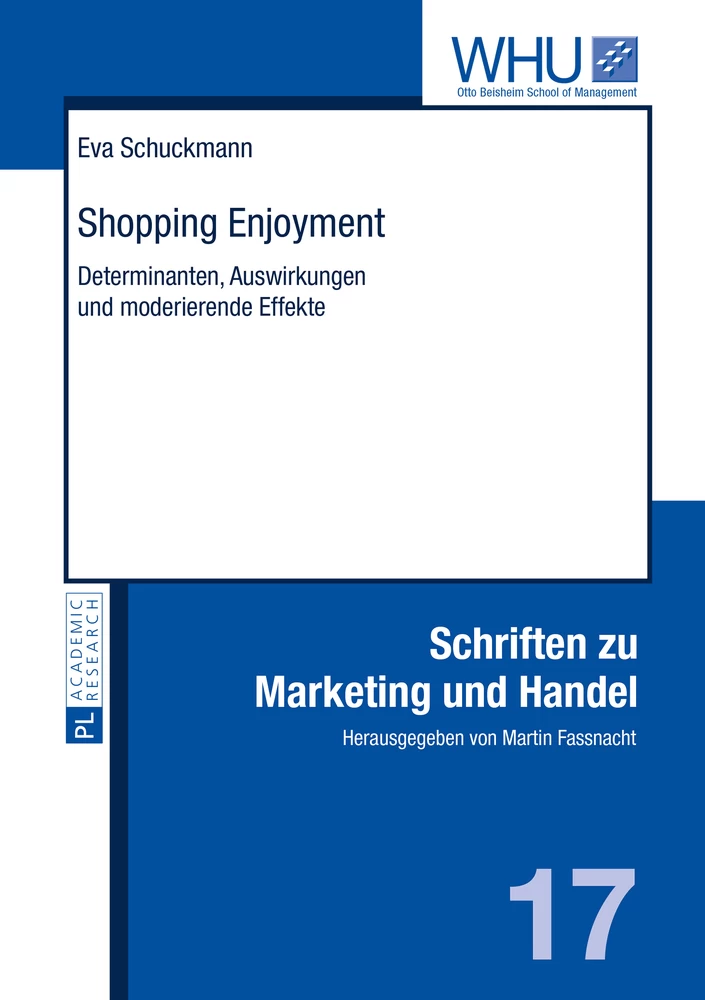Shopping Enjoyment
Determinanten, Auswirkungen und moderierende Effekte
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Motivation der Arbeit
- 1.2 Zielsetzung der Untersuchung
- 1.3 Gang der Untersuchung
- 2. Grundlagen der Untersuchung
- 2.1 Theoretische Grundlagen von Konsumentenemotionen
- 2.1.1 Der Emotionsbegriff
- 2.1.1.1 Begriffsverstnis der Psychologie
- 2.1.1.2 Begriffsverstnis der Konsumentenverhaltensforschung
- 2.1.1.3 Abgrenzung weiterer Emotionsbegriffe
- 2.1.2 Messung von Emotionen
- 2.1.3 Konsumentenemotionen als wissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand
- 2.2 Begriffliche Grundlagen von Shopping Enjoyment
- 2.2.1 Shopping als Bezugsobjekt
- 2.2.2 Der Begriff Shopping Enjoyment im Spiegel der Literatur
- 2.2.3 Definition von Shopping Enjoyment
- 2.3 Konzeptionelle Grundlagen von Shopping Enjoyment
- 2.3.1 Relevante Grundlagen zur Konzeptualisierung von Shopping Enjoyment in der Literatur
- 2.3.2 Konzeptualisierung von Shopping Enjoyment
- 2.4 Theoretische Grundlagen von Shopping Enjoyment
- 2.4.1 Umweltpsychologisches Verhaltensmodell von Mehrabian/Russell (1974) als theoretischer Bezugspunkt
- 2.4.2 Anwendung des umweltpsychologischen Verhaltensmodells auf den Shoppingprozess von Konsumenten
- 3. Untersuchungsmodell
- 3.1 Das Untersuchungsmodell im ?erblick
- 3.2 Hypothesen zu den direkten Effekten
- 3.2.1 Wirkungszusammenhe zwischen den Determinanten und Shopping Enjoyment
- 3.2.1.1 Annehmlichkeit der Geschsste
- 3.2.1.2 Professionalitdes Beratungsangebots
- 3.2.1.3 Attraktivitdes Sortiments
- 3.2.1.4 Attraktivitder Preisposition
- 3.2.1.5 Attraktivitdes Angebots an Zusatzleistungen
- 3.2.2 Wirkungszusammenhe zwischen Shopping Enjoyment und den Auswirkungsvariablen
- 3.2.2.1 Unmittelbare Verhaltensauswirkungen
- 3.2.2.2 Auswirkungen auf die Einstellung
- 3.2.2.3 Auswirkungen auf Verhaltensabsichten
- 3.2.2.4 Erfolgsauswirkungen
- 3.3 Hypothesen zu den moderierenden Effekten
- 3.3.1 Moderierende Effekte psychographischer Konsumentenmerkmale
- 3.3.1.1 Shoppingorientierung
- 3.3.1.2 Globaler Gemtand
- 3.3.2 Moderierende Effekte soziodemographischer Konsumentenmerkmale
- 3.3.2.1 Alter 88
- 3.3.2.2 Geschlecht
- 3.3.2.3 Haushaltsgr
- 3.3.2.4 Monatliche Haushaltsnettoeink
- 4. Grundlagen der empirischen Untersuchung
- 4.1 Konzeption der empirischen Untersuchung
- 4.1.1 Erhebungsdesign
- 4.1.2 Entwicklung des Erhebungsinstruments
- 4.1.3 Datenerhebung und Datengrundlage
- 4.2 Methodische Grundlagen der Datenanalyse
- 4.2.1 Grundlagen der Konstruktmessung
- 4.2.2 Strukturgleichungsmodelle
- 4.2.3 Partial Least Squares-Ansatz als Verfahren zur Analyse von Strukturgleichungsmodellen
- 4.2.4 Güterien zur Beurteilung der Messmodelle
- 4.2.5 Güterien zur Beurteilung des Strukturmodells
- 4.2.6 Modellierung moderierender Effekte
- 5. Ergebnisse der empirischen Untersuchung
- 5.1 Untersuchung der direkten Effekte
- 5.1.1 Messung der relevanten Konstrukte
- 5.1.1.1 Shopping Enjoyment
- 5.1.1.2 Determinanten von Shopping Enjoyment
- 5.1.1.3 Auswirkungen von Shopping Enjoyment
- 5.1.2 Ergebnisse der Hypothesenpr
- 5.1.2.1 Wirkungszusammenhe zwischen den Determinanten und Shopping Enjoyment
- 5.1.2.2 Wirkungszusammenhe zwischen Shopping Enjoyment und den Auswirkungsvariablen
- 5.1.3 Fazit
- 5.2 Untersuchung der moderierenden Effekte
- 5.2.1 Messung der relevanten Konstrukte
- 5.2.1.1 Psychographische Konsumentenmerkmale
- 5.2.1.2 Soziodemographische Konsumentenmerkmale
- 5.2.2 Ergebnisse der Hypothesenpr
- 5.2.2.1 Psychographische Konsumentenmerkmale
- 5.2.2.2 Soziodemographische Konsumentenmerkmale
- 5.2.3 Fazit
- 6. Abschlie?nde Betrachtung
- 6.1 Zusammenfassende Bewertung der Arbeit
- 6.1.1 Zentrale Ergebnisse
- 6.1.2 Wissenschaftliche Bewertung
- 6.2 Implikationen der Arbeit
- 6.2.1 Ansatzpunkte f Forschung
- 6.2.2 Implikationen f Unternehmenspraxis
- Literaturverzeichnis
Abbildung 2–1: Systematik der Verfahren zur Emotionsmessung
Abbildung 2–2: Phasen des Einkaufsprozesses und Einordnung des Shoppingprozesses (Eigene Darstellung)
Abbildung 2–3: Circumplex Model of Affect.
Abbildung 2–4: Umweltpsychologisches Verhaltensmodell von Mehrabian/Russell (in Anlehnung an: Mehrabian/Russell 1974, S. 8)
Abbildung 2–5: Modifiziertes Umweltpsychologisches Verhaltensmodell (1)
Abbildung 2–6: Modifiziertes Umweltpsychologisches Verhaltensmodell (2)
Abbildung 3–1: Untersuchungsmodell zu Shopping Enjoyment
Abbildung 3–2: Moderatoren im Untersuchungsmodell zu Shopping Enjoyment
Abbildung 3–3: Hypothesen des Untersuchungsmodells im Überblick
Abbildung 4–1: Aufbau der empirischen Untersuchung
Abbildung 4–2: Ablauf des Quotenanpassungsprozesses
Abbildung 4–3: Reflektive und formative Indikatoren
Abbildung 4–4: Einfaches Strukturgleichungsmodell
Abbildung 4–5: Der PLS-Algorithmu
Abbildung 4–6: Einfluss moderierender Variablen auf die Wirkbeziehung zweier Variable
Abbildung 4–7: Überprüfung eines Moderatoreffekts am Beispiel Geschlecht
Abbildung 4–8: Bildung einer Interaktionsvariable zur Überprüfung eines moderierenden Effekts (in Anlehnung an Baron/Kenny 1986, S. 1174
Tabelle 2–1: Ausgewählte Arbeiten zu Facetten der emotionspsychologischen Konsumentenverhaltensforschung
Tabelle 2–2: Ausgewählte Definitionen zu Shopping Enjoyment
Tabelle 4–1: Quoten zur Erfassung nationaler Repräsentativität
Tabelle 4–2: Entscheidungsregeln zur Identifikation formativer und reflektiver Messmodelle
Tabelle 4–3: Gütekriterien und Anspruchsniveaus zur Beurteilung reflektiver Messmodelle in PLS
Tabelle 4–4: Gütekriterien und Anspruchsniveaus zur Beurteilung von Strukturmodellen in PLS
Tabelle 5–1: Gütebeurteilung des Konstrukts Shopping Enjoyment
Tabelle 5–2: Gütebeurteilung des Konstrukts Annehmlichkeit der Geschäftsstätte
Tabelle 5–3: Gütebeurteilung des Konstrukts Professionalität des Beratungsangebots
Tabelle 5–4: Gütebeurteilung des Konstrukts Attraktivität des Sortiments
Tabelle 5–5: Gütebeurteilung des Konstrukts Attraktivität der Preisposition
Tabelle 5–6: Gütebeurteilung des Konstrukts Attraktivität des Angebots an Zusatzleistungen
Tabelle 5–7: Gütebeurteilung des Konstrukts Verweildauer
Tabelle 5–8: Gütebeurteilung des Konstrukts Produktinteresse
Tabelle 5–9: Gütebeurteilung des Konstrukts Kaufimpulsivität
Tabelle 5–10: Gütebeurteilung des Konstrukts Fehler-/Mängeltoleranz
Tabelle 5–11: Gütebeurteilung des Konstrukts Kundenloyalität
Tabelle 5–12: Gütebeurteilung des Konstrukts Preisbereitschaft
Tabelle 5–13: Gütebeurteilung des Konstrukts Bon-/Ausgabenhöhe
Tabelle 5–14: Cross-Loadings zur Beurteilung der Diskriminanzvalidität auf Indikatorenebene
Tabelle 5–15: Fornell-Larcker-Kriterium zur Beurteilung der Diskriminanzvalidität auf Konstruktebene
Tabelle 5–16: Ergebnisse der Hypothesenprüfung zu den direkten Effekten zwischen Shopping Enjoyment und den Determinanten
Tabelle 5–17: Ergebnisse der Hypothesenprüfung zu den direkten Effekten zwischen Shopping Enjoyment und den unmittelbaren Verhaltensauswirkungen
Tabelle 5–18: Ergebnisse der Hypothesenprüfung zu den direkten Effekten zwischen Shopping Enjoyment und den Auswirkungen auf die Einstellung
Tabelle 5–19: Ergebnisse der Hypothesenprüfung zu den direkten Effekten zwischen Shopping Enjoyment und den Verhaltensabsichten
Tabelle 5–20: Ergebnisse der Hypothesenprüfung zu den direkten Effekten zwischen Shopping Enjoyment und den Erfolgsauswirkungen
Tabelle 5–21: Gütebeurteilung des Konstrukts Hedonistische Shoppingorientierung
Tabelle 5–22: Gütebeurteilung des Konstrukts Utilitaristische Shoppingorientierung
Tabelle 5–23: Gütebeurteilung des Konstrukts Smart Shoppingorientierung
Tabelle 5–24: Gütebeurteilung des Konstrukts Globaler Gemütszustand
Tabelle 5–25: Empirische Überprüfung moderierender Effekte einer hedonistischen Shoppingorientierung
Tabelle 5–26: Empirische Überprüfung moderierender Effekte einer utilitaristischen Shoppingorientierung
Tabelle 5–27: Empirische Überprüfung moderierender Effekte einer Smart Shoppingorientierung
Tabelle 5–28: Empirische Überprüfung moderierender Effekte des globalen Gemütszustands
Tabelle 5–29: Empirische Überprüfung moderierender Effekte des Alters
Tabelle 5–30: Empirische Überprüfung moderierender Effekte des Geschlechts
Tabelle 5–31: Empirische Überprüfung moderierender Effekte der Haushaltsgröße
Tabelle 5–32: Empirische Überprüfung moderierender Effekte der monatlichen Haushaltsnettoeinkünfte
Tabelle 5–33: Moderierende Effekte im Überblick
Mit dem gestiegenen Breitenwohlstand haben sich die Bedürfnisse von Konsumenten verändert und ihre Ansprüche kontinuierlich erhöht. Anstelle der Zufriedenstellung von Grundbedürfnissen und der Bedarfsdeckung an funktionalen Gütern und Dienstleistungen kommt heutzutage dem emotionalen Erleben im Rahmen des Konsums eine wesentliche Bedeutung zu: „Unübersehbar dominieren psychische und physische Formen des Genusses: gute Laune, Entspannung, Erregung, Unterhaltung, Gemütlichkeit, Coolness, Sensationen der Sinne – nie Gesehenes, nie Gehörtes, unvergleichliche Gefühle usw.“ (Schulze 2005, S. 545). Dieser Genuss- und Erlebniswunsch der Konsumenten erstreckt sich nicht nur auf den eigentlichen Konsum, sondern besteht bereits im Beschaffungszeitpunkt. Die Einkaufsaktivitäten bilden somit einen essentiellen Ansatzpunkt für den Handel zur Befriedigung dieser gefühlsbetonten Anspruchshaltung von Konsumenten.
Der Genuss- und Erlebnisnachfrage von Konsumenten liegt ein starkes Bedürfnis nach positiver emotionaler Aktivierung zugrunde, dessen Entstehung sich auf soziodemographische, sozioökonomische und soziokulturelle Veränderungen zurückführen lässt:
Details
- Seiten
- XVI, 251
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (Hardcover)
- 9783631650486
- ISBN (PDF)
- 9783653040975
- ISBN (MOBI)
- 9783653988277
- ISBN (ePUB)
- 9783653988284
- DOI
- 10.3726/978-3-653-04097-5
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (August)
- Schlagworte
- Handel e-Commerce Einkaufserlebnis Einkaufsvergnügen Einkaufsumgebung
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. XVI, 251 S., 39 Tab., 17 Graf.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG