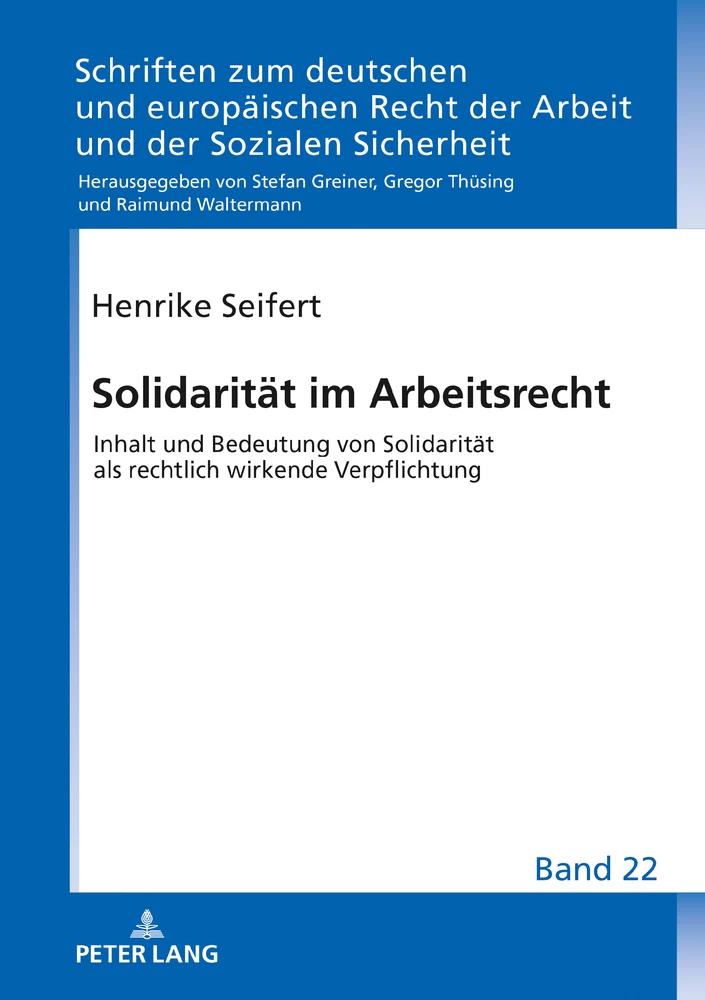Solidarität im Arbeitsrecht
Inhalt und Bedeutung von Solidarität als rechtlich wirkende Verpflichtung
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Herausgeberangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einführung
- A. Problemstellung und Relevanz
- B. Methode und Gang der Untersuchung
- Teil 1 Grundlagen der Solidarität in Soziologie, Ethik und Recht
- A. Solidarität − Begriff, Grundbedingungen und Erscheinungsformen
- I. Begriffsursprung: Die obligatio in solidum des Römischen Privatrechts
- II. Begriffsverständnis in Soziologie, Philosophie und Christlicher Soziallehre
- 1. Der Solidaritätsbegriff in der Soziologie
- a) Empirische Gesellschaftsforschung
- b) Die Bedeutung der Lehre Durkheims
- c) Weiterentwicklungstendenzen
- 2. Begriffsausprägungen in der Ethik
- a) Moral und Ethik
- b) Der Solidaritätsbegriff in der philosophischen Ethik
- c) Der Solidaritätsbegriff in der Christlichen Ethik
- 3. Schlussfolgerungen
- III. Grundbedingungen für Solidarität?
- 1. Solidarität und Gleichheit
- 2. Solidarität und Gemeinschaft
- IV. Erscheinungsformen von Solidarität
- 1. Typologie der Solidarität
- a) Altruismus
- b) Erweiterte Reziprozität
- c) Kollektivitätsorientierte Solidarität
- d) Loyalität
- 2. Insbesondere: Solidarität als Kampfbegriff der Arbeiterbewegung
- V. Ergebnis zu A.
- B. Normierung von Solidarität durch Moral und Recht
- I. Moral und Recht als Normenkomplexe
- 1. Regelungscharakter
- 2. Differenzierung zwischen moralischen und rechtlichen Normen
- a) Ursprung und Allgemeingültigkeitsfrage
- b) Normakzeptanz und Normanspruch
- c) Sanktionsmodalitäten
- II. Moral und Recht als Sozialnormen
- 1. Notwendigkeit von Sozialnormen nach den Erkenntnissen der Spieltheorie
- a) Das Gefangenendilemma
- b) Auflösung durch Sozialnormen
- 2. Sicherstellung von Solidarität durch Sozialnormen
- a) Erfordernis nach spieltheoretischen Grundsätzen
- b) Risiko des naturalistischen Fehlschlusses
- III. Regelungszusammenhang zwischen Moral und Recht?
- 1. Fehlende rechtliche Wirkung moralischer Normen
- 2. Kein Rechtfertigungszusammenhang
- IV. Normierung rechtlicher Verpflichtungen im Arbeitsrecht
- 1. Rechtsnormen
- 2. Die Bedeutung richterlicher Rechtsfortbildung
- V. Ergebnis zu B.
- C. Zusammenfassung zu Teil 1
- Teil 2 Solidarität zwischen Arbeitnehmern
- A. Solidarität der Arbeitnehmerschaft
- I. Solidarität als Rechtsprinzip des Arbeitsrechts
- 1. Ausgangspunkt: Die Sphärentheorie von Reichsgericht und Reichsarbeitsgericht
- 2. Weiterentwicklung in der Arbeitskampfrisikorechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
- 3. Zulässigkeit der Rechtsfortbildung
- a) Anforderungen an richterliche Rechtsfortbildung
- b) Stellungnahme: Rechtsprinzip der Solidarität als unzulässige Rechtsfortbildung extra legem
- 4. Abkehr der Rechtsprechung von einem Rechtsprinzip der Solidarität
- 5. Zwischenergebnis
- II. Solidarität als Bestandteil der Koalitionsfreiheit aus Art. 9 Abs. 3 GG
- 1. Stellung der Gewerkschaften und Umfang der Tarifgeltung
- a) Umfang der Tarifmacht
- aa) Keine umfassende Tarifmacht aufgrund virtueller Repräsentation
- bb) Kein Regelungsauftrag für den gesamten Arbeitsmarkt
- b) Tarifgeltung für Außenseiter auf gesetzlicher und individualvertraglicher Grundlage
- aa) Gesetzliche Erstreckung von Tarifrecht
- (1) Allgemeinverbindlicherklärung und Rechtsverordnung
- (2) Abgrenzung zu mitgliedschaftlich legitimierter Tarifgeltung
- bb) Privatautonome Anwendung von Tarifrecht über Bezugnahmeklauseln
- (1) Inhalt und Grenzen der Inbezugnahme
- (2) Abgrenzung zu mitgliedschaftlich legitimierter Tarifgeltung
- c) Stellungnahme und Schlussfolgerungen
- 2. Arbeitskampf und Außenseiterbeteiligung
- a) Streikrecht der Außenseiter
- aa) Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie
- bb) Kein Widerspruch zum Mächtigkeitserfordernis
- b) Aussperrung von Außenseitern
- c) Stellungnahme und Schlussfolgerungen
- 3. Unzulässige Zwangssolidarisierung
- a) Fehlende Kontur einer umfassenden Arbeitnehmersolidarität
- b) Freiheitsrecht und negative Koalitionsfreiheit
- 4. Zwischenergebnis
- III. Solidarität auf Grundlage der einfachgesetzlichen Wertungen in § 36 Abs. 3 SGB III und § 11 Abs. 5 AÜG
- 1. Beschränkung der Arbeitsvermittlung an bestreikte Betriebe
- 2. Stellung von Leiharbeitnehmern im Arbeitskampf
- a) Leistungsverweigerung nach § 11 Abs. 5 AÜG a. F.
- b) Einsatzverbot des Leiharbeitnehmers als Streikbrecher nach § 11 Abs. 5 AÜG n. F.
- 3. Zwischenergebnis
- IV. Ergebnis zu A.
- B. Solidarität auf Gewerkschaftsebene
- I. Koalitions- und vereinsrechtliche Grundlagen
- 1. Die Bedeutung verbandsinterner Geschlossenheit für die Verwirklichung des Koalitionszwecks
- 2. Die vereinsrechtliche Förderpflicht
- a) Charakter der allgemeinen mitgliedschaftlichen Förderpflicht
- b) Aktive und passive Förderpflichten
- II. Solidaritätspflichten der Gewerkschaftsmitglieder
- 1. Kollision zwischen individueller und kollektiver Koalitionsfreiheit
- 2. Kollektivitätsorientierte Solidaritätspflichten
- a) Folgepflicht im Arbeitskampf
- aa) Eintreten der Folgepflicht
- bb) Inhalt der Folgepflicht
- b) Sonderfall Solidaritätsstreik
- aa) Charakteristik des Solidaritäts- oder Unterstützungsstreiks
- bb) Haupt- und Unterstützungsarbeitskampf derselben Gewerkschaft
- cc) Haupt- und Unterstützungsarbeitskampf verschiedener Gewerkschaften
- 3. Loyalitätspflichten
- a) Berechtigung zu Opposition
- aa) Geltung des Demokratieprinzips?
- bb) Grundrechte der Gewerkschaftsmitglieder
- b) Unterstützung konkurrierender oder gewerkschaftsfeindlicher Organisationen
- aa) Mitgliedschaft in einem konkurrierenden Verband
- bb) Konkurrenz im Rahmen betrieblicher Mitbestimmung
- cc) Unterstützung gewerkschaftsfeindlicher Organisationen
- 4. Zwischenergebnis
- III. Sanktionierung von Solidaritätsverstößen
- 1. Durchsetzung der Solidaritätspflichten und Anwendbarkeit von Vereinsstrafrecht
- 2. Insbesondere: Ausschluss des Mitglieds aus dem Verband
- a) Ausschluss als Vereinsstrafe oder Kündigung
- b) Formelle Anforderungen
- c) Ausschluss aus sachlichem Grund durch Vereinsstrafe
- d) Ausschluss aus wichtigem Grund durch Kündigung
- IV. Ergebnis zu B.
- C. Innerbetriebliche Solidarität
- I. Solidarität nach der Lehre der Betriebsgemeinschaft
- 1. Personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis und Betriebsgemeinschaft
- 2. Anwendungsbereiche
- a) Verlust von Gratifikationsansprüchen
- aa) Darstellung der Entscheidungen
- bb) Stellungnahme: Unzulässige Rechtsfortbildung
- cc) Weiterentwicklung der Rechtsprechung
- b) Kürzung und Wegfall von Ruhegeldzahlungen
- aa) Darstellung der Rechtsprechung
- bb) Stellungnahme: Unzulässige Rechtsfortbildung
- 3. Absage an eine rechtlich wirkende Betriebsgemeinschaft
- II. Ableitung aus Rechtsnormen
- 1. Belegschaft als tatsächliche Gemeinschaft mit arbeitsrechtlicher Relevanz
- a) Die betriebsverfassungsrechtliche Belegschaft
- b) Das Belegschaftsverständnis abseits des Betriebsverfassungsrechts
- c) Bedeutung und Stellung der Belegschaft
- d) Schlussfolgerung und Fortgang der Untersuchung
- 2. Sozialauswahl nach § 1 Abs. 3 KSchG
- a) Grundsätze der Sozialauswahl
- b) Keine Solidaritätsverpflichtung
- aa) Systematik des Kündigungsschutzrechts
- bb) Widerspruch zu Sonderkündigungsschutz
- 3. Betriebliche Normen im Sinne von § 3 Abs. 2 TVG
- a) Anwendungsbereich betrieblicher Normen
- b) Geltungsgrund und Wirkungsweise
- c) Keine solidarische Verpflichtung der Arbeitnehmer im Rahmen eines betrieblichen Rechtsverhältnisses
- 4. Innerbetriebliche Haftungsbeschränkung nach § 105 Abs. 1 SGB VII
- III. Ergebnis zu C.
- D. Zusammenfassung zu Teil 2
- Teil 3 Solidarität zwischen Arbeitgebern
- A. Keine Solidarität der Arbeitgeberschaft
- B. Solidarität auf Verbandsebene
- I. Koalitions- und vereinsrechtliche Grundlagen
- II. Kollektivitätsorientierte Solidaritätspflichten der Verbandsmitglieder
- 1. Verpflichtung auf die Tarifpolitik des Arbeitgeberverbands
- a) Firmentarifvertrag als Solidaritätsproblem
- aa) Tariffähigkeit des Arbeitgebers nach § 2 Abs. 1 TVG
- bb) Verhältnis von Verbandstarifvertrag und Firmentarifvertrag
- b) Teleologische Einschränkung von § 2 Abs. 1 TVG?
- aa) Individuelle Koalitionsfreiheit des abweichenden Arbeitgebers
- bb) Kollektive Koalitionsfreiheit des Arbeitgeberverbands
- (1) Keine Beeinträchtigung der Bestandsgarantie
- (2) Auswirkungen auf die Betätigungsfreiheit
- (3) Zulässige gesetzliche Ausgestaltung von Art. 9 Abs. 3 GG
- cc) Individuelle Koalitionsfreiheit der verbandstreuen Arbeitgeber
- dd) Zwischenergebnis
- c) Vorgaben für das Tarifverhalten durch die Verbandssatzung
- aa) Arten und Wirkung von Abschlussverboten
- bb) Zulässigkeit von Abschlussverboten
- (1) Koalitionsfreiheit des Verbandsmitglieds
- (2) Gewerkschaftliche Betätigungsfreiheit
- d) Zwischenergebnis
- 2. Folgepflicht im Arbeitskampf
- a) Streikhilfeverpflichtungen
- aa) Relevanz und Inhalt
- bb) Verbandsrechtliche Zulässigkeit
- cc) Kartellrechtliche Zulässigkeit
- (1) Verbot wettbewerbsbeschränkender Absprachen durch § 1 GWB
- (2) Kartellrechtliche Bereichsausnahme für das Tarifrecht
- (3) Zulässigkeit vereinbarungsimmanenter Wettbewerbsbeschränkungen
- b) Verbot des Separatfriedens durch Firmentarif
- c) Zwischenergebnis
- III. Loyalitätspflichten der Verbandsmitglieder
- IV. Sonderfall OT-Mitgliedschaft
- 1. Stufenmodell als Regelfall
- 2. Verbandsrechtliche Stellung des OT-Mitglieds
- 3. Eingeschränkte Solidaritätsverpflichtung
- a) Kollektivitätsorientierte Solidaritätspflichten
- b) Loyalitätspflichten
- V. Sanktionierung von Solidaritätsverstößen
- C. Zusammenfassung zu Teil 3
- Teil 4 Solidarität im Arbeitsverhältnis
- A. Loyalität als Bestandteil der arbeitsvertraglichen Nebenpflichten
- I. Die Bedeutung von Loyalitätspflichten zum Ausgleich von Interessengegensätzen
- II. Inhalt und Umfang der arbeitsvertraglichen Nebenpflichten
- 1. Normative Grundlage in § 241 Abs. 2 BGB
- 2. Rücksichtnahme, Schutz und Loyalität
- B. Loyalitätspflichten des Arbeitnehmers
- I. Wettbewerbsverbot
- 1. Illoyale Konkurrenz in Widerspruch zu § 241 Abs. 2 BGB
- a) Selbstständige Wettbewerbstätigkeit
- b) Wettbewerb im Rahmen eines weiteren Arbeitsverhältnisses
- 2. Unlauterer Wettbewerb im Sinne der §§ 3, 4 UWG
- II. Verschwiegenheitspflicht
- 1. Unternehmensbezogener Geheimnisschutz
- a) Primärer Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
- b) Diskretion zu weiteren geheimhaltungsbedürftigen Umständen
- 2. Grenzen der arbeitsvertraglichen Verschwiegenheitspflicht
- a) Beteiligung des Arbeitnehmers an einem gegen den Arbeitgeber geführten gerichtlichen Verfahren
- aa) Der Arbeitnehmer als Zeuge im Strafverfahren
- bb) Der Arbeitnehmer als Zeuge im Zivilprozess
- b) Externes Whistleblowing
- aa) Zulässigkeit und Grenzen externen Whistleblowings
- (1) Interner Abhilfeversuch des Arbeitnehmers
- (2) Inhaltliche Berechtigung der Anzeige
- (3) Öffentliches Interesse an der Information
- (4) Motiv des Arbeitnehmers für die Anzeige
- (5) Schaden des Arbeitgebers
- (6) Zwischenergebnis
- bb) Sonderfall: Whistleblowing gegenüber der Öffentlichkeit
- III. Unzulässigkeit rufschädigender Verhaltensweisen
- 1. Stellungnahmen des Arbeitnehmers in Widerspruch zur Unternehmenspolitik
- a) Auftreten des Mitarbeiters für das Unternehmen
- b) Stellungnahmen im rein privaten Umfeld
- 2. Ehrverletzende Äußerungen
- C. Loyalitätspflichten des Arbeitgebers
- I. Verschwiegenheitspflicht
- 1. Schutz der Arbeitnehmerpersönlichkeit
- 2. Grenzen der Verschwiegenheit
- a) Aufdeckung von Straftaten durch Beauftragung einer Detektei
- b) Strafanzeige des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer
- II. Achtung der persönlichen Ehre
- 1. Reaktion auf Fehlverhalten oder Kündigung des Arbeitnehmers
- 2. Wahrnehmung unternehmerischer Wettbewerbsinteressen
- D. Rechtsfolgen von Loyalitätsverstößen
- I. Verstöße des Arbeitnehmers
- II. Verstöße des Arbeitgebers
- E. Zusammenfassung zu Teil 4
- Teil 5 Solidarität zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
- A. Der Grundsatz vertrauensvoller Zusammenarbeit nach § 2 Abs. 1 BetrVG
- I. Magna Charta der Betriebsverfassung
- II. Maximen der Kooperation zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
- 1. Zusammenarbeit mit gemeinschaftlichem Gestaltungsziel
- a) Wohl des Betriebs
- b) Wohl der Arbeitnehmer
- 2. Betriebsverfassungsrechtliche Ausprägung von Treu und Glauben
- III. § 2 Abs. 1 BetrVG als Grundlage solidarischer Verpflichtungen der Betriebspartner
- B. Reziproke Solidaritätspflichten der Betriebspartner
- I. Informationspflichten des Arbeitgebers
- 1. Erteilung von Auskünften
- 2. Zurverfügungstellung von Unterlagen
- 3. Hinzuziehung von Auskunftspersonen und Sachverständigen
- II. Verhandlungspflicht der Betriebspartner
- III. Störungsverbote
- 1. Die betriebsverfassungsrechtliche Friedensordnung nach § 74 Abs. 2 BetrVG
- a) Grundrechtsschutz im Verhältnis der Betriebspartner
- b) Abstrakter Schutz für Arbeitsablauf und Betriebsfrieden
- aa) Beiderseitiges Arbeitskampfverbot
- bb) Parteipolitische Neutralitätspflicht
- c) Verbot der konkreten Beeinträchtigung von Arbeitsablauf und Betriebsfrieden
- aa) Einbeziehung der Belegschaft in Auseinandersetzungen der Betriebspartner
- bb) Austragung von Konflikten in der außerbetrieblichen Öffentlichkeit
- 2. Schutz der Funktionsfähigkeit des Betriebsratsamtes durch § 78 BetrVG
- a) Behinderungsverbot
- b) Benachteiligungs- und Begünstigungsverbot
- c) Behinderungsverbot des Betriebsrats gegenüber dem Arbeitgeber?
- C. Loyalitätspflichten der Betriebspartner
- I. Geheimnisschutz durch den Betriebsrat
- 1. Umfang der Verschwiegenheitspflicht
- a) Geheimhaltung über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
- b) Weitergehende Verschwiegenheitspflichten aus § 2 Abs. 1 BetrVG?
- 2. Externes Whistleblowing durch Betriebsratsgremium und Mitglieder des Betriebsrats
- a) Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes
- b) Anzeige anderweitigen Fehlverhaltens des Arbeitgebers
- aa) Externes Whistleblowing durch den Betriebsrat als Organ
- bb) Externes Whistleblowing durch das einzelne Betriebsratsmitglied
- II. Ehrschutz im Verhältnis der Betriebspartner
- D. Rechtsfolgen von Solidaritätsverstößen
- I. Verstöße von Betriebsratsseite
- 1. Amtsenthebung von Betriebsratsmitgliedern und Auflösung des Betriebsrats
- 2. Ergänzende Sanktionsmöglichkeiten
- II. Verstöße des Arbeitgebers
- E. Zusammenfassung zu Teil 5
- Ergebnisse der Untersuchung in Thesen
- Literaturverzeichnis
- Reihenübersicht
25→Abkürzungsverzeichnis
Einführung
A.Problemstellung und Relevanz
Eine Verknüpfung zwischen Arbeitsrecht und Solidarität zu leugnen ist nahezu unmöglich. Seit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert ging der Solidaritätsbegriff mit der entstandenen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung Hand in Hand und seine Bedeutung setzte sich im 20. Jahrhundert fort. Auch heute, lange nach Ende der politisch geprägten Arbeiterbewegung,1 hat Solidarität in der Arbeit der Gewerkschaften als ideeller Wert tragende Bedeutung. Ihre Tradition und ihr Selbstverständnis formuliert ver.di unter anderem mit den Worten: „Solidarität ist die Macht der Vielen. Gewerkschaft ist fühlbare und praktische Solidarität“.2 Aktuelle arbeitsrechtliche Beispiele liefern der zweiwöchige Tarif- und Solidaritätsstreik der hessischen Bus- und Straßenbahnfahrer im Januar 20173 oder die wiederkehrenden Streiks der Lokführer und Piloten.
Diese arbeitskampfrechtlichen Themen sind es auch, die bisher im Fokus der Solidaritätsfrage standen. Arbeitsrechtliche Rechtsprechung und Literatur beschäftigen sich bis heute nahezu ausschließlich mit der Frage einer Solidarität unter Arbeitnehmern.
Die Rechtsprechung lässt dabei keine klare Kontur erkennen. Der Schwerpunkt der Solidaritätsrechtsprechung ist in den 1950er und 1960er Jahren zu finden. Während das BAG in seinen Anfängen eine allseitige Solidarität der Arbeitnehmerschaft proklamierte,4 finden sich derart deutliche Hervorhebungen nach Abkehr von der so genannten Sphärentheorie heute ←31 | 32→nicht mehr. Auch die Annahme einer Solidarität der im selben Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer untereinander5 zieht die Rechtsprechung nicht mehr zur Begründung rechtlicher Verpflichtungen heran. Erneute Aktualität hat das Solidaritätsthema erhalten, als der Erste Senat des BAG6 im Juni 2007 den gemeinhin auch als Solidaritätsstreik bezeichneten Unterstützungsarbeitskampf für zulässig erklärte.7 Weniger ins Auge gestochen ist dagegen sicherlich die Feststellung desselben Senats in einer Entscheidung aus dem April 2007 zur Zulässigkeit von Streiks um einen Tarifsozialplan, dass die Solidarität der Koalitionsmitglieder Teil der für das Arbeitskampfrecht maßgeblichen Kampfparität sei.8 Dogmatische Erklärungen und rechtliche Anknüpfungspunkte für das Solidaritätsargument sucht man in sämtlichen Entscheidungen vergebens.
Die Literatur geht zumeist ebenfalls darüber hinweg, dass Solidarität rechtliche Wirkung nicht aus sich heraus entfalten kann. Rechtliche Verpflichtung bedarf einer rechtlichen Form und Grundlage. Der erforderlichen Trennung zwischen soziologischen Feststellungen, ethischen Grundsätzen und rechtlicher Verpflichtungswirkung wird regelmäßig kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Eine Verankerung der Arbeitnehmersolidarität in rechtlichen Vorschriften lassen die meisten Ausführungen ebenso vermissen wie eine tragfähige Konkretisierung von Inhalt und Grenzen einer Solidarität unter Arbeitnehmern.
Details
- Pages
- 314
- Publication Year
- 2018
- ISBN (Hardcover)
- 9783631764473
- ISBN (PDF)
- 9783631765203
- ISBN (ePUB)
- 9783631765210
- ISBN (MOBI)
- 9783631765227
- DOI
- 10.3726/b14550
- Language
- German
- Publication date
- 2018 (December)
- Keywords
- Koalitionsfreiheit Arbeitskampf Loyalität Sphärentheorie Betriebsgemeinschaft vertrauensvolle Zusammenarbeit
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2018. 309 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG