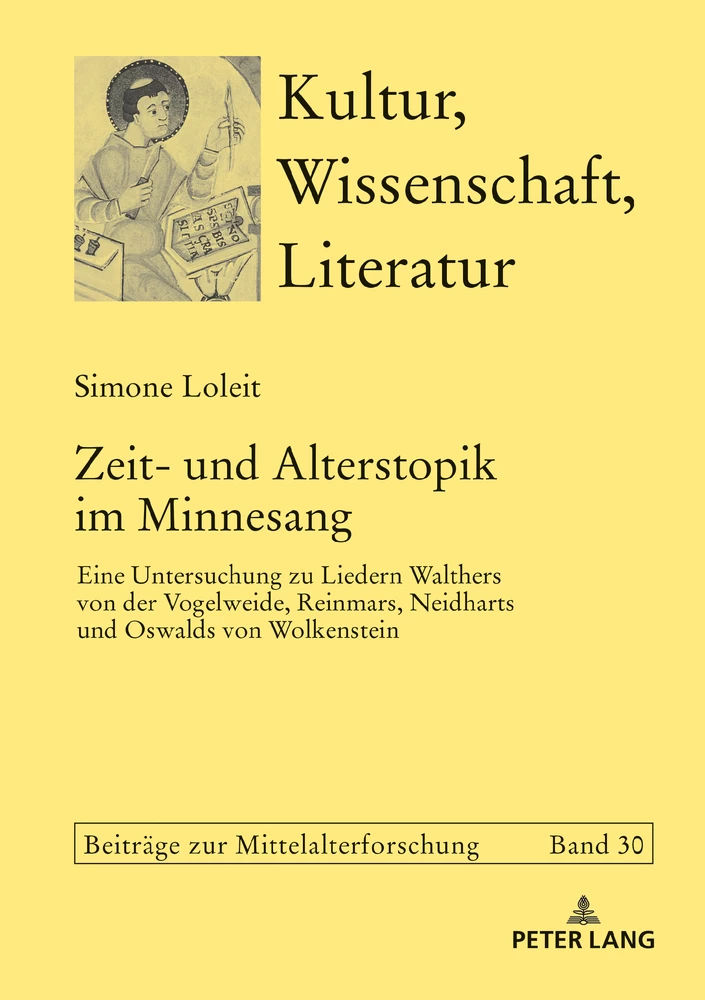Zeit- und Alterstopik im Minnesang
Eine Untersuchung zu Liedern Walthers von der Vogelweide, Reinmars, Neidharts und Oswalds von Wolkenstein
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Einleitung
- 1. Zeittopik
- 2. Gegenstand, Methodik und Untersuchungsziele
- 3. Aufbau der Untersuchung
- Teil I: Grundlagen: Topik und Minnesang
- 1. Ansätze der Toposforschung
- 1.1. Zum Realitätsgehalt von Topoi
- 1.2. Topik und (poetische) Argumentation
- 1.3. Topos und Metapher
- 2. Beweisführung, Erfahrung, ‚Meinung‘ und Dialogizität
- 2.1. Enthymem und Paradeigma
- 2.2. Zur Kategorie der Erfahrung
- 2.2.1. Zur Kategorie der Erfahrung im Minnesang – die Ansätze Brinkmanns und Eikelmanns
- 2.2.2. Zum geschichtswissenschaftlichen Erfahrungsbegriff nach Koselleck und seiner Relevanz für die Toposforschung
- 2.3. Dialektik und Dialog — eine Frage der Form?
- 2.3.1. Wie sol man gewarten dir – Walthers Weltabsage
- 2.3.2. Welt, ich hân dînen lôn ersehen – zur Strophe L 67,8 des ‚Alterstons‘
- 2.4. Minnesang als ‚Meinungsbildung‘
- 2.4.1. Voraussetzungen endoxaler Verständigung in der antiken Topik und im Minnesang
- 2.4.2. Minneauffassung zwischen Konsens und Kontroverse
- 2.5. Zur doppelten Adressatenstruktur der Lieder
- 2.5.1. Verbaler Schlagabtausch – Walthers Dialoglied Ich hœre iu sô vil tugende jehen
- 2.5.2. Kontroverse und Persuasion in Liedern Walthers und Reinmars
- Teil II: Grundlagen: Zeit und Minnesang
- 1. Zeit und Zeitlichkeit
- 1.1. Vom Umgang mit der Zeit
- 1.1.1. Kairos
- 1.1.2. Konstellationen der Weltabsage in Walthers ‚Abschiedsdialog‘, ‚Alterston‘ und Ein meister las
- 1.1.3. Zeitverschwendung als Sünde in den Liedern Kl 39, Kl 10 und Kl 6 Oswalds von Wolkenstein
- 1.2. Zeitlichkeit und Ewigkeit
- 1.2.1. Augustinus: Sprechen über die Zeit
- 1.2.2. Zeit und Schöpfung – problematische Schönheit (Augustinus, Minnesang)
- 1.2.3. Die Schlussstrophe der ‚Lebensballade‘ (Kl 18)
- 1.2.4. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft (I)
- 1.2.5. Tempusgebrauch in Reinmars Lied Ich wirbe umbe allez, daz ein man
- 1.3. Zeit(gerüst) und Argumentation
- 1.3.1. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft (II)
- 1.3.2. Aussagen zur Zeit im Umfeld antiker Topik und Rhetorik
- 1.3.3. Zeit, Narration und Argumentation
- 1.3.4. ‚Erlebte Zeit‘ in Oswalds Ain anefangk
- 1.4. Lyrische Aneignungen apokalyptischen Zeitdenkens
- 1.4.1. Zeitknappheit, Frühkapitalismus und Apokalyptik
- 1.4.2. Apokalyptisches Zeitdenken im Minnekontext (Oswald, Kl 68, Walther, L 48,12)
- 2. Lebensalter, Jahreszeiten, Generationen
- 2.1. Denken in Analogien
- 2.1.1. Modelle zur Unterteilung der Lebensalter
- 2.1.2. Frauenpreis und Jahreszeiten-, Kosmos- und Naturvergleiche im Minnesang
- 2.1.3. Neidharts ‚liebeslustige Alte‘
- 2.2. Lebensalterwissen
- 2.2.1. Wissen über altersangemessenes Verhalten
- 2.2.2. Das christliche Ideal der Alterstranszendenz
- 2.3. Linearität und Zyklizität
- 2.3.1. Lebensalter
- 2.3.2. Generationen
- Teil III: Minnesangspezifische Ausprägungen der Zeittopik
- 1. Geliebte Frau Welt
- 1.1. Frau Welt-Topos und Zeittopik
- 1.1.1. Exkurs wandel/wandelbære
- 1.2. Welt und Minne
- 1.2.1. Zur religiösen Verwendung des Welttopos in Liedern Walthers und Oswalds
- 1.2.2. Drehbewegungen
- 1.2.3. Zum Verhältnis von Welt- und Minnedienst in Liedern Walthers
- 1.2.4. Weltschelte und Frauenkritik in Liedern Neidharts
- 1.2.5. Welt- und Minnedienst in Liedern Oswalds von Wolkenstein
- 1.3. Welt und Alter
- 1.4. Grundkonstellation der Lieder mit (Frau) Welt-Topos
- 2. Vergangenheiten
- 2.1. Perspektiven in und auf Zeit
- 2.1.1. Gegenwärtige Vergangenheit
- 2.1.2. Antizipiertes Erinnern/Vergessen
- 2.1.3. Ubi sunt-Topik
- 2.1.4. Der ‚Spiegelraub‘ als zeitlicher Nullpunkt
- 2.1.5. Perspektivische Verschiebungen im Zusammenhang mit Zeitklage und laudatio temporis acti
- 2.2. Rückblick
- 2.2.1. Die Position des ungevüegen im Kontext von Zeitklage und laudatio temporis acti
- 2.2.2. Wiederkehr der alten Zeiten? Zeitaktuelles bei Neidhart
- 2.2.3. Minnebezogene Zeitklagen
- 2.3. Rückblick aus religiöser Perspektive
- 3. Minnevergangenheit
- 3.1. Klassifikation, Abgrenzungskriterien und Materialsammlung
- 3.2. Lesbarkeit nach dem Muster der Biographie/Chronologie?
- 3.3. Gegenwart des Vergangenen
- 3.3.1. Eine nicht enden wollende Geschichte: Neidharts Dörper
- 3.3.2. Bedeutsame Momente und Dauer
- 3.3.3. Individualisierte Gegenwartsklage und Vergangenheitslob
- 3.3.4. Exkurs: Lese-Buch-Geschichten?
- 3.4. Narration und Persuasion
- 3.4.1. Liedübergreifende Vergangenheit?
- 3.4.2. Vergangenheitskonstruktionen im Wechsel
- 3.4.3. Nonverbale Kommunikation
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Reihenübersicht
Simone Loleit
Zeit- und Alterstopik
im Minnesang
Eine Untersuchung zu Liedern Walthers
von der Vogelweide, Reinmars, Neidharts
und Oswalds von Wolkenstein
![]()
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Gedruckt mit Unterstützung des Förderungsfonds Wissenschaft der VG WORT.
Die frei zugängliche digitale Publikation wurde ermöglicht mit Mitteln des BMBF-Projektes OGeSoMo der Universitätsbibliothek Duisburg- Essen. In diesem Projekt wird Open Access für geistes- und sozialwissen-schaftliche Monografien gefördert und untersucht. Informationen und Ergebnisse finden Sie unter www.uni-due.de/ogesomo.
Abbildung auf dem Umschlag:
Notker Balbulus als Schreiber.
'Mindener' Tropar. Um 1025. Berlin theol. lat. quart. 11.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von:
Biblioteka Jagiellońska, Krakau.
ISSN 1615-665X
ISBN 978-3-631-75955-4 (Print)
E-ISBN 978-3-631-76130-4 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-631-76131-1 (EPUB)
E-ISBN 978-3-631-76132-8 (MOBI)
DOI 10.3726/b14371

Open Access: This work is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivatives 4.0 unported license. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
© Simone Loleit, 2018
Peter Lang GmbH
Internationaler Verlag der Wissenschaften
Berlin 2018
Peter Lang – Berlin · Bern · Bruxelles ·
New York · Oxford · Warszawa · Wien
Diese Publikation wurde begutachtet.
Über das Buch
Der Band präsentiert ein grundlegendes systematisch-theoretisches Gesamtkonzept zur Erforschung minnesangspezifischer Zeit- und Alterstopik sowie innovative Ergebnisse zur Walther-, Reinmar-, Neidhart- und Oswald-Philologie. Die Analysen widmen sich sowohl ‚kanonischen‘ als auch seltener behandelten Liedern der vier Autoren und arbeiten unter anderem mit Verfahren der rhetorischen und literaturwissenschaftlichen Toposforschung, der Varianzforschung und der Erzähltextanalyse.
Zitierfähigkeit des eBooks
Diese Ausgabe des eBooks ist zitierfähig. Dazu wurden der Beginn und das Ende einer Seite gekennzeichnet. Sollte eine neue Seite genau in einem Wort beginnen, erfolgt diese Kennzeichnung auch exakt an dieser Stelle, so dass ein Wort durch diese Darstellung getrennt sein kann.
Inhaltsverzeichnis
2. Gegenstand, Methodik und Untersuchungsziele
Teil I: Grundlagen: Topik und Minnesang
1.1. Zum Realitätsgehalt von Topoi
1.2. Topik und (poetische) Argumentation
2. Beweisführung, Erfahrung, ‚Meinung‘ und Dialogizität
2.2. Zur Kategorie der Erfahrung
2.2.1. Zur Kategorie der Erfahrung im Minnesang – die Ansätze Brinkmanns und Eikelmanns
2.2.2. Zum geschichtswissenschaftlichen Erfahrungsbegriff nach Koselleck und seiner Relevanz für die Toposforschung
2.3. Dialektik und Dialog — eine Frage der Form?
2.3.1. Wie sol man gewarten dir – Walthers Weltabsage
2.3.2. Welt, ich hân dînen lôn ersehen – zur Strophe L 67,8 des ‚Alterstons‘
2.4. Minnesang als ‚Meinungsbildung‘
2.4.1. Voraussetzungen endoxaler Verständigung in der antiken Topik und im Minnesang
2.4.2. Minneauffassung zwischen Konsens und Kontroverse←5 | 6→
2.5. Zur doppelten Adressatenstruktur der Lieder
2.5.1. Verbaler Schlagabtausch – Walthers Dialoglied Ich hœre iu sô vil tugende jehen
2.5.2. Kontroverse und Persuasion in Liedern Walthers und Reinmars
Teil II: Grundlagen: Zeit und Minnesang
1.1.2. Konstellationen der Weltabsage in Walthers ‚Abschiedsdialog‘, ‚Alterston‘ und Ein meister las
1.1.3. Zeitverschwendung als Sünde in den Liedern Kl 39, Kl 10 und Kl 6 Oswalds von Wolkenstein
1.2. Zeitlichkeit und Ewigkeit
1.2.1. Augustinus: Sprechen über die Zeit
1.2.2. Zeit und Schöpfung – problematische Schönheit (Augustinus, Minnesang)
1.2.3. Die Schlussstrophe der ‚Lebensballade‘ (Kl 18)
1.2.4. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft (I)
1.2.5. Tempusgebrauch in Reinmars Lied Ich wirbe umbe allez, daz ein man
1.3. Zeit(gerüst) und Argumentation
1.3.1. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft (II)
1.3.2. Aussagen zur Zeit im Umfeld antiker Topik und Rhetorik
1.3.3. Zeit, Narration und Argumentation
1.3.4. ‚Erlebte Zeit‘ in Oswalds Ain anefangk
1.4. Lyrische Aneignungen apokalyptischen Zeitdenkens
1.4.1. Zeitknappheit, Frühkapitalismus und Apokalyptik
1.4.2. Apokalyptisches Zeitdenken im Minnekontext (Oswald, Kl 68, Walther, L 48,12)
2. Lebensalter, Jahreszeiten, Generationen
2.1.1. Modelle zur Unterteilung der Lebensalter
2.1.2. Frauenpreis und Jahreszeiten-, Kosmos- und Naturvergleiche im Minnesang
2.1.3. Neidharts ‚liebeslustige Alte‘←6 | 7→
2.2.1. Wissen über altersangemessenes Verhalten
2.2.2. Das christliche Ideal der Alterstranszendenz
2.3. Linearität und Zyklizität
Teil III: Minnesangspezifische Ausprägungen der Zeittopik
1.1. Frau Welt-Topos und Zeittopik
1.1.1. Exkurs wandel/wandelbære
1.2.1. Zur religiösen Verwendung des Welttopos in Liedern Walthers und Oswalds
1.2.3. Zum Verhältnis von Welt- und Minnedienst in Liedern Walthers
1.2.4. Weltschelte und Frauenkritik in Liedern Neidharts
1.2.5. Welt- und Minnedienst in Liedern Oswalds von Wolkenstein
1.4. Grundkonstellation der Lieder mit (Frau) Welt-Topos
2.1. Perspektiven in und auf Zeit
2.1.1. Gegenwärtige Vergangenheit
2.1.2. Antizipiertes Erinnern/Vergessen
2.1.4. Der ‚Spiegelraub‘ als zeitlicher Nullpunkt
2.1.5. Perspektivische Verschiebungen im Zusammenhang mit Zeitklage und laudatio temporis acti
2.2.1. Die Position des ungevüegen im Kontext von Zeitklage und laudatio temporis acti
2.2.2. Wiederkehr der alten Zeiten? Zeitaktuelles bei Neidhart
2.2.3. Minnebezogene Zeitklagen
2.3. Rückblick aus religiöser Perspektive←7 | 8→
3.1. Klassifikation, Abgrenzungskriterien und Materialsammlung
3.2. Lesbarkeit nach dem Muster der Biographie/Chronologie?
3.3. Gegenwart des Vergangenen
3.3.1. Eine nicht enden wollende Geschichte: Neidharts Dörper
3.3.2. Bedeutsame Momente und Dauer
3.3.3. Individualisierte Gegenwartsklage und Vergangenheitslob
3.3.4. Exkurs: Lese-Buch-Geschichten?
3.4.1. Liedübergreifende Vergangenheit?
3.4.2. Vergangenheitskonstruktionen im Wechsel
3.4.3. Nonverbale Kommunikation
Literaturverzeichnis←8 | 9→
Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um die redigierte Fassung meiner Habilitationsschrift, die im April 2016 an der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Duisburg-Essen angenommen wurde.
Mein ausdrücklicher Dank gilt an erster Stelle Rüdiger Brandt, der die Arbeit über den gesamten Zeitraum ihres Entstehens umsichtig betreut und begleitet, durch Anregungen und Kritik gefördert und mich zur Weiterarbeit motiviert hat.
Sehr herzlich bedanken möchte ich mich auch bei Gaby Herchert, die das Zweitgutachten verfasst hat, bei der gesamten Habilitationskommission unter der Leitung von Jörg Wesche und nicht zuletzt bei Thomas Bein für das Außengutachten und die freundliche Aufnahme der Arbeit in seine Reihe.
Dem Peter Lang Verlag, namentlich Michael Rücker, Sonja Peschutter und Sandra Grundmann, danke ich für gute verlegerische Betreuung, der VG WORT für die Druckkostenübernahme. Besonderer Dank geht auch an Katharina Heidenreich, die durch gründliches Korrektorat zur Drucklegung dieser Arbeit beigetragen hat.
Ganz persönlich danken möchte ich meinen Eltern Erika und Günter Loleit und ganz besonders meinem Mann Holger Steinmann für vielfältige Unterstützung und wertvolle Anregungen.
Essen, im Februar 2018 S. L.
Die Bücher mußten zur Hand sein.1 Glaubt man dem Vorwort zum Gedichtband Die dreizehn Monate, so hatte Erich Kästner bei Abfassung der von einer Zeitschrift bestellten Gedichte den fünften Band des ‚Kleinen Brehm‘ (Die deutsche Tierwelt), das Werk Unsere Pflanzenwelt und einen Die deutsche Schulflora betitelten Leitfaden neben sich auf dem Schreibtisch liegen. Um den Auftrag zu erfüllen,
blieb dem Autor nichts übrig, als dem Kalender vorzugreifen. […] Er konnte nicht „nach der Natur“ arbeiten, sondern nur „aus dem Gedächtnis“, und darauf war, wie er bald merkte, kein Verlaß.2
Details
- Seiten
- 402
- Erscheinungsjahr
- 2018
- ISBN (Hardcover)
- 9783631759554
- ISBN (PDF)
- 9783631761304
- ISBN (ePUB)
- 9783631761311
- ISBN (MOBI)
- 9783631761328
- DOI
- 10.3726/b14371
- Open Access
- CC-BY-NC-ND
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (November)
- Schlagworte
- Liebeslyrik Religiöse Lyrik 1150–1450 Rhetorik Varianz Performanz
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2018. 401 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG