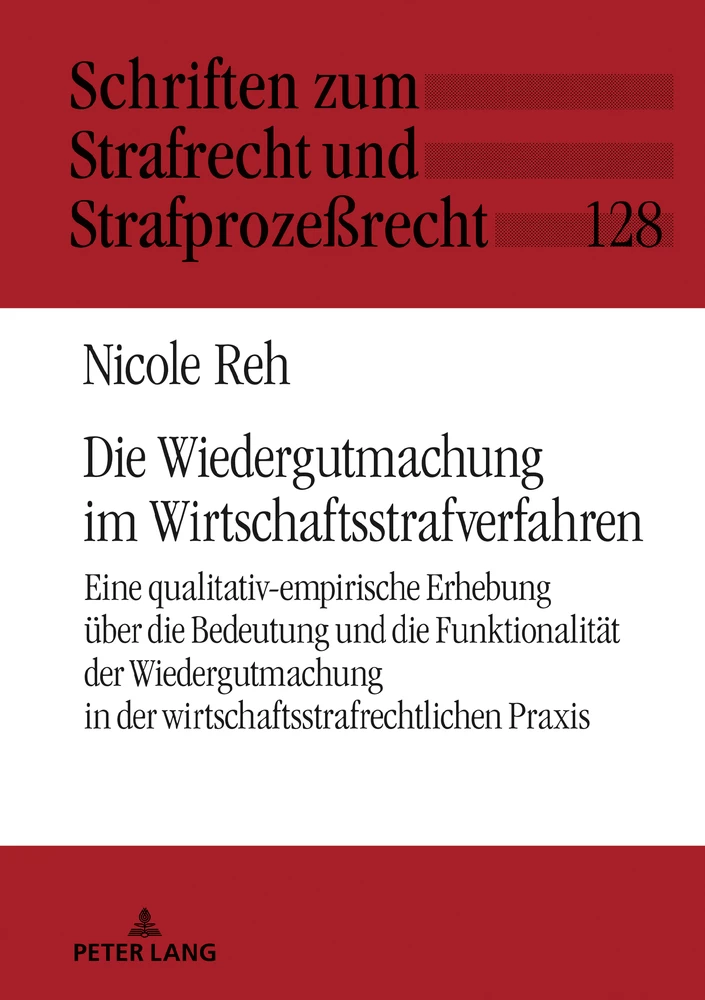Die Wiedergutmachung im Wirtschaftsstrafverfahren
Eine qualitativ-empirische Erhebung über die Bedeutung und die Funktionalität der Wiedergutmachung in der wirtschaftsstrafrechtlichen Praxis
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autoren-/Herausgeberangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Begriffe und Umgrenzung des Prüfungsgegenstandes
- I. Wirtschaftsstrafverfahren
- 1. Wirtschaftsstrafrecht
- a) Kriminologischer Ansatz
- b) Strafrechtsdogmatischer Ansatz
- c) Verfahrensrechtlicher Ansatz
- d) Stellungnahme
- 2. Charakteristika von Wirtschaftsstrafverfahren
- 3. Die Beteiligung der Opfer in Wirtschaftsstrafverfahren
- II. Wiedergutmachung
- 1. Begriffsdefinition
- a) Leistungsinhalt
- b) Freiwilligkeit als Voraussetzung des Wiedergutmachungsbegriffes
- aa) Wiedergutmachung im Strafzumessungskontext
- bb) Wiedergutmachung im Zusammenhang mit Sanktionen
- cc) Wiedergutmachung im Kontext von § 153a StPO
- dd) Wiedergutmachung im Zusammenhang mit weiteren Normen
- ee) Fazit
- c) Das Kriterium der Freiwilligkeit
- aa) Freiwilligkeit im Sinne des § 46a StGB
- bb) Freiwilligkeit im Sinne des § 153a StPO
- cc) Fazit
- 2. Täter-Opfer-Ausgleich als Spezialfall der Wiedergutmachung
- 3. Die Wiedergutmachung bei „opferlosen Delikten“ und Delikten gegen Allgemeinrechtsgüter
- a) Delikte gegen Allgemeinrechtsgüter und „opferlose Delikte“
- b) Die Wiedergutmachung bei Delikten gegen die Allgemeinheit am Beispiel der Steuerhinterziehung i.S.d. § 46a StGB
- aa) Täter-Opfer-Ausgleich i.S.d. § 46a Nr. 1 StGB in Steuerstrafsachen
- (1) Anwendbarkeit des § 46a Nr. 1 StGB
- (a) Opferbegriff des § 46a Nr. 1 StGB
- (b) Rechtsgut von § 370 AO
- (c) Telos des Täter-Opfer-Ausgleichs
- (2) Fazit
- bb) Steuernachzahlung als Schadenswiedergutmachung i.S.d. § 46a Nr. 2 StGB
- (1) Opferbegriff des § 46a Nr. 2 StGB
- (2) Steuerschaden als Tatfolgenausgleich i.S.d. § 46a Nr. 2 StGB
- (3) Fehlender „Ausdruck von Verantwortungsübernahme“ durch Zahlung der ohnehin geschuldeten Steuer i.R.d. § 46a Nr. 2 StGB?
- cc) Anwendbarkeit des § 46a StGB im Steuerstrafrecht unter Beachtung von § 371 AO
- dd) Fazit
- c) Wiedergutmachungsleistungen bei anderen „opferlosen“ Delikten und Delikten gegen Allgemeinrechtsgüter
- aa) Übertragbarkeit der Ergebnisse zur Steuerhinterziehung
- bb) „Symbolische“ Wiedergutmachungsleistungen
- d) Fazit
- 4. Das Wesen der Wiedergutmachung und ihre Abgrenzung zu anderen monetären Rückgriffsarten
- a) Wiedergutmachung in Abgrenzung zur Sanktion Strafe
- aa) Voraussetzungen und Zwecke der Sanktion „Strafe“
- (1) Schuldausgleich
- (2) Spezialprävention
- (a) Positive Spezialprävention
- (b) Negative Spezialprävention
- (3) Generalprävention
- (a) Positive Generalprävention
- (b) Negative Generalprävention
- (4) Fazit
- bb) Wiedergutmachung in Abgrenzung zur Anwendungs- bzw. Rechtsfolgenebene der Sanktion Strafe
- (1) §§ 56b II 1 Nr. 1, 59a II 1 Nr. 1 StGB - Strafe
- (2) §§ 46a StGB, 153a StPO – Strafe
- (3) Weitere Abgrenzungsaspekte zur Strafe
- cc) Fazit
- b) Abgrenzung zum zivilrechtlichen Schadensersatz
- aa) Merkmale des zivilrechtlichen Schadensersatzes
- bb) Gemeinsamkeiten
- cc) Unterschiede
- dd) Abhängigkeiten vom zivilrechtlichen Schadensersatz
- ee) Fazit
- c) Abgrenzung zu den Vorschriften über die Einziehung von Taterträgen bzw. des Wertersatzes von Taterträgen
- d) Abgrenzung zur Einziehung von Tatprodukten, Tatmitteln und Tatobjekten
- e) Abgrenzung zu Zahlungsverpflichtungen gegenüber öffentlich-rechtlichen Stellen
- aa) Geldbußen im Ordnungswidrigkeitenrecht
- bb) Säumniszuschläge
- cc) Durchsetzung zivilrechtlicher Schadensersatzforderungen durch öffentlich-rechtliche Träger
- 5. Gesamtergebnis zu B. II.
- C. Die Begleitforschung im wirtschaftsstrafrechtlichen Umfeld
- I. Vorbereitung und Durchführung der empirischen Arbeit
- 1. Das Forschungsziel
- 2. Die Auswahl der Forschungsmethode
- a) Quantitative Forschungsmethoden
- b) Qualitative Forschungsmethoden
- c) Methodenwahl
- d) Die konkrete Methode – Das halb-standardisierte Leitfadeninterview
- 3. Vorannahmen
- 4. Quellenauswahl
- 5. Forschungsverlauf
- a) Terminierung
- b) Umgebung
- c) Gesprächsverlauf
- II. Auswertung der empirischen Arbeit
- 1. Sichtung und Transkription
- 2. Analyseverfahren
- a) Kategoriensysteme
- b) Analyseverlauf
- c) Archiviertes Material
- III. Systematisierung und Darstellung der Analyseergebnisse
- 1. Deduktive Kategorien
- a) Tätigkeitsfelder der Probanden im Wesentlichen
- b) Schadenshöhen bei den Delikten
- c) Verständnis vom Wiedergutmachungsbegriff
- d) Bedeutung, Implementierung und Verfahrensstadium von Wiedergutmachungsleistungen
- e) Verständnis vom Täter-Opfer-Ausgleich-Begriff
- f) Bedeutung des Täter-Opfer-Ausgleichs
- 2. Induktive Kategorien
- a) Weitere von den Probanden genannte Probleme im Zusammenhang mit Wiedergutmachungsleistungen im Allgemeinen
- b) Bewertungen von Alternativmodellen/Alternativansätzen
- IV. Schlussfolgerung aus den Analyseergebnissen
- 1. Tätigkeitsfelder der Probanden
- 2. Schadenshöhen
- 3. Das Verständnis vom Wiedergutmachungsbegriff in der Praxis
- 4. Die Bedeutung, Implementierung und Verfahrensstadien von Wiedergutmachungsleistungen
- a) Der Stellenwert von Wiedergutmachungsleistungen in Wirtschaftsstrafverfahren
- b) Die Initiative zu Wiedergutmachungsleistungen
- c) Die Bedeutung in den jeweiligen Verfahrensstadien
- d) Die Bedeutung der Wiedergutmachung in den einzelnen Verfahrensstadien unter Berücksichtigung der Erledigungspraxis in Wirtschaftsstrafverfahren
- e) Ergebnis
- 5. Verständnis vom Täter-Opfer-Ausgleich-Begriff
- 6. Bedeutung des Täter-Opfer-Ausgleichs
- 7. Probleme bei der Erbringung von Wiedergutmachungsleistungen/ Opferschutz im Allgemeinen
- a) Mangelnde Solvenz
- b) Handhabbarkeit von Wiedergutmachungsauflagen
- c) Mangelndes Interesse am Ausgleich für die Geschädigten
- V. Zuverlässigkeit der Forschungsergebnisse
- 1. Verfahrensdokumentation
- 2. Argumentative Interpretationsabsicherung
- 3. Regelgeleitetheit
- 4. Nähe zum Gegenstand
- 5. Kommunikative Validierung
- 6. Triangulation
- 7. Ergebnis
- VI. Fazit
- D. Konsequenzen und Alternativüberlegungen auf Grundlage der Ergebnisse
- I. Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten
- II. Mangelnde Solvenz als Wiedergutmachungshindernis
- III. Handhabbarkeit von Wiedergutmachungsauflagen – Alternative: Änderung des Verhältnisses des Ausgleichs zur Geldstrafe?
- 1. Überlegungen zu prozessualen Entlastungsmöglichkeiten der Gerichte bei Anordnung von Wiedergutmachungsauflagen
- 2. Alternative: Vorrang des Ausgleichs vor Geldstrafenvollstreckung? – Ein Blick ins schweizerische Strafrecht
- IV. Arbeitsentlastungen und Fortbildungen der Justiz als Grundlage zur Stärkung der Wahrnehmung der Geschädigteninteressen
- V. Adhäsionsverfahren im Wirtschaftsstrafverfahren als Alternative?
- VI. Vorläufige Sicherungsmaßnahmen und Entschädigungsverfahren als Alternative?
- 1. Rechtslage vor dem 01.07.2017
- 2. Rechtslage seit dem 01.07.2017
- a) Die Regelungen im Überblick
- b) Würdigung der neuen Rechtslage
- VII. In der Diskussion: Bindung der Zivilgerichte an Tatsachenfeststellungen der Strafgerichte?
- E. Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
- Reihenübersicht
a.A. andere Ansicht
Abs. Absatz
Abschn. Abschnitt
AcP Archiv für die civilistische Praxis
ADG Arbeitsgemeinschaft Deutsche Gerichtshilfe e.V.
AE-WGM Alternativ-Entwurf-Wiedergutmachung
a.F. alte Fassung
AG Amtsgericht
Anm. Anmerkung
AO Abgabenordnung
Art. Artikel
ASocRev American Sociological Review
AT Allgemeiner Teil
ASocRev American Soziological Review
BayObLG Bayrisches Oberlandesgericht
BBG Bundesbeamtengesetz
Begr. Begründer/Begründerin
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl. Bundesgesetzblatt
Beck-OK Beck’scher Onlinekommentar
BeckRS Beck-Rechtsprechung (online)
BGH Bundesgerichtshof
BGHSt Sammlung der Entscheidungen des BGH in Strafsachen
BR-Drs. Bundesratsdrucksache
bspw. Beispielsweise
BT Besonderer Teil
BT-Drs. Bundestagsdrucksache
BVerfG Bundesverfassungsgericht
bzw. beziehungsweise
DB Der Betrieb. Wochenschrift für Betriebswirtschaft, Steuerrecht, Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht
ders. derselbe
d.h. das heißt
dies. Dieselbe
DStR Deutsches Steuerrecht ← 13 | 14 →
DStZ Deutsche Steuer-Zeitung
DRiZ Deutsche Richterzeitung
EU-Rat Europäischer Rat
f., ff. folgende
FG Festgabe
FGPrax Praxis der Freiwilligen Gerichtsbarkeit
Fn. Fußnote/n
Fortf. Fortführende/r
FR Finanz-Rundschau
FS Festschrift
GA Goltdammers’s Archiv für Strafrecht
gem. gemäß
GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GS Gedächtnisschrift
h.M. herrschende Meinung
Hrsg. Herausgeber
i.e.S. im engeren Sinne
InsO Insolvenzordnung
i.R.d. im Rahmen des/der
i.S. im Sinne
i.S.d. im Sinne des/der
i.S.v. im Sinne von
i.Ü. im Übrigen
i.V.m. in Verbindung mit
i.w.S. im weiteren Sinne
JA Juristische Arbeitsblätter
JGG Jugendgerichtsgesetz
jM juris – Die Monatszeitschrift
JR Juristische Rundschau
jurisPR-StrafR Juris Praxis Report Strafrecht
JuS Juristische Schulung
JZ Juristenzeitung
Kap. Kapitel
KK Karlsruher Kommentar
KriPoZ Kriminalpolitische Zeitschrift
LG Landgericht
LK Leipziger Kommentar
LSG Landessozialgericht
MI Ministerium für Inneres und Sport (Niedersachsen)
MJ Justizministerium (Niedersachsen)
MLR Marburg Law Review
MüKo Münchener Kommentar
MschrKrim Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform
m.w.N. mit weiteren Nachweisen
n.F. neue Fassung
NJOZ Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW Neue juristische Wochenschrift
NJW-RR Neue juristische Wochenschrift Rechtsprechungsreport Zivilrecht
NK Nomos-Kommentar
NordÖR Zeitschrift für öffentliches Recht in Norddeutschland
Nr. Nummer
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NStZ-RR Neue Zeitschrift für Strafrecht Rechtsprechungsreport
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZI Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung
NZS Neue Zeitschrift für Sozialrecht
NZWiSt Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht
o.Ä. oder Ähnliche/s
OLG Oberlandesgericht
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz
RdErl. Runderlass
Rn. Randnummer/n
S. Seite/n
SGB Sozialgesetzbuch
SK Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch
sog. sogenannte/r/n/s
SS Schönke/Schröder (Kommentar)
SSW Satzger/Schluckebier/Widmaier (Kommentar)
Stat. MH. Nds. Statistische Monatshefte Niedersachsen
StGB Strafgesetzbuch
StPO Strafprozessordnung
StraFo Strafverteidiger-Forum
st. Rspr. ständige Rechtsprechung ← 15 | 16 →
StV Strafverteidiger
TOA Täter-Opfer-Ausgleich
u.a. und andere/unter anderem
u.m. und mehr
usw. und so weiter
v. vom
vgl. vergleiche
wistra Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
WpHG Wertpapierhandelsgesetz
z.B. zum Beispiel
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZIS Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik
zit.: zitiert als
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
Zs. f. Rechtssoz. Zeitschrift für Rechtssoziologie
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
ZWH Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht und Haftung in Unternehmen
Edwin Kube behauptete 1986, man begebe sich mit der Wiedergutmachung als Instrument im Strafrecht zur Herstellung des Rechtsfriedens auf eine Gradwanderung zwischen „Wunschtraum und Wirklichkeit“, bei der einiges „realistisch, anderes utopisch“ sei.1 Diese Einschätzung ist, ebenfalls wie der vielseitig gerühmte und kritisierte Alternativ-Entwurf-Wiedergutmachung, bereits Jahrzehnte her und dennoch hat die Idee von einer alternativen Lösung zu Strafen an Faszination für die Strafrechtslehre nicht verloren. Auch in den letzten Jahren wurde das Thema immer wieder aufgegriffen und versucht dieses Modell zu bewerten,2 ihm neuen Auftrieb zu geben,3 oder es in den aktuellen Kontext einzubeziehen und neu zu hinterfragen.4 Die Frage nach der Einbeziehung des Opfers im Strafprozess hat insgesamt an Antrieb nicht verloren.5 In der Zwischenzeit wurden die §§ 46a, 56b II Nr. 1, 59a II Nr. 1 StGB durch Art. 1 Nr. 1 des Verbrechensbekämpfungsgesetzes vom 28.10.19946 eingefügt und die Normen der StPO durch Gesetz vom 20.12.19997 zur Verankerung des Täter-Opfer-Ausgleichs im Prozessrecht ergänzt. Es folgten unter anderem das Opferrechtsreformgesetz vom 24.06.2004,8 das zweite Opferrechtsreformgesetz vom 29.07.2009 und jüngst das ← 17 | 18 → dritte Opferrechtsreformgesetz vom 21.12.2015,9 mit dem die Bundesrepublik Deutschland eine Richtlinie über die Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten seitens des Europäischen Parlaments und des Rates10 vom 25.10.2012 im Strafprozess umsetzte.11 Dessen letzte Teilbestimmungen traten am 01.01.2017 in Kraft.12 Auch aktuelle Reformvorhaben, wie etwa die Änderungen zum Vermögensabschöpfungsrecht, zeigen, dass weiter nach Lösungswegen gesucht wird, um die Interessen von Opfern in Strafverfahren zu stärken.13
Angesichts dieser fortschreitenden Implementierung von Opferinteressen und bestehender Einschätzungen verschiedenster Autoren zur Stellung der Wiedergutmachung im strafrechtlichen Kontext stellt sich daher die Frage, warum noch ein Werk entstehen sollte, das sich mit dem Opferschutz im Rahmen von Wiedergutmachung beschäftigt, altbekannte Argumente hervorholt, bestehende Probleme repetiert und damit den Stein des Sisyphos einmal mehr den Berg hinaufschiebt? Warum wieder und wieder das Thema Wiedergutmachung in der Theorie behandeln, wenn man davon ausgehen kann, dass dem, so behauptet, trotz diverser Bemühungen des Gesetzgebers, „immer noch eine Praxis gegenüber (stehe), die den Wiedergutmachungsgedanken im Bereich des Strafrechts ← 18 | 19 → als Randerscheinung betrachtet“14 bzw. diese nicht umfassend als Maßnahme wahrnehme?15
Falls man von Letzterem ausgehen kann. Gerade diese Prämisse gilt es im Folgenden speziell für das Wirtschaftsstrafverfahren zu hinterfragen und zu überprüfen. Womit der Grundgedanke dieser Arbeit formuliert ist:
Es geht weder darum, erneut Argumente für oder gegen eine Wiedergutmachung im allgemeinen Strafrecht abzuwägen oder eine geschichtliche Aufarbeitung ihres Ursprungs ausführlich darzustellen; noch geht es um eine Bewertung des Konzeptes insgesamt. Es geht auch nicht darum alle die Wiedergutmachung betreffenden Normen in ihrer Gänze erschöpfend darzustellen und auf weiterbestehende Schwächen diesseits hinzuweisen16. Das grundlegende Konzept der Wiedergutmachung als sinnvoller Beitrag zur Stärkung der Opferrolle im Strafprozess soll nicht in Abrede gestellt werden. Und auch wenn kriminalpolitisch an der einen oder anderen Stelle Reformbedarf besteht, so soll sich diese Arbeit auf die für Wirtschaftsstrafverfahren wesentlichen Zusammenhänge beschränken.
Sinn und Zweck dieser Arbeit ist es daher die Wiedergutmachung, ihre dogmatische Einbettung im Strafrecht und ihren tatsächlichen Einfluss in der Praxis des Wirtschaftsstrafrechts zu beleuchten, zu hinterfragen und daraus Rückschlüsse auf ihre Bedeutung, Funktionalität und die weiteren Möglichkeiten zum Umgang mit ihr in diesem besonderen Verfahrensgebiet zu ziehen. Damit erhebt diese Arbeit den Anspruch, Eindrücke und Argumente aus der Praxis aufzugreifen, eine Bewertung derer vorzunehmen und daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen.
Freilich gibt es bereits einzelne Untersuchungen in der Strafrechtslehre, die abbilden, in welcher Häufigkeit bestimmte Formen der Wiedergutmachung in der Rechtswirklichkeit vorkommen.17 Insbesondere der Täter-Opfer-Ausgleich als Unterform der Wiedergutmachung18 ist dabei immer wieder in den Fokus von empirischen Untersuchungen gerückt worden.19 Im Zusammenhang mit wirtschaftsstrafverfahrensrechtlichen Fragen dagegen, gibt es bislang keine Untersuchung, ← 19 | 20 → die sich speziell mit der Frage nach dem Stellenwert, dem Einfluss und der Funktion der Wiedergutmachung beschäftigt. Einige empirische Arbeiten, die die Randbedingungen für Wiedergutmachungsleistungen in Wirtschaftsstrafverfahren betreffen gibt es zwar, wie etwa die Studie von Altenhain/Hagemeier/Haimerl/Stammen zur Absprachepraxis in Wirtschaftsstrafverfahren oder die Untersuchung von Theile/Nippgen/Spiess/Petermann zur Arbeitsweise der Wirtschaftsstrafkammern insgesamt.20 Der Fokus dieser Untersuchungen liegt indes nicht auf Wiedergutmachungsleistungen.
Doch warum überhaupt die Frage nach der Bedeutung, der Funktionalität und den Problemen im Zusammenhang von Wiedergutmachungsleistungen im Rahmen von Wirtschaftsstrafverfahren aufwerfen?
Als der Gedanke zu dieser Arbeit entstand, stand zunächst die Frage im Raum, warum gerade die Schadenswiedergutmachung, als monetärer Ausgleich,21 nicht schon längst in den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen geraten ist. Es schien mir, als müsse sich gerade die Schadenswiedergutmachung hervorragend in einem Rechtsgebiet eignen, dass von hohen Schadenssummen und wirtschaftlichen Interessen geprägt ist.22 Gerade dort, so die Annahme, müsse das Bedürfnis nach dem Ausgleich monetärer Schäden doch immens sein. Und müsste nicht in einem Rechtgebiet, in dessen Rahmen man von „weißer Kragen Kriminalität“23 und Täter mit wirtschaftlich gut situiertem und sozial integriertem Hintergrund24 spricht, davon auszugehen sein können, dass diese angesichts der im Rahmen von Strafzumessung relevanten Wirkungen und der Einstellungsmöglichkeit nach § 153a StPO ein enormes Interesse daran haben dürften, Schadenswiedergutmachungsleistungen zu erbringen? Sollten gut ausgebildete, wirtschaftlich denkende Täter nicht auch eher in der Lage zu einem solchen Ausgleich sein? Müsste nicht die Möglichkeit einer Einstellung nach § 153a StPO bei der Wiedergutmachung der angerichteten Schäden ein für Richter und Staatsanwälte verlockendes Instrument sein, um komplizierte, umfangreiche und langwidrige Verfahren25 und die damit verbundenen „Aktenberge vom Tisch zu bekommen“? Dürfte es den Opfern, die im Bereich dieses Rechtsgebietes in der Regel an ihrem Vermögen geschädigt worden sind, nicht ← 20 | 21 → gerade darum gehen, einen solchen Ausgleich zu erhalten? Und wäre damit dem Rechtsfrieden nicht genüge getan?
Fragen über Fragen, deren Antworten zunächst so eindeutig nahelagen, dass es mich beinahe verwunderte, warum sie bislang nicht geklärt worden waren.
Daher galt es herauszufinden, ob diese Annahmen, die vermeintlich so nahelagen, hielten, was ich mir von ihnen versprach. Um dies zu klären genügte eine theoretische Auseinandersetzung mit dem, was unter Wiedergutmachung zu verstehen ist und welche dogmatischen Wege sie nimmt, alleine nicht.
Von Interesse für mich waren vor allem die Beweggründe der einzelnen am Wirtschaftsstrafverfahren beteiligten Akteure und ihre Sicht auf die Wiedergutmachung. Ich fragte mich, ob das, was ich unter Wiedergutmachung verstand auch in der Praxis so gesehen wurde. Ob ein unterschiedliches Verständnis möglicherweise zu anderen Anwendungsformen führte? Ob - ausgehend vom Verständnis dieser Akteure - weitere Aspekte für oder gegen die Einbeziehung der Wiedergutmachung in Wirtschaftsstrafverfahren sprachen, die auf den ersten, meinen, Blick nicht unmittelbar mit der Wiedergutmachung zusammenhingen? Und überdies: Ob die Wiedergutmachung als Bestandteil der Reaktionsmöglichkeiten unter den Möglichkeiten der strafrechtlichen Instrumentarien überhaupt in der Wahrnehmung der Akteure präsent war?
So könnte man etwa die These aufstellen, dass eine mangelnde Wahrnehmung der Wiedergutmachung damit zusammenhängen könnte, dass sie in der Praxis de facto keine Rolle spielt. Ebenso gut war es möglich, dass lediglich der Begriff der Wiedergutmachung nicht präsent war, die Wiedergutmachung aber möglicherweise dennoch gelebte Praxis darstellt und damit faktisch eine wichtige bereits fest verankerte Rolle im Wirtschaftsstrafverfahren einnimmt.
Doch bevor ich mich der praktischen Rolle der Wiedergutmachung im Wirtschaftsstrafverfahren widmen konnte, galt es zunächst zu klären, ob - ausgehend von meinem Verständnis von Wiedergutmachung - diese im Wirtschaftsstrafverfahren ihre Funktionen überhaupt erfüllen kann. Eine theoretische Auseinandersetzung mit der Frage, ob die spezifischen Delikte des Wirtschaftsstrafrechts überhaupt den Anwendungsbereich der Wiedergutmachung betreffen können, war folglich unerlässlich. Zu denken war diesbezüglich etwa an Delikte, die sich gegen die Allgemeinheit richten, „opferlose Delikte“ oder Steuerstraftaten.26
Auch eine Auseinandersetzung mit der dogmatischen Einordnung der Wiedergutmachung war von Nöten, um sie insbesondere auch von anderen monetären Rückgriffsarten, insbesondere den speziellen Reaktionsmöglichkeiten, die ← 21 | 22 → bei Wirtschaftsstrafverfahren eine Rolle spielen, wie etwa den §§ 17, 30 OWiG,27 abgrenzen zu können.
Um einerseits den aktuellen Geschehnissen Rechnung zu tragen28 und andererseits wegen ihrer Repräsentativität als Wirtschaftsstrafdelikt29 sollte die rechtliche Diskussion um die Anwendbarkeit der Wiedergutmachung bei Delikten gegen die Allgemeinheit insbesondere am Beispiel der Steuerhinterziehung nach § 370 AO untersucht und auf ihre Funktionalität hin überprüft werden. Die sich in diesem Kontext aufdrängenden Fragen nach einem Vorrang der Selbstanzeige vor der Wiedergutmachung und damit letztlich erneut die Frage nach der Anwendbarkeit auf bestimmte Wirtschaftsstrafdelikte sollte ebenso wenig unbeantwortet bleiben wie die Frage, ob die dabei gefundenen Ergebnisse auf Delikte gegen die Allgemeinheit bzw. sog. „opferlose Delikte“ angewendet werden können.
Im Kern untergliedert sich diese Arbeit daher in zwei wesentliche Untersuchungsfragen.
Zum einen in die Frage, was unter Wiedergutmachung zu verstehen ist, ob sie bei allen Wirtschaftsstrafdelikten Anwendung finden kann und worin sie sich von anderen monetären Rückgriffsarten unterscheidet.
Zum anderen in die Frage, welchen Blick die Praxis-Akteure auf sie im Rahmen des Wirtschaftsstrafverfahrens haben, worin sie Probleme und Vorteile sehen und wie man - derartige Probleme unterstellt - lösen könnte.
Zur Beantwortung dieser beiden Kernfragen, ist die nachfolgende Arbeit in vier Abschnitte gegliedert.
Details
- Pages
- 298
- ISBN (PDF)
- 9783631769621
- ISBN (ePUB)
- 9783631769638
- ISBN (MOBI)
- 9783631769645
- ISBN (Hardcover)
- 9783631769652
- DOI
- 10.3726/b14739
- Language
- German
- Publication date
- 2019 (April)
- Keywords
- Ausgleichsinstrumente Wirtschaftsstrafverfahren Schadenswiedergutmachung Opferinteressen Qualitativ-empirische Studie Täter-Opfer-Ausgleich Opferschutz
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien. 2018. 298 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG