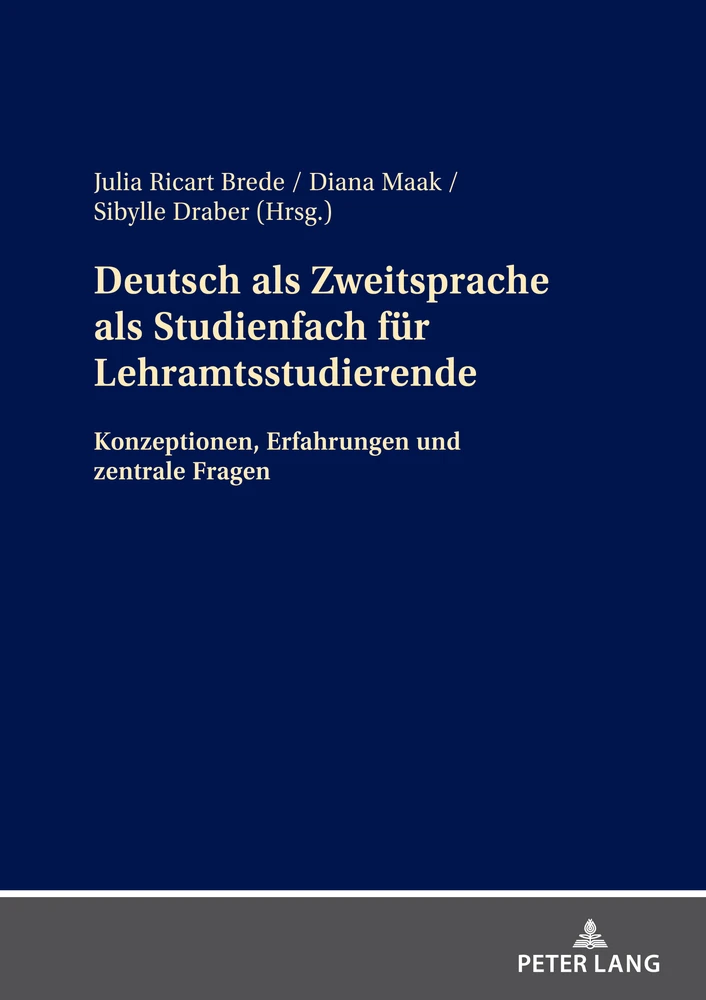Deutsch als Zweitsprache als Studienfach für Lehramtsstudierende
Konzeptionen, Erfahrungen und zentrale Fragen
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Einführung in den Band
- Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich Deutsch als Zweitsprache für (angehende) Lehrkräfte im Kanton Zürich
- DaZ-Studienmöglichkeiten für Lehramtsstudierende in Österreich mit besonderer Berücksichtigung der Pädagogischen Hochschule Steiermark
- DaZ-Studienmöglichkeiten für Lehramtsstudierende in Österreich mit besonderer Berücksichtigung des Verbunds Nord-Ost
- Deutsch als Zweit- und Fremdsprache als Studienfach in der Lehrkräftebildung der Friedrich-Schiller-Universität Jena: Zielgruppe, Inhalte und Entwicklungen
- Das Beifach DaF / DaZ im Lehramt an der Universität Greifswald: Reflexion des Ausbildungsstandes am Beispiel eines Lernarrangements zum sprachsensiblen Fachunterricht und zu Korrekturpraktiken
- Das Erweiterungsfach DaZ an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg
- Das Lehramtserweiterungsfach Deutsch als Zweitsprache am Herder-Institut der Universität Leipzig
- Das Studienfach DaZ für Lehramtsstudierende in Bayern: Zur Genese und zu den Spezifika des Fachs im Freistaat Bayern
- Mehr als ein persönliches Hobby?! Genese, Herausforderungen und Perspektiven des Fachs Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache im gymnasialen Lehramt an der Philipps-Universität Marburg
- Wege zur Qualifizierung von Lehrkräften für DaZ an der Universität Kassel
- DaZ als Studienfach für (angehende) Lehrer:innen: Ein datengestützter Überblick über die Ausbildungssituation in Deutschland
- Autor:innen-Verzeichnis
Julia Ricart Brede / Diana Maak / Sibylle Draber
Einführung in den Band
Wenngleich die Fachcommunity aktuell „die Frage nach der Möglichkeit, dem (Un-)Sinn und ggf. der Notwendigkeit der Neubestimmung“ (https://das.univie.ac.at/) des Fachs stellt und z.B. im Rahmen einer Ringvorlesung im Sommersemester 2023 die Vor- und Nachteile der Termini Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Erstsprache sowie von Neuschöpfungen wie Deutsch als Sprache(n) (DaS) umfassend diskutiert wurden, fokussiert der vorliegende Band explizit auf Deutsch als Zweitsprache (im Folgenden kurz: DaZ) – und zwar als distinktes (Studien-)Fach. Dies geschieht nicht, weil wir den entsprechenden Diskussionen, z.B. um die potenziell diskriminierende Wirkung, die dem Begriff DaZ inhärent ist, wenig Bedeutung beimessen würden. Es geschieht vielmehr, da dem Fach DaZ und dessen Wissenschaftlichkeit gesellschaftlich und politisch in keiner Weise ausreichend Bedeutung zukommt. Entsprechende Positionierungen der Fachcommunity werden im öffentlichen Diskurs kaum wahrgenommen oder diskutiert und so gut wie nie für bildungspolitische Entscheidungen berücksichtigt (vgl. z.B. die Leipziger Erklärung aus dem Jahr 2016, unterschrieben von 30 universitären Standorten sowie dem Fachverband Deutsch als Fremdsprache, initiiert bzw. veröffentlicht von Altmayer / Dobstadt 2016). Auch Beiträge des vorliegenden Bandes belegen eindrücklich die prekäre Stellung des Fachs, z.B. wenn Siebold / Teepker / Yilmaz für den Standort Marburg fordern, dass es sich beim DaZ-Studienfachangebot um „mehr als ein persönliches Hobby“ von engagierten Kolleg:innen handeln sollte. Ein weiteres aktuelles Beispiel für die Geringschätzung des Fachs stellt eine Korrespondenz dar, die durch eine schriftliche Anfrage der Abgeordneten Klara Schedlich (GRÜNE) an die Berliner Senatsverwaltung aus dem Februar 2023 angestoßen wurde. Schedlich fragte u.a.:
Ist die Einführung von Deutsch als Zweitsprache als ordentliches Schulfach (mit Stundentafel und Rahmenlehrplan) und als Studien- und Prüfungsfach in die Verordnung über den Zugang für Lehrämter (LZVO) geplant? Wenn ja, welche Schritte wurden bereits unternommen? Welche sind geplant? Wenn nein, aus welchem Grund sieht die Senatsverwaltung für Bildung Deutsch als Zweitsprache nicht als ordentliches Schulfach an? (Abgeordnetenhaus Berlin, Drucksache 19/14833)
An der Antwort wird ersichtlich, dass der aktuelle Status als (verpflichtendes) Querschnittsthema in der Lehrer:innenbildung als vollkommen ausreichend erachtet wird, weshalb DaZ auch perspektivisch nicht der Status eines eigenständigen Schul- bzw. Studienfachs zukommen wird:
Deutsch als Zweitsprache zählt gemäß § 5 Abs. 1 Lehramtszugangsverordnung (LZVO) zu den Lehramts- [sic] und fachübergreifenden Studieninhalten, die in allen Lehramtsstudiengängen verpflichtender Bestandteil sind. Da in der LZVO lediglich bestehende Fächer abgebildet sind, ist eine darüber hinaus gehende Erwähnung nicht notwendig und nicht geplant. (Abgeordnetenhaus Berlin, Drucksache 19/14833)
Auf den ersten Blick mag das Lai:innen nachvollziehbar erscheinen; bedenkt man jedoch, dass sich die verpflichtenden Anteile auf acht bis zehn Leistungspunkte (im Folgenden auch kurz: ECTS) belaufen, dann ist fraglich, ob alle Lehramtsstudierende im Rahmen dieses Umfangs neben einer allgemeinen Sensibilisierung für sprachliche Vielfalt und die Bedeutung von Sprache in allen Fächern darauf vorbereitet werden können, neu zugewanderten Schüler:innen DaZ zu vermitteln sowie ggf. fachsensiblen Sprachunterricht zu gestalten. Wir vertreten die Auffassung, dass es gar nicht notwendig ist, dass alle Lehrkräfte DaZ-Unterricht erteilen können. Vielmehr sollten einige Lehramtsstudierende als Expert:innen auf diesem Gebiet ausgebildet sein – dafür müsste DaZ jedoch als Studienfach eingeführt werden. Es drängt sich – um beim Beispiel Berlin zu bleiben – folgende Frage auf: Wie kann es sein, dass neu zugewanderte Schüler:innen, für die Deutsch eine Zweitsprache darstellt, ohne Rahmenlehrplan mehrere Stunden pro Tag fünf Tage die Woche ohne gezielt für das Fach ausgebildete Lehrkräfte in DaZ unterrichtet werden? DaZ als fachübergreifender Studieninhalt im Rahmen der Lehrer:innen-Bildung kann es kaum leisten, Studierende dazu zu befähigen, Schüler:innen kompetent beim Erwerb der n-Deklination, bei der Unterscheidung von Minimalpaaren, bei der Überwindung etwaiger motorischer Herausforderungen beim Schreiben von links nach rechts und vielen anderen DaZ-spezifischen Entwicklungsverläufen zu unterstützen. Dafür wäre ein grundständiges Fachstudium erforderlich. Ob des allgemeinen Lehrkräftemangels, der derzeit fachunabhängig zu konstatieren ist, spitzt sich die ohnehin prekäre Lage noch weiter zu: Die beobachtbare Tendenz zur Deprofessionalisierung, im Zuge derer fachfremdes Unterrichten oder gar das Unterrichten ohne (einschlägigen) Studienabschluss gewährt wird, trifft auch das Fach DaZ. Wir halten es allerdings nicht für verhandelbar, dass Lehrer:innen für ihre Fächer Expert:innen sein sollten – fachwissenschaftlich wie fachdidaktisch. Diese Position wird im Übrigen auch in einer Stellungnahme der Hochschulrektorenkonferenz aus dem November 2023 vertreten (vgl. HRK 2023).
Doch kann selbst ein Fachstudium im DaZ-Bereich sehr unterschiedlich aussehen. Dies gilt sogar dann, wenn ausschließlich auf Studienfachangebote für DaZ-Lehrkräfte an allgemein- und berufsbildenden Schulen fokussiert wird, sodass der gesamte außerschulische DaZ-Bereich – und damit z.B. das Feld der Integrationskurse – unberücksichtigt bleibt. Teilweise lässt sich die Heterogenität der Qualifikationswege und -angebote auf die föderale Struktur der Bildungssysteme und die unterschiedlichen bildungspolitischen Vorgaben der einzelnen deutschsprachigen Länder zurückzuführen, die bspw. dazu führen, dass DaZ-Qualifikationen in Österreich und in der Schweiz i.d.R. postgradual, in Deutschland hingegen häufig bereits während des grundständigen Studiums erworben werden. Äußerst heterogen sind die Qualifikationen von DaZ-Lehrkräften im schulischen Bereich aber auch unabhängig davon, z.B. hinsichtlich Länge und Dauer, d.h. bzgl. des Qualifizierungsumfangs, sowie bzgl. der fachlichen Ausgestaltung (vgl. hierzu im Detail den Beitrag von Maak / Ricart Brede in diesem Band). Eine zentrale Frage mit Blick auf die fachliche Ausgestaltung ist dabei, ob Lehrkräfte für den Umgang mit sprachlicher und kultureller Heterogenität im Allgemeinen qualifiziert werden sollen, bspw. um in jeglichem Fachkontext einen rassismusfreien und inklusiven Unterricht gestalten zu können, der sprachsensibel angelegt ist, oder ob Lehrkräfte für das Ausgestalten von DaZ-Unterricht, das weit über die Vermittlung der deutschen Sprache hinausgeht, qualifiziert werden sollen. Zu Ersterem, so unsere Position, sollten über verpflichtende Studieninhalte alle Lehrer:innen befähigt werden. Mit Letzterem hingegen, nämlich mit der Bandbereite an Qualifizierungswegen von DaZ-Lehrkräften in Form eines Fachstudiums, befasst sich der vorliegende Band.
Den Anstoß für die Entstehung des Bandes hat Britta Hövelbrinks gegeben, die – gemeinsam mit Theres Werner und Nimet Tan – einen resümierenden Kurzbericht zum 2015 neu eingeführten Drittfach Deutsch als Zweit- und Fremdsprache an der Friedrich-Schiller-Universität Jena in der Reihe „Berichte und Materialien“ des DaZ-Portals veröffentlichen wollte. Die daraufhin im Herausgeberteam der Reihe angestoßene Diskussion machte rasch deutlich, dass ein solcher Bericht nicht nur äußerst wünschenswert wäre, sondern dass er ein Desiderat adressiert, das sogar eine noch sehr viel umfangreicher und breiter angelegte Publikation nahelegt: nämlich einen Überblick über DaZ-Studienfachmöglichkeiten im deutschsprachigen Raum. Ein solcher Buchband kann als Ausgangspunkt für eine strukturierte und umfassende Diskussion über die Studienlandschaft im Fach DaZ dienen – die sich u.E. in einem nächsten Schritt unbedingt anschließen sollte. Wir Herausgeberinnen freuen uns, dass aus der erwähnten Beitragsidee letztlich ein ganzer Buchband erwachsen ist und dass der initiale Beitrag zudem Teil ebendieses Bandes geworden ist.
Gerne möchten wir das im vorigen Absatz postulierte Desiderat mit Blick auf die Publikationslandschaft an dieser Stelle näher erläutern: So ist es u.E. bemerkenswert, dass den diversen Qualifikationswegen und -strukturen in der zunehmend breit geführten Debatte um die Professionalisierung von DaZ-Lehrkräften (vgl. dazu bspw. Rost-Roth 2017 sowie insbesondere Projekte wie DaZKom, DaZKom-Video und DaZKom-Transfer und das vom BIMM veröffentlichte Kompetenzprofil DaZKompP) bislang überraschend wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.1 Ein Großteil der wenigen Publikationen hierzu befasst sich mit fächerübergreifenden (Wahl-)Pflichtmodulen zur Sensibilisierung von Lehrkräften für sprachliche (und kulturelle) Heterogenität (vgl. z.B. Baumann / Becker-Mrotzek 2014; Becker-Mrotzek et al. 2017); häufig werden dabei Einblicke in die Ausgestaltung derartiger (Wahl-)Pflichtmodule an einzelnen Standorten geboten (vgl. z.B. Lütke 2010; Bührig et al. 2020). Ausnahmen stellen z.B. der jüngst erschienene Band „Universitäre Weiterbildungen im Handlungsfeld von Deutsch als Zweitsprache“ (Asmacher / Serrand / Roll 2021) und der im selben Jahr vom Österreichischen Verband für Deutsch herausgegebene Band „Lehrer_innenbildung für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ausbildung – Fortbildung – Weiterbildung“ (vgl. ÖDaF 2021) dar.
Mit Blick auf die Bandbreite an Qualifikationsmöglichkeiten für (angehende) Lehrkräfte im DaZ-Bereich fokussiert der vorliegende Sammelband ausschließlich auf Studienfachangebote. D.h. das weite Feld der Zertifikatslandschaft wird in der Diskussion ausgeklammert, gleichwohl an einigen Standorten diesbezüglich Überschneidungen sichtbar werden und an einem Einzelfall auch aufgezeigt wird, wie aus zertifikatsbasierten Angeboten bzw. temporären Projekten Studienfachangebote erwachsen können (vgl. hierzu den Beitrag von Aguado / Meyer-Warneke / Schiffel über das DaZ-Qualifikationsangebot an der Universität Kassel). Zentrales Anliegen des Bandes ist es, die Vielfalt an Strukturen und Konzeptionen von Studienfachangeboten in DaZ für (angehende) Lehrer:innen an Hochschulstandorten in deutschsprachigen Ländern aufzuzeigen. Hierzu bietet der Sammelband Raum für die Vorstellung von Erfahrungsberichten sowie für systematisch angelegte Evaluationen von Studienfachangeboten bzw. Studiengangsstrukturen. Ferner liefert die Auseinandersetzung mit standortspezifischen Aspekten, wie bspw. den Besonderheiten des Staatsexamens in Bayern, anregende Impulse für die Lehrer:innen-Bildung in den deutschsprachigen Ländern. Der Band wendet sich daher nicht lediglich an Kolleg:innen, die im Rahmen der Lehrer:innen-Bildung mit DaZ tangiert sind, sondern die Informationen und Erkenntnisse des Bandes sind u.E. ebenso für die Bildungspolitik und -administration von Relevanz. Darüber hinaus bietet der Sammelband für Studierende bzw. für (angehende) Lehrkräfte ebenfalls einschlägige Informationen.
Der Band ist derart angelegt, dass zunächst Einblicke in die Lehrer:innen-Aus- bzw. -Weiterbildung im Bereich DaZ in der Schweiz und in Österreich gewährt werden. In beiden Ländern kann DaZ (aktuell) nicht während des grundständigen Lehramtsstudiums als Studienfach studiert werden. Darauffolgend eröffnen sieben deutsche Hochschulstandorte Einblick in Möglichkeiten zur Qualifizierung im Bereich DaZ in der Lehrer:innen-Bildung. Dieser Abschnitt schließt mit einem übergreifenden Beitrag, der Studienfachangebote für DaZ in der Bundesrepublik Deutschland auf empirischer Basis vergleichend darstellt.
Eröffnet wird der Band von Hansjakob Schneider, Yvonne Tucholski und Gesine Magdeburg. Die Autor:innen beschreiben in ihrem Beitrag Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich DaZ für (angehende) Lehrkräfte im Schweizer Kanton Zürich. Die Ausbildung zur DaZ-Lehrkraft erfolgt hier, ebenso wie in anderen Schweizer Kantonen, postgradual. Grundsätzlich konstatieren die Autor:innen ein Zwei-Klassen-System bei der Anstellung und Entlohnung von DaZ-Lehrkräften im Vergleich zu anderen Lehrkräften. In ihren weiteren Ausführungen thematisieren die Autor:innen DaZ-Inhalte in der grundlegenden Ausbildung im Rahmen des Studiums zur Lehrperson für die obligatorische Volksschule sowie den Zertifikatslehrgang „CAS DaZ“, eine kantonale, postgraduale Professionalisierungsmaßnahme, die sich an Lehrer:innen aller Schulformen richtet. In ihrem Fazit diskutieren die Autor:innen die Situation von DaZ im allgemeinbildenden Schulsystem des Kantons Zürich und stellen in diesem Zusammenhang noch einmal strukturelle Missstände heraus.
In Österreich ist das Bildungswesen zentralistisch geregelt und im Rahmen des grundständigen Lehramtsstudiums kann DaZ dort aktuell nicht als Fach studiert werden. Wie Klaus-Börge Boeckmann und Daniela Rotter ausführen, gibt es derzeit – in Ergänzung zu verpflichtenden Sensibilisierungsangeboten mit nur geringem ECTS-Umfang – aber immerhin für Studierende des Primarstufenlehramts an zehn Studienstandorten in Österreich die Möglichkeit im Rahmen des grundständigen Studiums einen Schwerpunkt auf den DaZ-Bereich zu legen. Studierende des Sekundarschullehramts haben diese Möglichkeit nicht; sie können sich im Rahmen ihres grundständigen Studiums lediglich über Wahlpflichtangebote mit DaZ befassen. Umso bedeutsamer sind für diese Zielgruppe postgraduale Weiterbildungsangebote. Am Beispiel der Pädagogischen Hochschule Steiermark bieten die Autor:innen ferner einen detaillierten Einblick in das DaZ-bezogene Qualifizierungsangebot: Der Studienschwerpunkt „Sprachliche Bildung und Diversität“ ist dort für Studierende des Primarschullehramts grundständig wählbar, steht darüber hinaus aber auch bereits tätigen Lehrkräften im Rahmen eines postgraduales Erweiterungsstudiums als Qualifikationsangebot zur Verfügung.
Details
- Pages
- 276
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631889930
- ISBN (ePUB)
- 9783631889947
- ISBN (Hardcover)
- 9783631885598
- DOI
- 10.3726/b22036
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (October)
- Keywords
- Studienfachangebote (angehende) Lehrer:innen Deutschland Österreich Schweiz Professionalisierung Deutsch als Zweitsprache
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024., 276 S., 16 s/w Abb., 21 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG