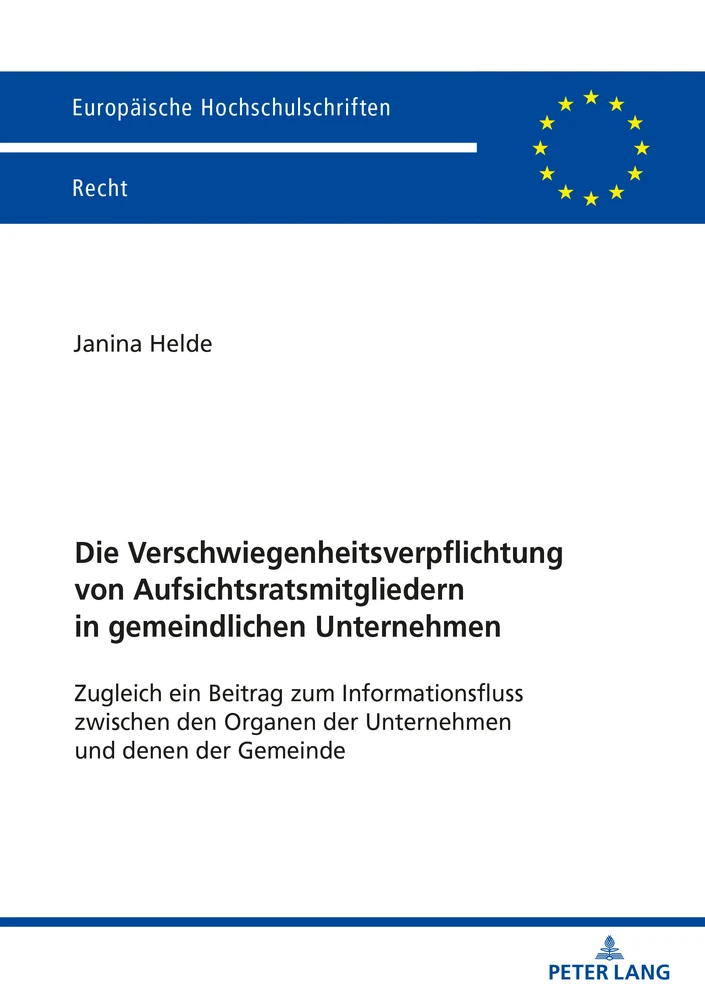Die Verschwiegenheitsverpflichtung von Aufsichtsratsmitgliedern in gemeindlichen Unternehmen
zugleich ein Beitrag zum Informationsfluss zwischen den Organen der Unternehmen und denen der Gemeinde
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Gliederung
- A. Einleitung
- I. Fragestellung und Gang der Untersuchung
- II. Die wirtschaftliche Betätigung des Staates in Privatrechtsform
- 1. Gründe für die wirtschaftliche Betätigung von Gemeinden in Privatrechtsform
- 2. Zulässigkeit der Beteiligung von Gemeinden an einem Unternehmen in Privatrechtsform
- 3. Unternehmensformen mit Aufsichtsrat
- a) Aktiengesellschaft
- b) GmbH
- 4. Das Verhältnis von öffentlich-rechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Vorgaben für gemeindliche Unternehmen in Privatrechtsform
- B. Verschwiegenheitsverpflichtung nach §§ 116 S. 1, 93 Abs. 1 S. 3 AktG
- I. Die Verschwiegenheitsverpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder einer Aktiengesellschaft
- 1. Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft
- 2. Verschwiegenheitsverpflichtung
- a) Sinn der Vorschrift
- b) Umfang der Verschwiegenheitsverpflichtung
- aa) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
- bb) Vertrauliche Angaben
- c) Grenzen der Verschwiegenheitsverpflichtung
- d) Sanktionierung bei Verstoß gegen Verschwiegenheitsverpflichtung
- II. Verschwiegenheitsverpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder einer GmbH mit obligatorischem Aufsichtsrat
- III. Verschwiegenheitsverpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder einer GmbH mit fakultativem Aufsichtsrat
- IV. Informationspflichten und Verschwiegenheitsverpflichtung
- C. Verfassungsrechtliche Vorgaben zur Informationspflicht der Gemeinde
- I. Die Grundlagen der verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Verwaltungstätigkeit unabhängig von der Organisationsform
- 1. Demokratieprinzip
- a) Ausübung von Staatsgewalt durch die unmittelbare Gemeindeverwaltung, öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen und gemeindliche Unternehmen in Privatrechtsform
- b) Legitimationsarten
- aa) Organisatorisch-personelle demokratische Legitimation
- bb) Sachlich-inhaltliche demokratische Legitimation
- aaa) Sachlich-inhaltliche demokratische Legitimation durch Gesetzesbindung
- bbb) Sachlich-inhaltliche demokratische Legitimation durch den Vorbehalt des Gesetzes
- ccc) Sachlich-inhaltliche demokratische Legitimation durch „sanktionierte demokratische Verantwortlichkeit“
- ddd) Sachlich-inhaltliche demokratische Legitimation durch die parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung
- eee) Bedeutung von Informationen für die sachlich-inhaltliche demokratische Legitimation durch die parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung
- cc) Verhältnis der verschiedenen Legitimationsformen untereinander
- dd) Entwicklungsoffenheit des Demokratieprinzips
- 2. Rechtsstaatsprinzip
- 3. Zusammenfassung: die Bedeutung von Informationspflichten für die demokratische Legitimation
- II. Die Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Verwaltungstätigkeit in den klassischen Organisationsformen
- 1. Unmittelbare Gemeindeverwaltung
- a) Grundzüge der unmittelbaren Gemeindeverwaltung
- b) Organisatorisch-personelle demokratische Legitimation
- c) Sachlich-inhaltliche Legitimation
- aa) Zuständigkeiten und Weisungsrechte
- bb) Informationsrechte und Verschwiegenheitsverpflichtung
- cc) Staatliche Aufsicht
- d) Zwischenfazit
- 2. Regiebetrieb
- a) Grundzüge des Regiebetriebs
- b) Organisatorisch-personelle und sachlich-inhaltliche demokratische Legitimation
- c) Zwischenfazit
- 3. Eigenbetrieb
- a) Grundzüge des Eigenbetriebs
- b) Organisatorisch-personelle demokratische Legitimation
- c) Sachlich-inhaltliche Legitimation
- aa) Zuständigkeiten und Weisungsrechte innerhalb des Eigenbetriebs
- bb) Zuständigkeiten und Weisungsrechte der Gemeindeorgane
- cc) Informationsrechte und Verschwiegenheitsverpflichtung
- dd) Staatliche Aufsicht
- d) Zwischenfazit
- 4. Selbstständige Kommunalanstalt
- a) Grundzüge der selbstständigen Kommunalanstalt
- b) Organisatorisch-personelle demokratische Legitimation
- c) Sachlich-inhaltliche Legitimation
- aa) Zuständigkeiten und Weisungsrechte innerhalb der Kommunalanstalt
- bb) Zuständigkeiten und Weisungsrechte der Gemeindeorgane
- cc) Informationsrechte und Verschwiegenheitsverpflichtung
- dd) Staatliche Aufsicht
- d) Zwischenfazit
- III. Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Verwaltungstätigkeit bei der Verwaltung durch gemeindliche Unternehmen in Privatrechtsform
- 1. Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- a) Organisatorisch-personelle demokratische Legitimation
- aa) Der fakultative Aufsichtsrat
- bb) Der mitbestimmte Aufsichtsrat
- cc) Der Geschäftsführer
- aaa) Bestellung des Geschäftsführers
- bbb) Bestellung des Geschäftsführers nach MitbestG
- b) Sachlich-inhaltliche Legitimation
- aa) Zuständigkeiten und Weisungsrechte innerhalb der GmbH
- bb) Zuständigkeiten und Weisungsrechte des gemeindlichen Trägers
- cc) Informationsrechte und Verschwiegenheitsverpflichtung
- dd) Staatliche Aufsicht
- c) Zwischenfazit
- 2. Aktiengesellschaft
- a) Organisatorisch-personelle demokratische Legitimation
- aa) Aufsichtsrat
- bb) Vorstand
- b) Sachlich-inhaltliche Legitimation
- aa) Zuständigkeiten und Weisungsrechte innerhalb der AG
- bb) Zuständigkeiten und Weisungsrechte des gemeindlichen Trägers
- cc) Informationsrechte und Verschwiegenheitsverpflichtung
- dd) Staatliche Aufsicht
- c) Zwischenfazit
- IV. Fazit
- D. Konfliktlösung durch § 394 S. 1 AktG
- I. Anwendungsbereich der §§ 394, 395 AktG
- 1. Staatliche Beteiligung
- 2. Bestellung „auf Veranlassung“
- II. Adressaten der Berichterstattung
- 1. Regelungssystematik und -zweck der §§ 394, 395 AktG
- 2. Berichtsadressaten innerhalb der Gemeinde
- III. Inhalt der Berichterstattung
- 1. §§ 394 S. 2 i. V. m. 116 S. 1, 93 Abs. 1 S. 3 AktG
- 2. Konkreter Inhalt der Berichtspflicht
- 3. Zweck der Berichtspflicht, vgl. § 394 S. 2 AktG
- 4. Art und Weise der Berichterstattung
- IV. Berichterstattungspflichten
- 1. Gesetz
- 2. Satzung
- 3. Rechtsgeschäft
- V. Grenzen der Berichterstattung
- 1. Verschwiegenheitsverpflichtung der Berichtsadressaten
- 2. Veröffentlichungsverbot
- VI. Zusammenfassung
- VII. Fazit
- E. Zusammenfassung und Gesamtfazit
- Literaturverzeichnis
A. Einleitung
I. Fragestellung und Gang der Untersuchung
Gemeinden bedienen sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben1 teilweise privatrechtlicher Organisationsformen.2 Sie gründen oder beteiligen sich an Unternehmen in Privatrechtsform, auf die das Gesellschaftsrecht Anwendung findet. Die gesellschaftsrechtlichen Regelungen orientieren sich unter anderem an den Prinzipien der Privatautonomie3 und der Gewinnorientierung.4 Gleichzeitig unterliegen die Gemeinden auch beim Tätigwerden in Privatrechtsform den Anforderungen, die das öffentliche Recht an sie stellt.5 Wie zu zeigen sein wird, ergibt sich bereits aus dem Demokratie- und dem Rechtsstaatsgebot, dass die Unternehmen, an denen Gemeinden ausschließlich oder mehrheitlich beteiligt sind (im Folgenden: gemeindliche Unternehmen), staatlich kontrolliert und am gemeinen Wohl orientiert sein müssen. Detailliertere Voraussetzungen für die privatrechtlich organisierte Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden normieren insbesondere das Kommunal- und das Haushaltsrecht. Die Gemeinden werden bei der privatrechtlich organisierten Aufgabenwahrnehmung somit im Spannungsfeld öffentlich-rechtlicher und gesellschaftsrechtlicher Regelungen tätig.6 Teilweise machen diese verschiedenen Rechtsgebiete gegenläufige Vorgaben für gemeindliche Unternehmen, was Kollisionsnormen oder spezielle, den Konflikt ausgleichende Regelungen erforderlich macht.7 Dieses Aufeinandertreffen von öffentlichem Recht und privatrechtlichem Gesellschaftsrecht wirft eine Vielzahl an juristischen Fragen auf, die auch von großer praktischer Relevanz sind.8 Augenscheinlich wird dies zum Beispiel bei den Rechten und Pflichten der auf Veranlassung von Gemeinden entsandten oder gewählten Aufsichtsratsmitglieder in einem gemeindlichen Unternehmen. Nach den §§ 116 S. 1, 93 Abs. 1 S. 3 AktG sind die Mitglieder des Aufsichtsrates zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Verschwiegenheitsverpflichtung umfasst insbesondere vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen und gilt grundsätzlich gegenüber jedermann. Die Verschwiegenheitsverpflichtung soll die „unbefangene Beratungs- und Abstimmungsteilnahme“ im Aufsichtsrat gewährleisten und Schäden für das Unternehmen verhindern, die durch die öffentliche Preisgabe derartiger Informationen entstehen könnten.9 Die Verschwiegenheitsverpflichtung ist das notwendige Gegenstück zu den sehr umfassenden Informationsrechten des Aufsichtsrates, vgl. § 90 Abs. 1 S. 1 und 2 AktG.10 Nur ein informierter Aufsichtsrat kann seiner Überwachungsfunktion in der Aktiengesellschaft gerecht werden.11
Damit die Tätigkeit der gemeindlichen Unternehmen demokratisch legitimiert ist, bedarf die Gemeinde Informationen über Unternehmensinterna.12 Die Verschwiegenheitsverpflichtung nach §§ 116 S. 1, 93 Abs. 1 S. 3 AktG gilt jedoch auch gegenüber den Aktionären,13 sodass für die Gemeinde relevante Informationen möglicherweise der Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen. Das Gesetz trägt diesem Bedürfnis der Gemeinde nach Information in § 394 S. 1 AktG Rechnung und lockert die Verschwiegenheitsverpflichtung nach §§ 116 S. 1, 93 Abs. 1 S. 3 AktG für die von einer beteiligten Gemeinde gewählten oder entsandten Aufsichtsratsmitglieder. § 395 AktG erstreckt wiederum u. a. die Verschwiegenheitsverpflichtung auf diejenigen, die durch die Lockerung des § 394 S. 1 AktG Informationen erhalten.14 Hierdurch soll der Konflikt aufgelöst werden, der sich aus dem Informationsinteresse der beteiligten Gemeinde einerseits und der sich aus dem Sinn und Zweck der Gesellschaftsstruktur ergebenden,15 strengen Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsräte andererseits ergibt.16
Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, ob § 394 S. 1 AktG eine den genannten Konflikt in angemessenen Ausgleich bringende Regelung der Verschwiegenheitspflicht von Aufsichtsratsmitgliedern in gemeindlichen Unternehmen darstellt. Sollte dies nicht der Fall sein, besteht die Möglichkeit, eine gesetzgeberische Neugestaltung der genannten Problematik einzufordern. Diese Untersuchung könnte jedoch auch ergeben, dass eine ausgleichende gesetzgeberische Regelung nicht für alle untersuchten Unternehmensformen des Privatrechts möglich ist. Dann dürften sich die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben bestimmter privatrechtlicher Organisationsformen nicht bedienen.
Zur Beantwortung der Frage, ob die Modifikation der grundsätzlichen Verschwiegenheitspflicht in § 394 S. 1 AktG den oben skizzierten Konflikt angemessen ausgleicht, wird unter A. II. der tatsächliche und rechtliche Rahmen des Konflikts erläutert. Der zweite Abschnitt dieser Arbeit (B.) widmet sich der Darlegung der §§ 116 S. 1, 93 Abs. 1 S. 3 AktG, die die Verschwiegenheitsverpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder einer AG regeln. Anschließend (C.) wird dargestellt, welche möglicherweise kollidierenden verfassungsrechtlichen Vorgaben für die Verwaltungstätigkeit in den klassischen Organisationsformen bestehen. Im Fokus steht die Frage, woraus sich die Informationsrechte des gemeindlichen Trägers bei der Verwaltungstätigkeit in unterschiedlichen Organisationformen ergeben. Der vierte Teil (D.) befasst sich mit der Thematik, inwieweit durch die Modifikation der Verschwiegenheitsverpflichtung in § 394 S. 1 AktG erreicht wird, dass die Gemeinde als Trägerin einer GmbH oder AktG die verfassungsrechtlich vorgegebenen Informationsrechte hat. Geklärt wird hier, ob § 394 S. 1 AktG den oben aufgezeichneten Konflikt ausgleichen kann oder ob eine gesetzgeberische Neuregelung einzufordern ist. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Gesamtfazit (Kapitel E.).
II. Die wirtschaftliche Betätigung des Staates in Privatrechtsform
Für diese Arbeit relevant ist nur die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden, die auch vom Begriff „gemeindliche Unternehmen“ in Privatrechtsform erfasst ist. Gemeindliche Unternehmen sind solche Unternehmen, auf die die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss ausüben kann.17 Der beherrschende Einfluss kann durch finanzielle Beteiligung, Satzung oder sonstige Regelungen, die die Tätigkeit des Unternehmens bestimmen, begründet werden. Bloße Kapitalbeteiligungen, die keine maßgeblichen Einflussrechte begründen, sind keine gemeindlichen Unternehmen. Diese Kapitalbeteiligungen sind dem Finanzvermögen zugeordnet.18 Wenn die Gemeinde zu 100 % Anteilseignerin einer Gesellschaft in Privatrechtsform ist, ist diese Gesellschaft eine „Eigengesellschaft“ der Gemeinde.19 Sobald neben der Gemeinde auch ein Privater Anteilseigner einer Gesellschaft in Privatrechtsform ist, wird hier die Rede von „gemischtwirtschaftlichen Unternehmen“ sein.20 Gemeindliche Unternehmen im hier verstandenen Sinne betätigen sich wirtschaftlich.21
1. Gründe für die wirtschaftliche Betätigung von Gemeinden in Privatrechtsform
Für die Ausgliederung der wirtschaftlichen Betätigung aus der öffentlichen Verwaltung hin zu privatrechtlichen Organisationsformen werden mannigfaltige Beweggründe genannt. Diese werden hier beispielhaft aufgeführt, ohne deren inhaltliche Stichhaltigkeit zu bewerten.22 In Bezug auf die unmittelbare Verwaltung greifen die strengen haushalts- und dienstrechtlichen Vorschriften, sodass die formelle Privatisierung23 mit der Hoffnung auf ein wesentlich höheres Maß an Flexibilität verbunden wird.24 Eine stärkere Orientierung an den unternehmerischen Notwendigkeiten sei möglich, dies gelte insbesondere im Hinblick auf eine flexiblere Personal- und Haushaltspolitik.25 Entscheidungserheblich können ebenso steuerrechtliche Erwägungen sein.26 Außerdem ist die Beteiligung privater Dritter an einem Unternehmen zum Kapitalerwerb27 oder zur Rekrutierung externer Expertise28 erst durch privatrechtliche Organisation möglich. Oftmals dient die Umwandlung oder Gründung von Unternehmen in Privatrechtsform auch der Vorbereitung der materiellen Privatisierung.29 Die privatrechtliche Ausgestaltung soll ebenso einen psychologischen Effekt hervorrufen: es wird erwartet, dass das Arbeitsklima stärker von einer privatwirtschaftlichen Atmosphäre bestimmt wird, welche die Mitarbeiter beispielsweise zu einer effizienteren Arbeitsweise veranlassen soll.30 Nicht zuletzt wird durch eine privatrechtliche Ausgestaltung eine Haftungsbegrenzung auf das Gesellschaftsvermögen möglich.31 Der Gesellschafter, hier die Gemeinde, bleibt dadurch vor Zugriffen Dritter auf das eigene Vermögen bewahrt.
2. Zulässigkeit der Beteiligung von Gemeinden an einem Unternehmen in Privatrechtsform
Aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive steht den Gemeinden als Trägern von öffentlichen Unternehmen die Wahl aller Rechtsformen offen.32 Sie werden nicht anders behandelt als andere juristische und natürliche Personen.33 Auch das Grundgesetz und das Unionsrecht stehen der Gründung von gemeindlichen Unternehmen oder der Beteiligung an gemischtwirtschaftlichen Unternehmen durch Gemeinden nicht grundsätzlich im Wege. Sie sehen kein Verbot gemeindlicher Unternehmen in Privatrechtsform vor.34 Insbesondere aus der Finanzverfassung ergibt sich lediglich, dass Zweck der gemeindlichen Unternehmen nicht ausschließlich die Gewinnerzielung sein darf.35
In Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG ist die Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden geregelt. Von dieser umfasst ist unter anderem die „objektive Rechtsinstitutionsgarantie“, die das „Was“, „Wie“ und „Worin“ der gemeindlichen Selbstverwaltung sichert.36 Die Gemeinde ist für die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zuständig („Allzuständigkeit“) und regelt diese eigenverantwortlich.37 Teilaspekt der Eigenverantwortlichkeit ist die Organi- sationshoheit.38 Die Gemeinde kann unter anderem wählen, in welcher Form sie ihre Aufgaben erfüllt.39 In Betracht kommen die Formen der unmittelbaren oder mittelbaren Verwaltung sowohl durch öffentlich-rechtliche als auch durch privatrechtliche Rechtsträger.40 Ebenso von der Eigenverantwortlichkeit umfasst ist die Kooperationshoheit.41 Die Gemeinden können sich mit anderen Gemeinden zusammenschließen oder gemeinsam mit Privaten ihre Aufgaben erfüllen. Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG garantiert die Selbstverwaltung jedoch nur im Rahmen der Gesetze. Hieraus folgt auch für die Organisations- und Kooperationshoheit, dass sie durch Gesetze in verfassungsrechtlich zulässigem Rahmen beschränkbar ist.42 Für die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden finden sich solche Regelungen in den Gemeindeordnungen.43
Die landesrechtlichen Regelungen orientieren sich im Grundsatz noch heute an § 67 der Deutschen Gemeindeordnung (DGO),44 wonach drei Zulässigkeitsvoraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung von Gemeinden vorliegen müssen. Ein öffentlicher Zweck muss das gemeindliche Unternehmen rechtfertigen und der Umfang des Unternehmens darf nicht außer Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune stehen. Zudem darf der Zweck nicht besser oder wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt werden („Subsidiaritätsklausel“).45 Obwohl sich alle Gemeindeordnungen an dieser Schrankentrias orientiert haben, sind sie nicht identisch. Diese Arbeit orientiert sich an der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO). Wiederum allen gemeinderechtlichen Regelungen gemein ist die Voraussetzung, dass die unbegrenzte Haftung der Gemeinde bei privatrechtlich organisierter wirtschaftlicher Betätigung verboten ist, vgl. § 103 Abs. 1 Nr. 4 GemO. Dies hat unter anderem zur Folge, dass den Gemeinden nur solche Rechtsformen zur Wahl stehen, die eine Haftungsbegrenzung auf das Gesellschaftsvermögen zulassen. Außerdem sehen alle Gemeindeordnungen vor, dass der Einfluss der Gemeinde gewährleistet sein muss, vgl. § 103 Abs. 1 Nr. 3 GemO. Welche Anforderungen an die Möglichkeit der Einflussnahme gestellt werden, wird in den Abschnitten C und D erläutert.
3. Unternehmensformen mit Aufsichtsrat
Die Unternehmensformen des Gesellschaftsrechts sind nicht alle geeignet, die unter II. 2. skizzierten Zulässigkeitskriterien für die gemeindlichen Unternehmen in Privatrechtsform einzuhalten. Die Beteiligung an oder die Gründung von Personengesellschaften kommt zwar grundsätzlich in Betracht, allerdings nicht zur Gründung von Eigengesellschaften, da Personengesellschaften vertraglich begründet werden und somit mindestens zwei Gründungsmitglieder voraussetzen. Bei der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts und gleichermaßen bei der offenen Handelsgesellschaft ist die unbeschränkte Haftung der Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft46 nicht mit der oben genannten Voraussetzung der begrenzten Haftung vereinbar.47 Gemeindliche Träger könnten als Kommanditisten an einer Kommanditgesellschaft beteiligt sein, da diese zwar persönlich, aber der Höhe nach auf die Haftungseinlage begrenzt haften, vgl. §§ 171 ff HGB.). Vor allem werden gemeindliche Unternehmen in Privatrechtsform jedoch als Kapitalgesellschaften betrieben, namentlich als Aktiengesellschaft oder als Gesellschaft mit beschränkter Haftung.48 Auf diese Rechtsformen beschränkt sich diese Arbeit.
a) Aktiengesellschaft
Die Aktiengesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft, die lediglich mit dem Gesellschaftsvermögen haftet, vgl. § 1 Abs. 1 S. 2 AktG.49 Nach § 2 AktG ist es einer Einzelperson möglich, eine Aktiengesellschaft zu gründen. Somit kommt die Rechtsform der Aktiengesellschaft auch zur Gründung einer Eigengesellschaft in Betracht. Sie verfügt über drei Organe: den Vorstand (§§ 76 ff AktG), den Aufsichtsrat (§§ 95 ff AktG) und die Hauptversammlung (§§ 118 ff AktG). § 103 Abs. 2 GemO bestimmt, dass auf die Rechtsform der Aktiengesellschaft nur zurückgegriffen werden darf, wenn „der öffentliche Zweck des Unternehmens“ nicht ebenso gut in einer anderen Rechtsform realisiert werden kann. Die Aktiengesellschaft eignet sich insbesondere dann besser als andere Rechtsformen, wenn das Unternehmen in einer Branche tätig wird, in der es auf externes Kapital angewiesen ist.50 Für Private macht die Formenklarheit des Aktienrechts – die Zuständigkeitsbereiche der Gesellschaftsorgane sind nicht disponibel – die Beteiligung an einer Aktiengesellschaft kalkulierbar und dadurch attraktiv.51 Gemeinden bedienen sich daher häufig der Rechtsform der Aktiengesellschaft, um eine materielle Privatisierung vorzubereiten.52
b) GmbH
Auch die GmbH ist eine juristische Person, deren Haftung nach § 13 Abs. 2 GmbHG auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt ist.53 Nach § 1 GmbHG ist die Gründung einer Einmanngesellschaft möglich. Das GmbHG enthält viele dispositive Regelungen. Zwingend vorgeschrieben ist, dass die GmbH einen oder mehrere Geschäftsführer, vgl. § 6 Abs. 1 GmbHG, und eine Gesellschafterversammlung, vgl. §§ 45 ff GmbHG, hat, in der die Gesamtheit der Gesellschafter vertreten ist. Ein Aufsichtsrat kann, muss aber nicht eingerichtet werden („fakultativer Aufsichtsrat“), vgl. § 52 Abs. 1 GmbHG. Lediglich in einigen Fällen ist ein obligatorischer Aufsichtsrat vorgesehen.54
4. Das Verhältnis von öffentlich-rechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Vorgaben für gemeindliche Unternehmen in Privatrechtsform
Aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive werden Gesellschaften unabhängig davon, ob eine Gemeinde oder ein Privater Gesellschafter bzw. Aktionär ist, gleichbehandelt. Das bedeutet, dass das GmbHG bzw. das AktG grundsätzlich unabhängig von der Rechtsnatur der Gesellschafter oder Aktionäre gleichermaßen Anwendung finden.55 Durch die Wahl einer privatrechtlichen Organisationsform können sich Gemeinden ihren öffentlich-rechtlichen Bindungen gleichwohl nicht entziehen.56 Gemeinden haben auch bei der Gründung von und der Beteiligung an gemeindlichen Unternehmen in Privatrechtsform die aus dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Rechte und Pflichten.57 Somit bestehen gesellschaftsrechtliche und öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, was zu divergierenden bzw. konträren Vorgaben für gemeindliche Unternehmen durch die unterschiedlichen Rechtsgebiete führen kann. Welchem Regelungssystem bei einer Kollision von konträren Direktiven der Vorrang zu gewähren ist, wird unterschiedlich bewertet und unter den Stichwörtern „Lehre vom Verwaltungsgesellschaftsrecht“ bzw. „Lehre vom Vorrang des Gesellschaftsrechts“ diskutiert. Vertreter der „Lehre vom Verwaltungsgesellschaftsrecht“ plädieren für eine Modifikation oder Überlagerung der gesellschaftsrechtlichen Normen, um die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen durch die gemeindlichen Unternehmen in Privatrechtsform zu gewährleisten.58 Hieraus ergibt sich beispielsweise die Forderung nach einer Bindung der Aufsichtsratsmitglieder an die Weisungen des Aktionärs, also der Gemeinde,59 während das Gesellschaftsrecht grundsätzlich die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder vorsieht. Die „Lehre vom Vorrang des Gesellschaftsrechts“ geht hingegen von einer uneingeschränkten und nicht anpassbaren Anwendbarkeit der gesellschaftsrechtlichen Normen aus.60
§ 394 S. 1 AktG, welcher die Verschwiegenheitsverpflichtung der von Gemeinden gewählten oder entsandten Aufsichtsratsmitgliedern lockert, zeigt, dass der Gesetzgeber den oben aufgezeigten Konflikt zwischen öffentlich-rechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Regelungen gesehen hat. Das Aktiengesetz regelt ausschließlich die Frage der Verschwiegenheitsverpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder in gemeindlichen Unternehmen und äußert sich im Übrigen nicht zur Stellung des gemeindlichen Trägers bzw. der Gesellschaftsorgane in gemeindlichen Unternehmen.61 Hieraus lässt sich ableiten, dass der Gesetzgeber, abgesehen von der speziell modifizierten Verschwiegenheitsverpflichtung, von der uneingeschränkten Anwendbarkeit der gesellschaftsrechtlichen Normen ausgeht.62 Hierfür sprechen auch die Überschrift zu § 394 S. 1 AktG: „Sondervorschriften bei Beteiligung von Gebietskörperschaften“63 und die Entstehungsgeschichte.64 Der Vorrang der gesellschaftsrechtlichen Normen vor den Regelungen der Gemeindeordnungen ergibt sich zudem aus dem Grundsatz „Bundesrecht bricht Landesrecht“, vgl. Art. 31, 72 Abs. 1 GG. Eine Modifikation des Gesellschaftsrechts durch das Gemeindeorganisationsrecht ist hiernach ausgeschlossen.65
Anders als teilweise vertreten, lässt sich der Vorrang des Gesellschaftsrechts aber nicht mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre bzw. der Gesellschafter66 begründen. Dieser Grundsatz besagt zwar, dass die Aktionäre und Gesellschafter „unter gleichen Voraussetzungen gleich zu behandeln“67 sind. Ausnahmen vom Gleichbehandlungsgrundsatz sind jedoch dann zulässig, wenn sie nicht willkürlich sind.68 Eine Andersbehandlung gemeindlicher Aktionäre ist durch den Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre daher nicht kategorisch ausgeschlossen.69
Die Lehre vom Verwaltungsgesellschaftsrecht argumentiert gegen den Vorrang des Gesellschaftsrechts, in dem sie auf die der Theorie des Verwaltungsprivatrechts zugrunde liegende Idee verweist:70 Nicht nur das Handeln der Gemeinde in Privatrechtsform unterliegt öffentlich-rechtlichen Bindungen (so die Grundlage der Theorie des Verwaltungsprivatrechts). Auch die gemeindliche Organisation in gesellschaftsrechtlicher Unternehmensform hat sich an öffentlich-rechtliche Vorgaben zu halten.71 Nur durch eine verfassungskonforme Modifikation gesellschaftsrechtlicher Normen könne die Einhaltung dieser Bindungen gewährleistet werden. Die Idee des Verwaltungsgesellschaftsrechts ist jedoch nicht mit der Idee des Verwaltungsprivatrechts vergleichbar.72 Unter dem Stichwort Verwaltungsprivatrecht wird die Einschränkung privatrechtlicher Normen wegen öffentlich-rechtlicher Regelungen diskutiert.73 Das Verwaltungsgesellschaftsrecht möchte hingegen das Gesellschaftsrecht erweitern.74 Dies scheitert, wie oben bereits erläutert, schon daran, dass der Gesetzgeber bereits abschließende Sondervorschriften erlassen hat.75 Darüber hinaus sind keine Modifikationen denkbar. Aus den genannten Punkten ist die Lehre vom Verwaltungsgesellschaftsrecht abzulehnen. Es ist vom Vorrang des Gesellschaftsrechts auszugehen.76 Gemeinden sind demnach verpflichtet, sich einer Form des Privatrechts nicht zu bedienen, wenn mit dieser die verfassungsrechtlich gebotenen Pflichten nicht realisierbar sind.77
1 Zum Begriff und zur Dogmatik der Aufgabe Baer in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle GVwR I, S. 979 § 13 Rn. 12 ff.
Details
- Pages
- 152
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631915226
- ISBN (ePUB)
- 9783631915233
- ISBN (Softcover)
- 9783631915127
- DOI
- 10.3726/b21591
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (November)
- Keywords
- gemeindliche Unternehmen Informationspflichten Gesellschaftsrecht Verwaltungsrecht Verschwiegenheitsverpflichtung von Aufsichtsratsmitgliedern Kommunales Wirtschaftsrecht
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 152 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG