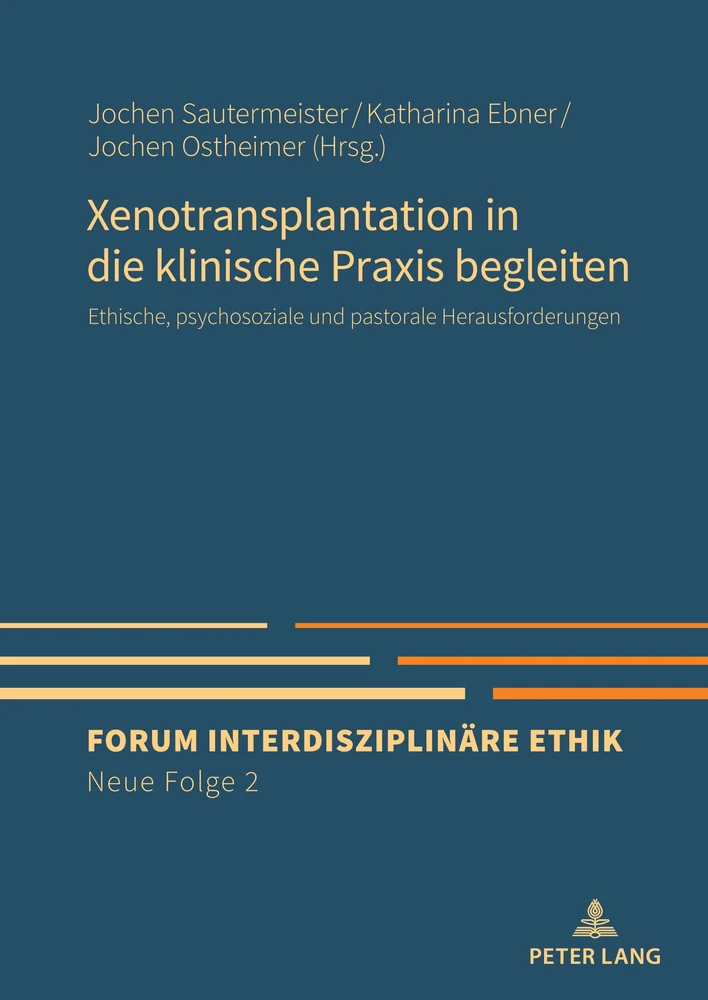Xenotransplantation in die klinische Praxis begleiten
Ethische, psychosoziale und pastorale Herausforderungen
Summary
Welche Auswirkungen hat die Xenotransplantation für die Identität und Lebensführung von Menschen? Die Beiträge des Bandes diskutieren ethische und psychosoziale Herausforderungen der Xenotransplantation und sondieren, welche Aspekte für die Klinikseelsorge relevant sein können, wenn dieses transplantationsmedizinische Verfahren in der Klinik Einzug erhält.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort (Jochen Ostheimer, Katharina Ebner und Jochen Sautermeister)
- Xenotransplantation in die klinische Praxis begleiten. Perspektiven für die Krankenhausseelsorge (Jochen Ostheimer, Katharina Ebner und Jochen Sautermeister)
- Theoretische Rahmung
- Szenarien in der Medizinethik. Die Bedeutung des Narrativen in der Xenotransplantationsforschung (Jochen Ostheimer)
- Von Tieren und Menschen. Beobachtungen zum Mensch-Tier-Verhältnis und ihre Relevanz für die Xenotransplantation (Katharina Ebner)
- Konzeptionelle Zugänge zur Begleitung
- Die Bedeutung von Identität und Leiblichkeit für die theologisch-ethische Reflexion der Xenotransplantation (Jochen Sautermeister)
- Allo- und Xenotransplantation aus transplantationspsychologischer Perspektive (Heike Neumann, Sylvia Kröncke und Angela Buchholz)
- Momente einer Transplantations-Pastoral (Ottmar Fuchs)
- Identitätsarbeit begleiten. Theoretische und handlungspraktische Herausforderungen für die seelsorgliche Begleitung von Xenotransplantationspatientinnen und -patienten (Veronika Bogner)
- Seelsorgliche Perspektiven aus der Klinik
- Erfahrungen aus der Klinikseelsorge im Bereich Transplantationsmedizin (Heidemarie Hürten)
- Klinikseelsorge aus muslimischer Sicht. Praktische Erfahrungen und ihre Relevanz für die Xenotransplantation (Rabia Bechari und Ahmed Douirani)
- Transplantation, aber jüdisch korrekt. Reflexionen basierend auf rund 3500 Jahren bio- und medizinethischer Tradition (Eva Weisz und Willy Weisz)
- Ekel und Scham in der seelsorglichen Begleitung am Beispiel der Xenotransplantation (Heidemarie Hürten und Bernhard Barnikol-Oettler)
- Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
- Reihenübersicht
Jochen Ostheimer, Katharina Ebner und Jochen Sautermeister
Vorwort
Ausgangspunkt des vorliegenden Bandes ist ein transdisziplinäres, interreligiöses Expertengespräch haupt- und ehrenamtlicher Krankenhausseelsorgerinnen und -seelsorger im Jahr 2018, das im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Transregio-Sonderforschungsbereichs 127 „Biologie der xenogenen Zell-, Gewebe- und Organtransplantation – vom Labor in die Klinik“1 gefördert wurde.
Im Rahmen des theologisch-ethischen Teilprojekts sollte u. a. die klinikseelsorgliche Sicht auf die Xenotransplantation sondiert werden. Dazu wurden Klinikseelsorgerinnen und Klinikseelsorger aus dem deutschsprachigen Raum zu einem explorativen Austausch über die „pastoralen Herausforderungen der Xenotransplantation“ eingeladen. Sieben erfahrene Praktikerinnen und Praktiker aus der katholischen und der evangelischen Kirche, aus dem Islam und aus dem Judentum diskutierten bei dem interreligiös gestalteten Expertengespräch, das im Oktober 2018 stattfand, die Möglichkeiten der pastoralen und psychosozialen Begleitung in der klinischen Versuchsphase und entwickelten erste Orientierungsperspektiven. Ausgehend von den bisherigen seelsorglichen Erfahrungen wurden mögliche Reaktionen von Betroffenen insbesondere in religiöser Hinsicht antizipiert, und seelsorgliche Handlungsmöglichkeiten zur Diskussion gestellt.2 Damit wurde der Weg „vom Labor zum Krankenbett“, wie das Motto des Sonderforschungsbereichs lautet, in einer Hinsicht antizipierend und exemplarisch abgeschritten.
Auf der Grundlage des gemeinsamen Gesprächs sollten die Praktikerinnen und Praktiker ihre Überlegungen im Nachgang zusammenfassen und weiterführen. Die hier vorliegenden Aufsätze setzen somit das Fachgespräch in einem anderen Medium fort. Die Ergebnisse des gemeinsamen Nachdenkens werden durch zusätzliche Beiträge aus ethischer, humanwissenschaftlicher und theologischer Forschung vertieft. Transplantationspsychologische, pastoraltheologische und ethische Perspektiven leuchten ergänzende Facetten und Hintergründe aus. Allen Autorinnen und Autoren gebührt Dank für ihre Bereitschaft, sich auf dieses Projekt einzulassen.
Für die formal-redaktionelle Bearbeitung der Beiträge zu unterschiedlichen Stadien sei Frau Sarah Linnartz, Frau Theresa van Krüchten und Frau Nicole P. Simon gedankt, ebenso Herrn Prof. Dr. Konrad Hilpert für die wertvollen Anregungen durch sein peer review sowie dem Lang-Verlag, insbesondere Herrn Andreas Stähli für die umsichtige Begleitung der Drucklegung. Ihnen allen gilt unser Dank, ebenso der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die finanzielle Förderung der Drucklegung. Sollte das Buch dazu beitragen, für ethische, pastorale und psychosoziale Fragen im Kontext der Krankenhausseelsorge zu sensibilisieren, sobald die Xenotransplantation Einzug in die Klinik findet, hat es seinen Zweck erfüllt.
Augsburg, Würzburg, Bonn im Frühjahr 2024
Jochen Ostheimer, Katharina Ebner, Jochen Sautermeister
1 Vgl. Klinikum Uni München, Biology of xenogeneic cell and organ transplantation, in: https://www.klinikum.uni-muenchen.de/SFB-TRR-127/de [abgerufen am 20.03.2023].
2 Vgl. Ebner, Katharina/Ostheimer, Jochen/Sautermeister, Jochen, The role of religious beliefs for the acceptance of xenotransplantation. Exploring dimensions of xenotransplantation in the field of hospital chaplaincy, in: Xenotransplantation 27 (2020) 4, e12579, in: https://doi.org/10.1111/xen.12579 [abgerufen am 20.03.2023].
Jochen Ostheimer, Katharina Ebner und Jochen Sautermeister
Xenotransplantation in die klinische Praxis begleitenPerspektiven für die Krankenhausseelsorge
1. Xenotransplantation – Hintergründe, Ziele und Vorgehensweisen
Der Mangel an Spenderorganen ist seit Jahren ein drängendes Problem. Zu Beginn des Jahres 2022 warteten mehr als 8.500 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan, davon 727 auf ein Herz. 826 Personen verstarben im Jahr 2021 auf einer Warteliste für ein Organ.1 Die Zahl menschlicher Organspender stagniert oder ist sogar leicht rückläufig, so dass eine Auflösung dieser Missverhältnisse mittelfristig nicht zu erwarten ist. Auch wenn es im Jahr 2021 mit 933 postmortalen Organspenderinnen und -spendern einen leichten Anstieg gab, ist darin noch keine Trendwende zu erkennen.2 Die verschiedenen Bemühungen, die Zahl der potentiellen Spenderinnen und Spender zu erhöhen, wie etwa von der Politik geförderte öffentliche Informations- und Aufklärungskampagnen, konnten die Lücke nicht schließen. Auch die Einführung des Widerspruchsverfahrens in verschiedenen Ländern vermochte das Defizit lediglich zu verkleinern. Während bei dieser Regelung jede bzw. jeder als potenzielle/r Organspender/in betrachtet wird, sofern er oder sie dem nicht ausdrücklich widerspricht, gilt in Deutschland trotz aller Diskussionen die Einwilligungsregel. Demnach muss man seine Bereitschaft zur Organspende aktiv und ausdrücklich erklären, etwa in Form eines Organspenderausweises.
Abgesehen vom Organmangel gehen menschliche Organspenden mit einem großen medizinischen Aufwand einher und können zu nicht unerheblichen psychischen und psychosozialen Belastungen führen. Die Hoffnung auf eine lebensrettende, -verlängernde oder die Lebensqualität verbessernde Transplantation ist bei einer postmortalen Organspende zwangsläufig mit dem Tod des Spenders bzw. der Spenderin verbunden. Bei den meisten erforderlichen Organspenden ist außerdem eine Lebendspende nicht möglich. Denn diese setzt paarige bzw. sich regenerierende Organe voraus. Daher wird seit Jahren an Alternativen geforscht, etwa der Herstellung künstlicher Organe durch Gewebekonstruktion (tissue engineering) oder 3D-Biodrucker. Diese Verfahren sind noch weit vom klinischen Einsatz entfernt. Weiter sind hingegen verschiedene Verfahren, tierische Organe, Gewebe und Zellen zu verpflanzen: die sog. Xenotransplantation. Am 7. Januar 2022 erhielt mit dem US-Amerikaner David Bennett erstmals ein Patient im Rahmen eines klinischen Versuchs einer Xenotransplantation ein Schweineherz. Bennett war aufgrund seiner Vorerkrankungen und seines generellen Gesundheitszustands für andere Therapien wie auch für die Warteliste für ein menschliches Spenderherz nicht in Frage gekommen. Er lebte mit dem xenogenen Herzen weitere zwei Monate und starb am 8. März 2022.
Forscherinnen und Forscher im Transregio-Sonderforschungsbereich (TRR-SFB) Biologie der Xenogenen Zell-, Gewebe- und Organtransplantation von der Grundlagenforschung zur klinischen Anwendung, die unabhängig von dem US-amerikanischen Forscherteam an der Transplantation von Herzen forschen, prognostizieren für das Jahr 2024 erste klinische Versuche mit genetisch veränderten Schweineherzen in Deutschland.3
Die US-amerikanische Transplantation eines Schweineherzens war allerdings nicht die erste Xenotransplantation überhaupt. Die Xenotransplantation, also die artübergreifende Verpflanzung von lebenden Zellen, Geweben oder Organen, hat eine lange Geschichte. Nach ersten Versuchen in der Neuzeit, bei denen oftmals Blut von Tieren, etwa von Lämmern, übertragen wurde, um die als positiv wertgeschätzten Eigenschaften der jeweiligen Tierart zu übertragen, gab es Anfang des 20. Jahrhunderts eine neue, sehr experimentelle Hochphase. So wurden bei den ersten Nierentransplantationen überhaupt Organe von Schweinen und Schafen genutzt.4 Aufgrund von Abstoßungsreaktionen waren die Versuche nicht erfolgreich. Auf diese frühe chirurgische Periode folgten Phasen erst der unspezifischen und dann der spezifischen Immunsuppression, die zu den aktuellen Forschungsbemühungen führte, in denen die Gentechnik eine entscheidende Rolle spielt. Dabei wurden und werden zu Forschungszwecken und für präklinische Studien auch Organe zwischen verschiedenen Tierarten verpflanzt.5
Ein bedeutsames Ereignis war die erste Verpflanzung eines Affenherzens, die zugleich die erste Herztransplantation überhaupt war. 1964 erhielt in den USA ein 68-jähriger Mann mit terminaler Herzinsuffizienz ein Schimpansenherz und verstarb nach wenigen Stunden. Erst drei Jahre später erfolgte in Südafrika eine allogene Herzübertragung, also die Transplantation eines menschlichen Herzens. Ein nächster bedeutender Schritt in der Forschung, der zugleich heftige Debatten auslöste und auch die medizinethische Forschung vorantrieb, war 1984 die Übertragung eines Pavianherzens auf ein neugeborenes Kind, das 21 Tage überlebte und schließlich an multiplem Organversagen starb, wobei das Herz aber noch grundsätzlich funktionstüchtig war.
Details
- Pages
- 180
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631917565
- ISBN (ePUB)
- 9783631917572
- ISBN (Hardcover)
- 9783631717622
- DOI
- 10.3726/b21762
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- Medizinethik Xenotransplantation Theologische Ethik Klinikseelsorge Judentum Christentum Islam
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 180 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG