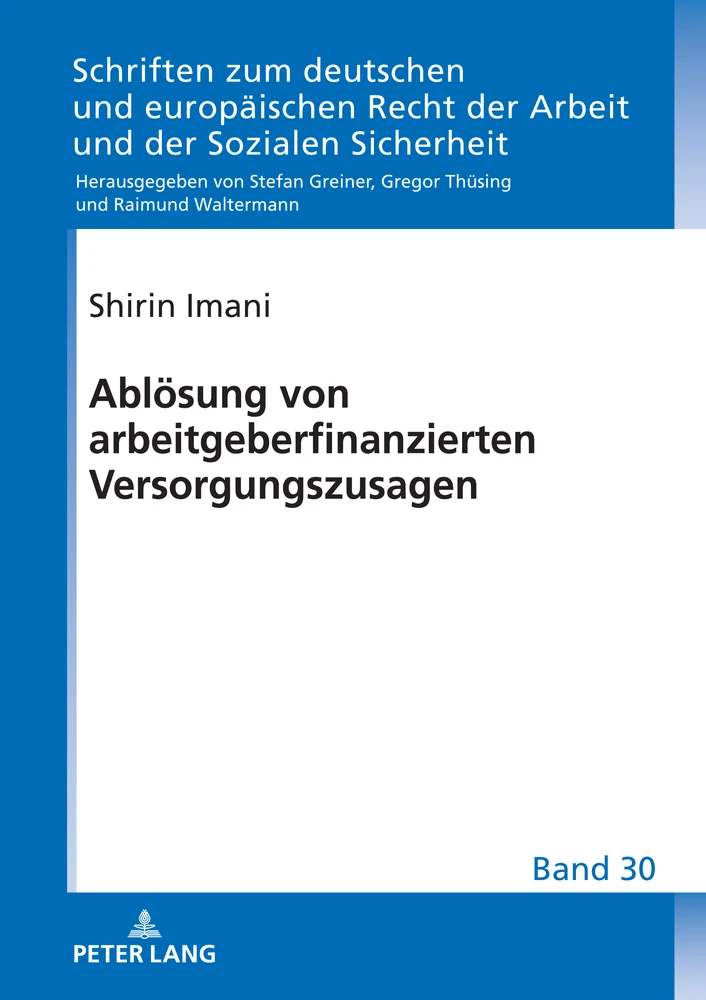Ablösung von arbeitgeberfinanzierten Versorgungszusagen
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhalt
- A. Die Betriebliche Altersversorgung – „das beste Ruhekissen“ für Beschäftigte?
- I. Interessengerechte Flexibilisierung von arbeitgeberfinanzierten Versorgungszusagen
- II. Kernfragen und Gang der Darstellung
- B. Allgemeine Grundlagen von Versorgungszusagen
- I. Rechtsgrundlage zur Begründung von Versorgungszusagen
- 1. Einzelzusage
- 2. Gesamtzusage und betriebliche Einheitsregelung
- 3. Betriebliche Übung
- 4. Allgemeiner Gleichbehandlungsgrundsatz und sonstige Diskriminierungsverbote
- 5. Betriebsvereinbarung
- a) Sachliche Regelungskompetenz der Betriebsparteien
- b) Personelle Regelungskompetenz der Betriebsparteien
- 6. Tarifvertrag
- a) Sachliche Regelungskompetenz der Tarifvertragsparteien
- b) Personelle Regelungskompetenz für Ruheständler
- II. Sicherung von Anpassungsmöglichkeiten mit Begründung von Versorgungszusagen
- C. Änderung von arbeitgeberfinanzierten Versorgungszusagen
- I. Formelle Voraussetzungen der Anpassungen von Versorgungszusagen
- 1. Individualvertragliche Versorgungszusage mit und ohne kollektivrechtlichen Bezug
- a) Einvernehmliche vertragliche Ablösung
- aa) Belehrungspflichten
- (1) Grundsätze aus der Rechtsprechung
- (2) Bedeutung für Änderungsvereinbarungen zu Versorgungszusagen im laufenden Arbeitsverhältnis und bei einvernehmlicher Beendigung des Arbeitsverhältnisses
- bb) AGB-Kontrolle von individuellen Änderungsvereinbarungen
- (a) Überraschende Klausel im Sinne des § 305c Abs. 1 BGB
- (b) Transparenz, § 307 Abs. 1 S. 2 BGB
- (c) Angemessenheit im Übrigen und vollständiger Verzicht auf die Versorgungszusage im laufenden Arbeitsverhältnis im Besonderen
- cc) Unzulässigkeit des Verzichts im Aufhebungsvertrag
- b) Ablösung durch Änderungskündigung
- aa) Erfordernis einer Änderungskündigung
- bb) Kein Ausschluss der Änderungskündigung – Verhältnis zum Wegfall der Geschäftsgrundlage
- cc) Maßstab der Entgeltreduzierung durch Änderungskündigung
- c) Ablösung bei vorbehaltenem Widerruf
- aa) Grundsätzliche Entwicklung der Anforderungen an Widerrufsklauseln im Arbeitsrecht
- bb) Übertragbarkeit auf Versorgungszusagen – Anforderungen an Widerrufsklauseln
- (a) Widerrufsgründe in der betrieblichen Altersversorgung
- (b) Wirtschaftliche Notlage als Widerrufsgrund
- (c) Treuepflichtverletzung
- (d) Planwidrige Überversorgung
- cc) Widerrufsvorbehalt in der betrieblichen Altersvorsorge – eine Notwendigkeit?
- d) Vertragsanpassung aufgrund einer Störung der Geschäftsgrundlage
- aa) Allgemeine Voraussetzungen
- bb) Niedrigzinsen als Fallgruppe der Störung der Geschäftsgrundlage
- e) Ablösung durch Kollektivvertrag – kollektivvertragsoffene Regelungen
- aa) Entwicklung in der Rechtsprechung
- bb) Kritische Stimmen der Literatur
- cc) Bewertung: Divergenz von Dogmatik und Praktikabilität
- 2. Betriebsvereinbarung
- a) Grundsätzliche Ablösbarkeit durch Betriebsvereinbarung und Tarifvertrag
- b) Ablösbarkeit durch Betriebsvereinbarung: Mitbestimmung des Betriebsrats bei Änderungen von Versorgungszusagen
- aa) Mitbestimmungsfreier Teil
- bb) Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 und 10 BetrVG
- cc) Risiken unterbliebener Mitbestimmung
- c) Reichweite der Ablösbarkeit durch Betriebsvereinbarung für Rentner und Ausgeschiedene
- d) Einseitige Lösbarkeit durch den Arbeitgeber
- aa) Die simple Möglichkeit: Kündigungsmöglichkeit ohne Nachwirkung
- (1) Ohne ausdrückliche Regelung des Ausschlusses der Nachwirkung
- (2) Ausdrückliche Regelung des Ausschlusses der Nachwirkung
- (3) Durchbrechung der Gesetzessystematik: Stimmen aus der Literatur
- (4) Bewertung: Einseitiges Ablösungsrecht im Einklang mit der Gesetzessystematik
- bb) Kündigungsmöglichkeit und -wirkung bei vereinbarter Nachwirkung / Einigungsstelle
- (1) Zuständigkeit und Entscheidungskompetenz der Einigungsstelle
- (2) Maßstab im Rahmen der Entscheidungskompetenz der Einigungsstelle
- 3. Tarifvertrag
- a) Grundsätzliche Ablösbarkeit
- b) Reichweite der Ablösbarkeit für Rentner und Ausgeschiedene
- 4. Ergebnis zu möglichen Ablösungsinstrumenten
- II. Materielle Voraussetzungen der Anpassung von Versorgungszusagen
- 1. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Eingriffe in Versorgungsanwartschaften
- 2. Reduzierung der Höhe der Versorgungsanwartschaften
- a) Maßstab für die Ablösung von Versorgungszusagen auf individualvertraglicher Ebene
- b) Maßstab für die Ablösung von Versorgungszusagen in Betriebsvereinbarungen und Arbeitsverträgen mit kollektivem Bezug durch Betriebsvereinbarung: Drei-Stufen-Modell
- aa) Ursprung des Drei-Stufen-Modells und Verhältnis zum Rechtsinstitut der Störung der Geschäftsgrundlage
- bb) Entwicklung des Drei-Stufen-Modells
- cc) Inhalt des vom BAG entwickelten Modells
- (1) 1. Stufe: Schutz des erdienten Teilbetrags
- (a) Schutzbereich der 1. Stufe
- (aa) Erdienter Teilbetrag bei einer reinen Leistungszusage
- (bb) Erdienter Teilbetrag bei einer beitragsorientierten Leistungszusage
- (cc) Erdienter Teilbetrag bei einer Beitragszusage mit Mindestleistung als eine Verpflichtung des Arbeitgebers
- (dd) Reine Beitragszusage
- (b) Gerechtfertigter Eingriff aufgrund von zwingenden Gründen
- (2) 2. Stufe: Schutz erdienter Dynamik
- (a) Schutzbereich der 2. Stufe
- (b) Gerechtfertigter Eingriff aufgrund von triftigen Gründen
- (3) 3. Stufe: Schutz des noch zu erdienenden Teilbetrags
- (a) Schutzbereich der 3. Stufe
- (b) Gerechtfertigter Eingriff aufgrund von sachlich-proportionalen Gründen
- (aa) Fehlentwicklungen der betrieblichen Altersversorgung als sachlich-proportionaler Grund
- (bb) Niedrigzinsphasen als weiteres Regelbeispiel der Fehlentwicklungen der betrieblichen Altersversorgung?
- dd) Anwendung des Drei-Stufen-Modells im Rahmen eines Betriebsübergangs
- (1) Entscheidung des BAG vom 22.10.2019 – 3 AZR 429/18
- (a) Hintergrund der Entscheidung
- (b) Kernaussagen des Dritten Senats
- (2) Einordnung und Bewertung des Urteils im Lichte der bisherigen Rechtsprechung des BAG und der Instanzgerichte
- (a) Einordnung des Urteils in die bisherige Rechtsprechung des BAG und der instanzlichen Rechtsprechung
- (b) Pflicht des Dritten Senats zur Vorlage an den EuGH – die richtigen Vorlagefragen
- (c) Keine Vergleichbarkeit mit sog. „Über-Kreuz-Ablösung“ von Tarifverträgen durch Betriebsvereinbarungen
- ee) Gerichtliche Überprüfbarkeit der zulässigen Ablösung – die wegwesende Dornier-Entscheidung des BAG
- (1) Grundlegender Sachverhalt
- (a) Richtige Verfahrensart, § 2a Abs. 1 Nr. 1 ArbGG
- (b) Feststellungsinteresse, § 256 ZPO
- (2) Die Dornier-Entscheidung als Instrument der Betriebspartner zur Schaffung von Rechtssicherheit
- (a) Rechtswegzuständigkeit – Beschlussverfahren gem. § 2a Abs. 1 Nr. 1 ArbGG
- (b) Feststellungsinteresse, § 256 ZPO
- ff) Ein Ausblick: Anpassungsbedarf des Drei-Stufen-Modells?
- (1) 1. Stufe: Schutz des erdienten Teilbetrags
- (2) 2. Stufe: Schutz einer erdienten Dynamik
- (3) 3. Stufe: Schutz des noch zu erdienenden Teilbetrags
- (a) Wertungswiderspruch zu § 77 Abs. 5 BetrVG?
- (b) Zu hohe Anforderungen an das Vorliegen sachlich-proportionaler Gründe – Wertungswiderspruch zum Kündigungsschutzgesetz
- (c) Unsicherheiten in der Praxis
- c. Maßstab der Ablösung von Versorgungszusagen durch Tarifverträge
- d. Maßstab der Ablösung von Versorgungszusagen für Neueintritte
- e. Maßstab der Ablösung von Versorgungszusagen für gewerkschaftliche Arbeitgeber – Änderung der Rechtsprechung
- 3. Änderung von Durchführungswegen und Leistungsplänen sowie Umstellung von Versorgungsleistungen
- a) Wahl und Änderung von Durchführungswegen
- aa) Wahl des Durchführungsweges
- bb) Änderung des Durchführungsweges
- (1) Änderung des Durchführungsweges im Allgemeinen
- (2) Änderung des Durchführungsweges im Falle der Unternehmensliquidation
- b) Umstellung von Leistungsplänen auf eine reine Beitragszusage
- aa) Bisheriger Leistungsplan auf individualvertraglicher Ebene
- bb) Bisheriger Leistungsplan auf kollektivvertraglicher Ebene
- cc) Umstellung von Versorgungsleistungen auf Kapitalleistungen
- 4. Eingriffe in laufende Versorgungsleistungen
- 5. Anpassung von Versorgungszusagen – best practice Beispiele
- a) Verringerung von Garantiezinsen
- b) Umstellung von Verrentungsleistung auf Kapitalleistung
- c) Verringerung von Dynamisierungen bereits erdienter Anwartschaften
- 6. Zusammenfassender Überblick: Vertrauensschutz über allem – unabhängig von der Art des Eingriffs
- D. Seitenblick ins Nachbarland Österreich
- I. Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung in Österreich
- II. Einseitige Änderungsmöglichkeiten durch den Arbeitgeber
- 1. Widerruf von laufenden Beitragsleistungen
- a) Anforderungen an den Widerrufsvorbehalt
- b) Anforderungen an nachhaltige, wesentliche wirtschaftliche Verschlechterung
- 2. Aussetzen und Einschränken von laufenden Beitragsleistungen
- 3. Wegfall der Geschäftsgrundlage
- III. Vergleich zu Änderungsmöglichkeiten im deutschen Betriebsrentensystem
- 1. Allgemeine Unterschiede auf formeller und materieller Ebene
- 2. Übertragbarkeit der österreichischen Regelungen zum Widerruf?
- 3. Übertragbarkeit der Änderungsmöglichkeiten durch Aussetzen und Einschränken der Zusagen für einen bestimmten Zeitraum?
- IV. Zusammenfassendes Ergebnis
- E. Möglichkeiten zur flexiblen Gestaltung von Versorgungszusagen
- I. Befristung der Beitragszeit von arbeitgeberfinanzierten Zusagen – ein Vorbild für die Zukunft?
- 1. Begrenzen der Beitragszeit auf kollektivrechtlicher Ebene
- a) Ein Blick in die Praxis
- b) Ungeklärt: Reichweite für einen Eingriff auf Grundlage einer solchen betriebsverfassungsrechtlichen Regelung
- aa) Reichweite des Vertrauensschutzes
- (1) Grundsätzliche Befristung
- (2) Mehrfachbefristung
- bb) Anwendung des Drei-Stufen-Modells?
- (1) Befristete Zusage mit automatischer Verlängerung
- (2) Befristete Zusage verbunden mit einer ausdrücklichen Erklärung der Verlängerung
- 2. Befristung der Beitragszeit auf individualrechtlicher Ebene – ein praxistaugliches Mittel?
- a) Übertragung der Maßstäbe zur Befristung von Arbeitsbedingungen auf befristete Versorgungszusagen
- aa) Maßstab der Befristung von Arbeitsbedingungen
- bb) Übertragbarkeit auf eine befristete Beitragszeit
- (1) Befristete Zusage verbunden mit einer ausdrücklichen Verhandlungspflicht zur Verlängerung
- (2) Befristete Zusage mit automatischer Verlängerung
- b) Keine Reduzierung des Vertrauensschutzes durch einen Freiwilligkeitsvorbehalt
- 3. Vorteile der Ausgestaltung einer Befristung von Beitragszusagen
- II. Leistungspläne basierend auf einer reinen Beitragszusage
- 1. Neuaufstellung eines Leistungsplans
- 2. Wechsel eines bestehenden Betriebsrentensystems auf eine reine Beitragszusage
- III. Marktorientiere Verzinsung statt Garantiezinsen
- IV. Zwischenergebnis: Nutzen und Grenzen der flexiblen Ausgestaltung
- F. Handlungsauftrag für den Gesetzgeber: Reformierungsbedarf des BetrAVG
- I. Widerrufsvorbehalt
- 1. Übersteigen des ursprünglichen Dotierungsrahmens
- 2. Wesentliche, nachhaltige wirtschaftliche Verschlechterung des Unternehmens / Teilweiser Widerruf der Zusage als Bestandteil eines Sanierungsplans
- 3. Erhebliche Treuepflichtverletzung des Mitarbeiters
- 4. Formulierungsvorschlag
- II. Befristen und Aussetzen von Beitragszeiten
- 1. Befristen von Beitragszeiten
- a) Mindestanforderung: Zeitliche Befristung und / oder Zweckbefristung
- b) Möglicher dynamisierender Baustein und Festlegung der Rechtsgrundlage
- c) Sonstige mögliche Anforderungen an eine zulässige Befristung
- 2. Aussetzen von Beitragszeiten
- III. Gesetzliche Niederlegung des Drei-Stufen-Modells in modifizierter Form und einseitiges Ablösungsrecht des Arbeitgebers auf kollektivrechtlicher Ebene
- 1. Konkretisierung der Eingriffsgründe
- 2. Einseitiges Lösungsrecht des Arbeitgebers
- IV. Zwischenergebnis: Fortsetzung des angestoßenen Reformierungsprozesses
- G. Zusammenfassung der Ergebnisse / Thesen
- Literaturverzeichnis
A. Die Betriebliche Altersversorgung – „das beste Ruhekissen“ für Beschäftigte?
„Die Rente ist sicher“ – der Ausspruch des damaligen Ministers für Arbeit und Sozialordnung, Norbert Blüm, aus dem Jahr 1986 ist zum geflügelten Wort geworden. Noch 35 Jahre später, im Bundestagswahlkampf 2021, stritten die Parteivertreter über die zukunftsfeste Ausgestaltung der staatlichen Rentensysteme. Kern der Auseinandersetzung ist stets, wie der „Generationenvertrag“ in Anbetracht des demographischen Wandels erfüllt werden kann. Die „Rente mit 67“ sei nur als ein umstrittenes Instrument genannt. Weitgehende Einigkeit besteht daneben, dass weitere Säulen neben der staatlichen Rente für eine auskömmliche Sicherung im Alter erforderlich sind. Eine elementare Säule soll die betriebliche Altersversorgung sein.
I. Interessengerechte Flexibilisierung von arbeitgeberfinanzierten Versorgungszusagen
Doch ist die betriebliche Altersversorgung – mit Norbert Blüm gefragt – „sicher“? Die FAZ meint ja und nennt diese „das beste Ruhekissen“1 für das Alter. Doch werfen die Niedrigzinsphase der vergangenen Dekade und die daraus resultierende finanzielle Gefährdung für Pensionskassen die Frage auf, ob nicht auch die betriebliche Altersversorgung anpassungsfähig sein muss – und wie Unternehmen etwa die in den 1990er-Jahren zugesagten Garantiezinsen (oft genug in Höhe von mehr als 5 %) anpassen können. Auch wenn nunmehr aufgrund der zumindest in den Vereinigten Staaten von der Federal Reserve mitgeteilten „Zinswende“ diese Phase akut beendet sein könnte, kann sich in Zeiten der Globalisierung solch ein Umstand schnell ändern.
Ebenso wie Anpassungen der staatlichen Rentensysteme stellen sich auch Veränderungen von betrieblichen Rentensystemen als enorme Herausforderung dar. Einmal zugesagte Betriebsrenten scheinen nahezu unantastbar. Zunächst aus naheliegendem Grund: Das Bestandsinteresse der betrieblich vorsorgenden Mitarbeiter2 ist wichtig und nicht zu unterschätzen. Der hohe Stellenwert dieses Bestandsinteresses und die sozialpolitische Funktion der Betriebsrente wird durch das BAG stets zum Ausdruck gebracht, indem die zumindest teilweise Sicherung des Lebensstandards im Alter durch Betriebsrenten betont wird.
Demgegenüber sehen sich Arbeitgeber – insoweit nicht anders als der Staat – der Herausforderung in einem Niedrigzinsumfeld ausgesetzt, diese Zusagen der Vergangenheit und der Zukunft zu erfüllen. Ebenso wie der Staat fortlaufend nachsteuern muss, um die gesetzliche Rente nachhaltig zu finanzieren, können auch Arbeitgeber ein anerkennenswertes Interesse an Anpassungen haben. Dies gilt umso mehr, da ein Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, eine betriebliche Altersversorgung anzubieten. Dies geschieht auf rein freiwilliger Basis.
Neben den Arbeitsvertragsparteien hat aber auch der Staat selbst ein ureigenes Interesse an betrieblichen Rentensystem. Dem Staat ist angesichts der demographischen Entwicklung daran gelegen, dass die betriebliche Altersversorgung neben der gesetzlichen Altersversorgung weiterhin eine weitere Säule zur Verbesserung des Lebensstandards im Alter bildet.
Die Gemengelage der Interessen ist komplex. Um alle Interessen unter einen Hut zu bringen, müssen Flexibilisierungsmaßnahmen im richtigen Umfang ermöglicht werden („right balance“). Trotz zahlreicher Reformen seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) zum 22.12.1974 – 36 an der Zahl – und zaghafter Versuche der Modernisierung, wie zuletzt durch das sog. Sozialpartnermodell, hat sich der Gesetzgeber nicht an die ausdrückliche Normierung von Anpassungsmöglichkeiten herangetraut. Im Wesentlichen ist es Aufgabe der Gericht geworden, Maßstäbe für die nachträgliche Anpassung bzw. Ablösung von arbeitgeberfinanzierten Versorgungszusagen aufzustellen.
Dieser Herausforderung haben sich die Gerichte gestellt und in verschiedenen Entscheidungen die Grundlagen von Ablösungsmöglichkeiten und Maßstäben hierfür herausgebildet.3 So entwickelte die Rechtsprechung die bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes aufgestellten Grundsätze des BAG stets immer weiter. Der Große Senat beschäftigte sich bereits 1956 mit der Ablösung von Versorgungszusagen und der Anwendbarkeit von ablösenden Betriebsvereinbarungen auf ehemalige Arbeitnehmer.4 1962 folgte eine Entscheidung des Ersten Senats zur Ablösbarkeit von Versorgungszusagen für aktive Mitarbeiter.5 Bereits in dieser Rechtsprechung wurde der Vertrauensschutz – unabhängig von einem Gesetz zur betrieblichen Altersversorgung als Maßstab genommen.6 Die Komplexität der im Laufe der Zeit ergangenen Entscheidungen gilt es im Rahmen einer Bestandsaufnahme zu analysieren und zu systematisieren. Mit dieser Bestandsaufnahme kann dann nicht nur die Konsistenz der gerichtlichen Entscheidungen bewertet werden, sondern auch, ob ein nachvollziehbares, stimmiges System der Ablösung von arbeitgeberfinanzierten Versorgungszusagen besteht.
II. Kernfragen und Gang der Darstellung
Diese Arbeit soll also den bestehenden Anpassungsmöglichkeiten für die betriebliche Altersversorgung auf den Grund gehen. Wie flexibel sind Arbeitgeber bei der Anpassung von Versorgungszusagen wirklich?
Hierzu wird in einem ersten Schritt herausgearbeitet, auf welchen Rechtsgrundlagen Versorgungszusagen überhaupt erteilt werden können (Kapitel B). Hierauf aufbauend werden abhängig von der jeweilige Rechtsgrundlage im zweiten Schritt die formellen sowie die materiellen Voraussetzungen zur Anpassung von Versorgungszusagen aus Gesetz und Rechtsprechung analysiert und systematisiert (Kapitel C). Die formellen Voraussetzungen behandeln die notwendige Bedingung, welche Ablösungsmechanismen von Versorgungszusagen es grundsätzlich für die jeweilige Rechtsgrundlage gibt. Demgegenüber stellen die materiellen Voraussetzungen die hinreichende Bedingung der Anpassung von Versorgungszusagen dar. Am Ende des Kapitels erfolgt einen Ebenenvergleich zwischen den verschiedenen Rechtsgrundlagen und den Anforderungen der Rechtsprechung zur jeweiligen Ablösung.
Neben dem status quo im deutschen Recht soll im weitergehenden Schritt (Kapitel D) ein Seitenblick nach Österreich, wo ein ähnlichen Grundüberlegungen folgendes Betriebsrentensystem wie in Deutschland existiert, aufzeigen, wie dort eine flexible Anpassung von Versorgungszusagen ermöglicht wird und wie dies gegebenenfalls auf das deutsche Betriebsrentensystem übertragen werden kann.
Auf dieser Grundlage zeigt die Arbeit auf, wie Arbeitgeber den durch den gesetzlichen Rahmen und die Rechtsprechung bestimmten Gestaltungsspielraum für eine flexible Ausgestaltung von Versorgungszusagen nutzen können und welche konkreten Flexibilisierungsinstrumente hierfür zur Verfügung stehen (Kapitel F). Dies führt zu der abschließenden Frage, ob diese Flexibilisierungsinstrumente bereits für eine interessengerechte Flexibilisierung ausreichen oder ob nicht doch ein Handlungsbedarf des Gesetzgebers zur Reformierung besteht und wie ein solcher aussehen könnte (Kapitel G).
1 Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): „Betriebsrente und Pension sind die besten Ruhekissen“ vom 8.3.2022.
2 Nachfolgend wir ausschließlich zur besseren Lesbarkeit für Arbeitnehmer:innen und Mitarbeiter:innen wird die Form Arbeitnehmer bzw. Mitarbeiter verwendet.
3 Vgl. nur BAG v. 19.3.2019 – 3 AZR 201/17, NZA 2020, 1031; BAG v. 10.9.2002 – 3 AZR 635/01, BB 2003, 2749; BAG v. 17.4.1985 – 3 AZR 72/83, BAGE 49, 57; BAG v. 8.12.1981 – 3 AZR 518/80, NJW 1982, 1773; BAG v. 24.11.1977 – 3 AZR 732/76, BAGE 29, 379; BAG v. 10.3.1972 – 3 AZR 278/71, BAGE 24, 177; BVerfG v. 14.1.1987 – 1 BvR 1052/79, BVerfGE 74, 129; BVerfG v. 19.10.1983 – 2 BvR 298/81, BVerfGE 65, 196.
4 BAG v. 16.3.1956 – GS 1/55, BAGE 3, 1.
5 BAG v. 26.10.1962 – 1 AZR 8/61, AP Nr. 87 § 242 BGB Ruhegehalt.
6 BAG v. 26.10.1962 – 1 AZR 8/61, AP Nr. 87 § 242 BGB Ruhegehalt.
B. Allgemeine Grundlagen von Versorgungszusagen
Grundlegende Voraussetzung für eine betriebliche Altersversorgung im Sinne des BetrAVG ist die Zusage des Arbeitgebers aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses (§ 1 Abs. 1 BetrAVG). Dies eröffnet dem Arbeitgeber verschiedene Möglichkeiten, auf individual- oder kollektivvertraglicher Ebene eine Versorgungszusage zu regeln. Je nach Wahl der Rechtsgrundlage unterscheidet sich der Gestaltungsspielraum hinsichtlich einer späteren Ablösbarkeit der Zusage. Insoweit ist ein genauerer Blick auf den Rechtsbegründungsakt erforderlich.
I. Rechtsgrundlage zur Begründung von Versorgungszusagen
Versorgungszusagen können ausdrücklich oder konkludent vereinbart werden. Dies kann auf individualvertraglicher – als reine Individualzusage ohne kollektiven Bezug oder Gesamtzusage – sowie auf kollektivvertraglicher Ebene folgen.
1. Einzelzusage
Als Bestandteil des Arbeitsvertrages gelten für das Zustandekommen der Einzelzusage die allgemeinen Regeln von Angebot und Annahme nach den §§ 145 ff. BGB.7 Eine rechtsverbindliche Vereinbarung entsteht aber nicht durch ein unverbindliches Inaussichtstellen einer Versorgungszusage. Der Rechtsbindungswille des Arbeitgebers muss erkennbar sein.8 Hierbei muss der Arbeitgeber nicht zwingend das Angebot in seinen Einzelheiten konkret ausfüllen, es reicht bereits eine sogenannte Blankettzusage aus.9 Die Einzelheiten kann der Arbeitgeber nach billigem Ermessen gem. § 315 Abs. 1 BGB bestimmen.
Wird auf einen Kollektivvertrag im Arbeitsvertrag Bezug genommen, kann die Klausel dynamisch formuliert werden.10 Ob eine Klausel statisch oder dynamisch ist, muss durch Auslegung gem. §§ 133, 157 BGB ermittelt werden. Das BAG geht in seiner Rechtsprechung davon aus, dass solche Bezugnahmeklauseln in der Regel einheitlich auszulegen seien, da der Arbeitgeber „im Zweifel“ die betriebliche Altersversorgung einheitlich erbringen wolle.11 Durch eine Jeweiligkeitsklausel können sich Änderungen der Versorgungsordnung durch nachfolgende Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge auf das Ruheverhältnis auswirken.12 Dadurch wird eine Versteinerung der Regelung zur Versorgungzusage im Arbeitsvertrag vermieden.
2. Gesamtzusage und betriebliche Einheitsregelung
Anstelle von individuellen Einzelvereinbarungen kann der Arbeitgeber auch für ganze Arbeitnehmergruppen im Wege von betrieblichen Einheitsregelungen oder von Gesamtzusagen die betriebliche Altersvorsorge regeln.
Die Gesamtzusage ist die an alle Arbeitnehmer oder einen nach abstrakten Merkmalen bestimmten Teil von ihnen in allgemeiner Form gerichtete ausdrückliche Erklärung des Arbeitgebers, zusätzliche Leistungen erbringen zu wollen.13 Der Arbeitgeber muss aber seinen Willen nach außen hin kenntlich machen. Der einzelne Arbeitnehmer muss typischer Weise in der Lage sein, von dem Angebot des Arbeitgebers Kenntnis zu nehmen, wobei es für die Wirksamkeit der Gesamtzusage nicht auf die konkrete Kenntnisnahme ankommt.14 Eine ausdrückliche Annahme des Arbeitnehmers ist nicht erforderlich. Nach der Verkehrssitte ist eine solche ausdrückliche Annahme des Antrags nicht zu erwarten, § 151 BGB.15 Die Gesamtzusage wird Bestandteil des Arbeitsvertrages.16 Sie gilt aber nicht nur für die Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt der erstmaligen Bekanntgabe der Zusage im Betrieb tätig waren, sondern auch für diejenigen, die später in dem Betrieb beschäftigt worden sind.17
Bei einer betrieblichen Einheitsregelung sind die Regelungen zur Versorgungszusage für alle Arbeitnehmer oder für eine Gruppe von Arbeitnehmern ebenfalls gleich. Sie sind nicht individuell ausgehandelt. Im Unterschied zu einer Gesamtzusage wird aber das Angebot des Arbeitgebers von den Arbeitnehmern ausdrücklich angenommen.18 Das heißt, dass jeder einzelne Arbeitnehmer ein individuelles Versorgungsdokument mit gleichlautender Regelung erhält.
Auch wenn die Rechtsnatur von Ansprüchen aus Gesamtzusagen und betrieblichen Einheitsregelungen aus dem Individualvertrag des Arbeitnehmers erwachsen, so muss bei dem Inhalt der Gesamtzusage oder der betrieblichen Einheitsregelung der kollektive Charakter berücksichtigt werden. Die Verteilung der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Mittel für die betriebliche Altersvorsorge ist nur mit Blick auf das Kollektiv verständlich. Daher handelt es sich bei Gesamtzusagen und betrieblichen Einheitsregelungen um individualvertragliche Versorgungszusagen mit kollektivem Bezug.19 Aufgrund des kollektiven Bezugs müssen die betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmungsrechte gem. § 87 Abs. 1 Nr. 8, 10 BetrVG beachtet werden.
3. Betriebliche Übung
Die Versorgungszusagen können auch in der Gestalt der betrieblichen Übung in Betrieben verbindlich werden. Dies hat der Gesetzgeber zudem ausdrücklich im Gesetz in § 1b Abs. 1 Nr. 4 BetrAVG geregelt. Nach der ständigen Rechtsprechung des BAG ist eine betriebliche Übung dann anzunehmen, wenn ein gleichförmiges und wiederholtes Verhalten des Arbeitgebers vorliegt, das den Inhalt der Arbeitsverhältnisse gestaltet und geeignet ist, vertragliche Ansprüche auf eine Leistung zu begründen. Der Arbeitnehmer muss aus dem Verhalten des Arbeitgebers schließen können, dass ein Verpflichtungswille zur künftigen Leistung besteht.20 Eine betriebliche Übung kommt aber nach vorherrschender Meinung nur in Betracht, wenn andere Anspruchsgrundlagen ausscheiden.21
Durch betriebliche Übung können auch Ansprüche hinsichtlich Berechnungsarten einer Betriebsrente entstehen. Allerdings gilt dies in der Regel nicht für fehlerhafte Berechnungen des Arbeitgebers, wenn der Arbeitgeber im Rahmen der Berechnungen auf bestimmte Berechnungsvorschriften verweist und sich aus diesen etwas anderes ergibt.22
Details
- Pages
- 230
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631910443
- ISBN (ePUB)
- 9783631910450
- ISBN (Hardcover)
- 9783631910436
- DOI
- 10.3726/b21310
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (May)
- Keywords
- Betriebliche Altersversorgung Arbeitsrecht BetrAVG 3-Stufen-Modell betriebliche Rentensysteme
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 230 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG