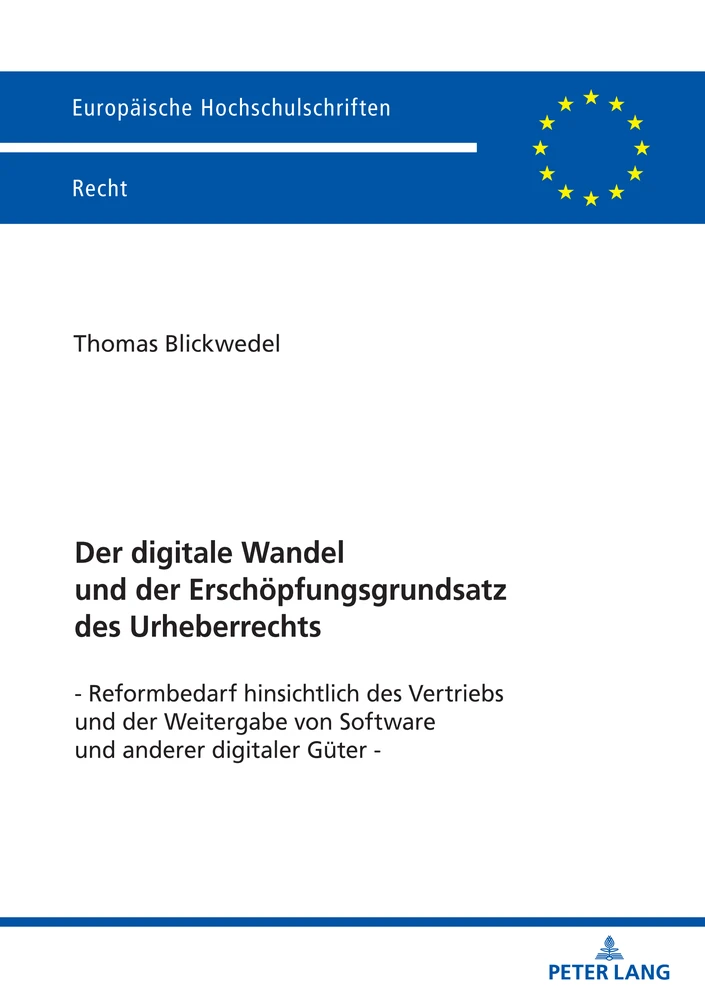Der digitale Wandel und der Erschöpfungsgrundsatz des Urheberrechts
Reformbedarf hinsichtlich des Vertriebs und der Weitergabe von Software und anderer digitaler Güter
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einführung
- A. Einleitung, Problemstellung und Überblick
- I. Die Digitalisierung als allgegenwärtiges Phänomen
- II. Die Zielsetzung eines digitalen Binnenmarkts
- III. Der Geltungsanspruch des Erschöpfungsgrundsatzes im digitalen Zeitalter
- IV. Die Rechtsprechung des EuGH
- B. Wissenschaftliche Fragestellung
- C. Gang der Darstellung
- 2. Urheberrecht, Digitalisierung und der Erschöpfungsgrundsatz
- § 1 Das Urheberrecht im Kontext der Digitalisierung
- I. Das Urheberrecht als zeitlich begrenztes Monopol
- 1. Verfassungsrechtliche Vorgaben bezüglich der Ausgestaltung der Immaterialgüterrechtsordnung sowie derer Schranken
- 2. Funktionen des Urheberrechts
- a) Vermögensrechtlicher Schutz
- b) Persönlichkeitsrechtlicher Schutz
- 3. Entstehung des urheberrechtlichen Schutzes
- 4. Schutzrechte: Gestaltungsmöglichkeiten, Grenzen und Durchsetzung
- a) Die Einräumung von Nutzungsrechten und die „Lizenz“
- b) Zwangslizenzen
- c) „Creative Commons-Lizenzen“
- d) Verbotstatbestände
- e) Vergütungspflichten
- f) Digital Rights Management
- 4. Zwischenergebnis
- II. Darstellung des zugrundeliegenden Interessenkonflikts
- 1. Interesse des Werkschaffenden an bestmöglicher wirtschaftlicher Verwertbarkeit
- 2. Allgemeines volkswirtschaftliches Interesse an größtmöglicher Zirkulation intellektueller Ressourcen
- III. Digitalisierungsbedingte Veränderung des Urheberrechts
- 1. Begriffsdefinition Digitalisierung
- a) Digitalisierung von Informationen
- b) Digitalisierungsbedingte Veränderungen der Kommunikation
- c) Einflüsse der Plattformökonomie
- 2. Digitalisierungsbedingte Auswirkungen auf das Urheberrecht
- a) Das Mooreʼsche Gesetz als Transformationstreiber des digitalen Wandels
- b) Zunehmende Entkopplung des Werkes vom Trägermedium
- 3. Neue Darstellungs- und Verwertungsformen
- a) Ausgangspunkt
- b) Ausgewählte Darstellungs- und Verwertungsformen
- aa) Streaming
- bb) Non-Fungible Token
- (1) Aktueller Anlass
- (2) Funktionsweise
- (3) Konsequenzen für das Urheberrecht
- 4. Schlussfolgerungen für die Regulierung digitaler Werkexemplare
- a) Erschwerte Kontrolle der Zirkulation des Werkes
- b) Eingeschränkte Tauglichkeit nationaler Steuerungsinstrumente
- § 2 Der urheberrechtliche Erschöpfungsgrundsatz als praktische Konkordanz der Interessen
- I. Grundsätzliches Verbreitungsrecht des Urhebers (§§ 69c Nr. 3, 17 Abs. 1 UrhG)
- 1. Begriffsdefinition Verbreitung
- 2. Zielsetzungen des Verbreitungsrechts
- II. Urheberrechtliche Erschöpfung als Schranke des Verbreitungsrechts
- 1. Rechtsgrundlagen
- a) Europäisches Recht
- aa) Art. 4 Abs. 2 RL 2009/24/EG
- (1) Ausgangspunkt
- (2) Zentrale Erwägungsgründe
- (3) Definitionen und Schutzgegenstand
- (4) Regelung des Erschöpfungsgrundsatzes
- (5) Keine zustimmungspflichtige Vervielfältigung durch Laden und Ablaufen des Computerprogramms
- bb) Urheberrechtsrichtlinie
- cc) Datenbank-Richtlinie
- dd) Zwischenergebnis
- b) Nationales Recht
- c) Rechtsvergleichende Schlussfolgerungen
- aa) Dienstleistungsbezogene gegenüber festlegungsbezogener Anknüpfung
- bb) Gebot zur unionskonformen Auslegung des europäischen Sekundärrechts sowie des nationalen Rechts
- 2. Gesetzgeberisches Anliegen des Erschöpfungsgrundsatzes
- a) Dogmatischer Ausgangspunkt des Erschöpfungsgrundsatzes
- b) Monistische Ausgestaltung des geltenden deutschen Urheberrechts
- c) Ausgewählte Ansätze der dogmatischen Begründung des Erschöpfungsgrundsatzes
- aa) Eigentumstheorie
- bb) Verkehrssicherungstheorie
- cc) Erhalt der Funktionsfähigkeit und Offenheit des Markts
- (1) Erschöpfung als Zäsur zwischen Qualitätswettbewerb und Preiswettbewerb
- (2) Keine Preiskonkurrenz durch die eigene Marktleistung
- dd) Belohnungstheorie
- d) Diskussion und Stellungnahme
- 3. Sachlicher Anwendungsbereich des Erschöpfungsgrundsatzes
- a) Abhängigkeit des Erschöpfungsgrundsatzes von der Werkfassung
- aa) Problemstellung
- bb) Erste Analyse
- cc) Zwischenergebnis
- b) In einem Gegenstand verkörperte Werke
- c) Digitale Werke
- aa) Computerprogramme als digitales Werk
- bb) E-Books als digitales Werk
- (1) E-Books gegenüber gedruckten Büchern
- (2) Die Tom Kabinet-Entscheidung vom 19.12.2019
- (a) Der Zugang zu E-Books als Anwendungsfall der öffentlichen Zugänglichmachung
- (b) Abkehr von der UsedSoft-Entscheidung
- (c) Fortentwicklung der instanzgerichtlichen Rechtsprechung
- (d) Zwischenergebnis
- cc) Abgrenzung zum nicht-erschöpfbaren Vervielfältigungsrecht
- (1) Vervielfältigungen beim Werkgenuss digitaler Güter am Beispiel des Computerprogramms
- (2) Festplatteninstallation und Laden in Arbeitsspeicher als Vervielfältigung i.S.d. §§ 69c Nr. 1, 16 UrhG und die diesbezügliche Bedeutung der Regelung des § 69d UrhG
- (3) Bildschirmsichtbarkeit keine Vervielfältigungshandlung
- 4. Gegenstand des Erschöpfungsgrundsatzes
- a) Inverkehrbringen eines Werkexemplars als Anknüpfungspunkt
- aa) Inverkehrbringen bei körperlichen Werkexemplaren
- bb) Inverkehrbringen bei digitalen Werkexemplaren
- b) Nichtzustimmungsbedürftige Handlungen im Kreis der bestimmungsgemäßen Nutzung
- aa) Die Ergänzung und Absicherung des Erschöpfungsgrundsatzes
- bb) Subjektives gegenüber objektiv-funktionalem Begriffsverständnis
- cc) Schlussfolgerungen für den Umfang der bestimmungsgemäßen Nutzung
- c) Erlöschen des Verbreitungsrechts als Rechtsfolge
- d) Die Online-Erschöpfung: Abstrakte Betrachtung als Grundlage der weiteren Bewertung der Rechtsprechung des EuGH
- aa) Problemstellung
- bb) Meinungsstand vor Ergehen der UsedSoft Entscheidung: Die verschiedenen Ansätze
- (1) Restriktive Auslegung des § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG
- (2) Analoge Anwendung des § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG
- (3) Direkte Anwendung des § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG
- cc) Erste Bewertung der vorgetragenen Argumente
- dd) Zwischenergebnis
- 3. Die Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes auf Software und andere digitale Güter
- § 3 Der urheberrechtliche Erschöpfungsgrundsatz im Handel mit gebrauchter Software im Besonderen
- I. Ausgangspunkt nach Ergehen der UsedSoft- und der Tom Kabinet-Rechtsprechung
- 1. Begriffsdefinition Computerprogramm beziehungsweise Software
- 2. Digitale Güter gegenüber digitalen Diensten
- a) Allgemeine Definition
- b) Anpassung der tradierten urheberrechtlichen Kategorien an den digitalen Wandel: Erste Überlegungen zu einer neuen Differenzierung
- c) Rückfall auf tradierte Abgrenzungserwägungen bei unzutreffender entstehungsgeschichtlicher Betrachtung
- 3. Software gegenüber anderen digitalen Gütern
- II. Software: Grundlagen
- 1. Software als Sache i.S.d. § 90 BGB: Validität der Differenzierung zwischen verkörperten und digitalen Werken im deutschen Zivilrecht
- 2. Softwareüberlassung und der Begriff der „Lizenz“
- III. Urheberrechtliche Zulässigkeit des Handels mit gebrauchter Software
- 1. Gebrauchte Software als Handelsgegenstand
- a) Abnutzbarkeit von Software
- b) Modalitäten der Weiterveräußerung
- aa) Grundlagen: Virtualisierung
- bb) Weiterveräußerung auf körperlichen Datenträgern gegenüber Weiterveräußerung von virtuellen Vervielfältigungsstücken
- cc) Vorinstallation auf Hardware
- dd) Aufspaltung der Nutzeranzahlberechtigung generell
- ee) Aufspaltung von „Mehrplatzlizenzen“ beziehungsweise „Client-Server-Lizenzen“ und „Volumenlizenzen“
- (1) Wirtschaftliche Interessenlage
- (2) „Einzelplatzlizenz“
- (3) „Volumenlizenz“ gegenüber „Mehrplatzlizenz“ beziehungsweise „Client-Server-Lizenz“
- (4) Betrachtung unter dem Gesichtspunkt der Belohnungstheorie
- (5) Erwägungen für die urheberrechtliche Zulässigkeit einer „Lizenzaufspaltung“
- (6) Die „Lizenzaufspaltung“ in der Rechtsprechung
- (a) Die UsedSoft-Rechtsprechung des EuGH
- (b) Die Rechtsprechung des OLG Frankfurt am Main
- (c) Die Rechtsprechung des LG Hamburg
- (d) Die UsedSoft-Rechtsprechung des BGH
- (7) Stellungnahme
- ff) Weiterveräußerung unter Weitergabe von Echtheitszertifikaten
- gg) Zwischenergebnis
- 2. Urheberrechtliche Zulässigkeit der Weiterveräußerung unkörperlicher Werkexemplare
- a) Die Sichtweise vor der UsedSoft-Entscheidung des EuGH
- b) Die UsedSoft-Rechtsprechung des EuGH als Ausgangspunkt einer neuen Sichtweise: Darstellung der wesentlichen Entscheidungsinhalte
- aa) Überblick und erste Einordnung
- bb) Erschöpfungsvoraussetzungen
- (1) Maßstab
- (2) Entgeltlichkeit des Ersterwerbs
- (3) Einheitlichkeit von Download und „Lizenzerwerb“
- (4) Freiwillige und dauerhafte Aufgabe der Verfügungsgewalt
- (5) Löschung/Unbrauchbarmachung der eigenen Programmkopie im Zeitpunkt des Zweiterwerbs
- c) Schlussfolgerungen aus der UsedSoft-Rechtsprechung
- aa) Unmaßgeblichkeit der Vertriebsmodalitäten
- bb) Rechtsfortbildungsauftrag des EuGH
- cc) Maßgeblichkeit der Erlangung der Verfügungsgewalt
- dd) Vollständige Entlassung aus der Herrschaftssphäre des Rechtsinhabers
- ee) Entscheidungsoffenheit der UsedSoft-Entscheidung für weitere digitale Güter und Begrenzung durch die Tom Kabinet-Entscheidung
- ff) Dogmatische Schwächen der UsedSoft-Entscheidung
- (1) Unzureichende Überprüfung der dogmatischen Begründungsansätze hinsichtlich des Erschöpfungseintritts
- (2) Überprüfung dogmatischer Begründungsansätze im digitalen Umfeld
- (a) Ausgangspunkt
- (b) Überprüfung der dogmatischen Begründungsansätze im Einzelnen
- (aa) Überprüfung der Verkehrssicherungstheorie
- (bb) Überprüfung der Belohnungstheorie
- (c) Zwischenergebnis
- § 4 Anwendbarkeit des urheberrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes auf andere digitale Güter
- I. Die Tom Kabinet-Entscheidung des EuGH als Richtungsgeber?
- II. Der universelle Geltungsanspruch des Erschöpfungsgrundsatzes im digitalen Umfeld
- 1. Verändertes Kräfteverhältnis zwischen Urhebern und Nutzern
- 2. Höhere Profitabilität des Online-Vertriebs
- 3. Nachverfolgbarkeit des Nutzerverhaltens als zusätzliche Einnahmequelle
- 4. Preisgabe von Anonymität und Transparenz
- 5. Das Urheberrecht als die „Magna Charta der Informationsgesellschaft“
- III. Auflösung des Konflikts
- 1. Rechtsfortbildungsauftrag des EuGH
- 2. Rechtsfortentwicklungspflicht des Gesetzgebers
- 3. Für die Rechtsfortbildung maßgebliche Kriterien
- a) Unterbindung veränderten Kräfteverhältnisses
- b) Wirklichkeitsgetreue Abbildung der digitalen Realität
- IV. Anpassung des Erschöpfungsgrundsatzes an die Besonderheiten des digitalen Zeitalters
- 1. Ware gegenüber Dienstleistung
- 2. Maßgeblichkeit wirtschaftlich-funktionaler Äquivalenz
- 3. Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes auf andere digitale Güter
- a) Werkübergreifende Erwägungen
- aa) Funktion von Computerprogrammen
- bb) Warenverkehrsfreiheit digitaler Güter
- cc) Kriterium des endgültigen und dauerhaften Erwerbs
- b) Werkspezifische Erwägungen
- aa) Die Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes bei hybriden Werken im Allgemeinen
- (1) Problemstellung
- (2) Analyse
- (3) Zwischenergebnis
- bb) Die Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes bei Computerspielen angesichts spezieller Vertriebsmodelle im Besonderen
- (1) Problemstellung
- (2) Analyse
- (3) Zwischenergebnis und Konsequenz
- cc) Die Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes bei Musikwerken
- dd) Die Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes bei Filmwerken
- ee) Die Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes bei Non-Fungible Token
- (1) Problemstellung
- (2) Analyse
- (3) Zwischenergebnis
- V. Zusammenfassendes Zwischenergebnis
- § 5 Reform der Kodifikation des Erschöpfungsgrundsatzes
- I. Regulierungsbedürfnis
- II. Regulierungsansatz
- 1. Europäisches Recht
- 2. Nationales Recht der Bundesrepublik Deutschland
- 3. Zwischenergebnis
- III. Eigener Regelungsvorschlag zu einer dem digitalen Wandel Rechnung tragenden Ausgestaltung des Erschöpfungsgrundsatzes
- 1. Bestimmende Faktoren des Regelungsvorschlages
- 2. Konkretisierung des Regelungsvorschlages
- a) Digitales Verbreitungsrecht
- aa) Gesetzesformulierung
- bb) Gesetzeskommentierung
- b) Erschöpfung des Verbreitungsrechts
- aa) Gesetzesformulierung
- bb) Gesetzeskommentierung
- c) Ausnahmen von den zustimmungsbedürftigen Handlungen
- aa) Gesetzesformulierung
- bb) Gesetzeskommentierung
- 4. Schlussteil
- § 6 Thesenförmige Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a.A. |
anderer Ansicht |
a.a.O. |
am angegebenen Ort |
ABl. |
Amtsblatt |
Abs. |
Absatz |
Abschn. |
Abschnitt |
a.E. |
am Ende |
AEUV |
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
a.F. |
alte Fassung |
AfP |
Zeitschrift für das gesamte Medienrecht: Archiv für Presserecht |
Alt. |
Alternative |
Anm. |
Anmerkung |
APR |
Allgemeines Persönlichkeitsrecht |
Art. |
Artikel |
ASP |
Application Service Providing |
Aufl. |
Auflage |
Az. |
Aktenzeichen |
BB |
Betriebs-Berater (Zeitschrift) |
Bd. |
Band |
Begr. |
Begründer |
BGB |
Bürgerliches Gesetzbuch |
BGBl. |
Bundesgesetzblatt |
BGH |
Bundesgerichtshof |
BGHZ |
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen |
BT-Drucks. |
Bundestagsdrucksache |
BVerfG |
Bundesverfassungsgericht |
BVerfGE |
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts |
bzw. |
beziehungsweise |
CB |
Compliance-Berater (Zeitschrift) |
CoA |
Certificate of Authenticity |
CR |
Computer und Recht (Zeitschrift) |
ders. |
derselbe |
d.h. |
das heißt |
dies. |
dieselbe |
|
Diss. |
Dissertationsschrift |
DRM |
Digital Rights Management |
DuD |
Datenschutz und Datensicherheit (Zeitschrift) |
EG |
Europäische Gemeinschaft |
EGRC |
Charta der Grundrechte der Europäischen Union |
Einl. |
Einleitung |
endg. |
endgültig |
etc. |
et cetera |
EU |
Europäische Union |
EuGH |
Europäischer Gerichtshof |
EuR |
Europarecht (Zeitschrift) |
EUV |
Vertrag über die Europäische Union in der Fassung des Vertrages von Lissabon |
EuZW |
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht |
EWG |
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft |
f. |
für |
f.; ff. |
folgend(e) |
Fn. |
Fußnote |
FS |
Festschrift |
GEKR-E |
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht |
gem. |
gemäß |
GG |
Grundgesetz |
ggf. |
gegebenenfalls |
GRUR |
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift) |
GRUR Int |
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International (Zeitschrift) |
GVBl. |
Gesetzes- und Verordnungsblatt |
Hrsg. |
Herausgeber |
hrsg. |
herausgegeben |
Hs. |
Halbsatz |
insb. |
insbesondere |
IPRB |
IP-Rechtsberater (Zeitschrift) |
i.S.d. |
im Sinne der/im Sinne des |
IT |
Informationstechnologie |
ITRB |
IT-Rechtsberater (Zeitschrift) |
jurisPR-ITR |
juris PraxisReport IT-Recht |
|
jurisPR-WettbR |
juris PraxisReport Wettbewerbsrecht |
Kap. |
Kapitel |
KG |
Kammergericht |
KOM |
Kommission |
K&R |
Kommunikation & Recht (Zeitschrift) |
KI |
Künstliche Intelligenz |
KSzW |
Kölner Schrift zum Wirtschaftsrecht (Zeitschrift) |
LG |
Landgericht |
lit. |
litera |
MarkenG |
Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen |
MMR |
Multimedia und Recht (Zeitschrift) |
MR-Int |
Medien und Recht International (Zeitschrift) |
m. |
mit |
m.w.N. |
mit weiteren Nachweisen |
n.F. |
neue Fassung |
NFT |
Non-Fungible Token |
NJW |
Neue Juristische Wochenschrift |
Nr. |
Nummer |
OEM |
Original Equipment Manufacturer |
OLG |
Oberlandesgericht |
PatG |
Details
- Pages
- 234
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631919293
- ISBN (ePUB)
- 9783631919309
- ISBN (Softcover)
- 9783631903599
- DOI
- 10.3726/b21854
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (May)
- Keywords
- RL (EU) 2019/770 Urheberrecht im Kontext der Digitalisierung Digitalisierung Softwarevertrieb Gebrauchtsoftware Volumenlizenz Non-Fungible Token NFT E-Books UsedSoft Tom Kabinet
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 234 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG