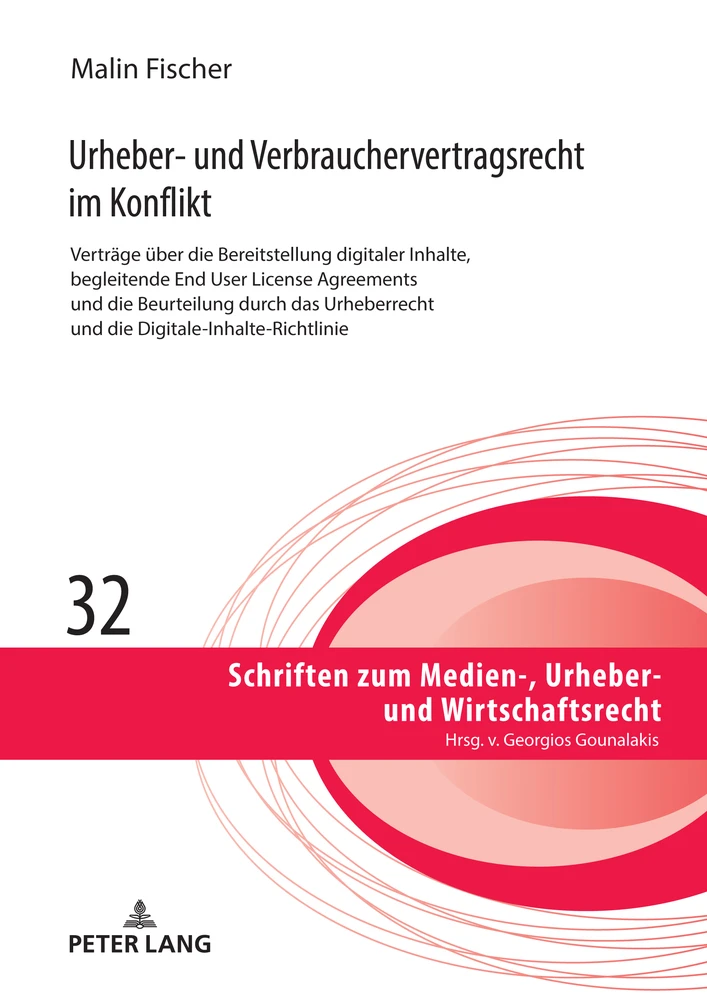Urheber- und Verbrauchervertragsrecht im Konflikt
Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte, begleitende End User License Agreements und die Beurteilung durch das Urheberrecht und die Digitale-Inhalte-Richtlinie
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Literaturverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Problemaufriss
- I. Ein einheitliches Verbrauchervertragsrecht für Verträge über digitale Inhalte: Die Digitale-Inhalte-Richtlinie
- II. Berührungspunkte mit dem Urheberrecht auf dem Gebiet der Verträge über digitale Inhalte
- B. Gang der Untersuchung
- Teil 1: Grundlagen – Begriff der digitalen Inhalte und maßgebliche Akteur:innen
- A. Definition und Merkmale digitaler Inhalte
- I. Definition digitaler Inhalte nach dem Verbrauchervertragsrecht
- 1. Gesetzliche Definitionen
- 2. Kritik an den Definitionen
- 3. Aus den Definitionen abzuleitende Merkmale digitaler Inhalte
- II. Informationsebenen digitaler Inhalte
- 1. Syntaktische bzw. Code-Ebene
- 2. Semantische Ebene
- 3. Strukturelle Ebene
- 4. An den Informationsebenen beteiligte Regelungsregime
- 5. Zwischenfazit
- III. Ökonomische Besonderheiten digitaler Inhalte
- 1. Keine Rivalität in der Nutzung
- 2. Fehlende Abnutzung
- 3. Kostengünstige Reproduktion
- 4. Auswirkungen auf die rechtliche Behandlung
- IV. Urheberrechtlicher Schutz digitaler Inhalte
- 1. Schutz von Software
- 2. Schutz sonstiger digitaler Inhalte am Beispiel von E-Books
- 3. Schutz komplexer digitaler Inhalte am Beispiel von Computerspielen
- 4. Zwischenfazit
- B. Maßgebliche Akteur:innen
- I. Verbraucher:in/(Werk- bzw. End-)Nutzer:in
- II. Unternehmer:in/Anbieter:in digitaler Inhalte
- III. Urheberrechtliche Rechteinhaber:in
- Teil 2: Verhältnis von Urheber- und Verbrauchervertragsrecht auf dem Gebiet der Verträge über digitale Inhalte
- A. Zielrichtungen des Urheber- und Verbrauchervertragsrechts und daraus resultierendes Spannungsverhältnis im digitalen Umfeld
- I. Schutz der Urheber:in als Aufgabe des Urheberrechts
- 1. Grundsätzliche Verwertungs- und Kontrollmöglichkeiten der Urheber:in mittels ausschließlicher Verwertungsrechte
- 2. Ausweitung der Verwertungs- und Kontrollmöglichkeiten im digitalen Umfeld
- a) Erweiterung der Verwertungsrechte
- b) Umfassende urheberrechtliche Relevanz der digitalen Werknutzung
- aa) Relevanz der unterschiedlichen Phasen der digitalen Werknutzung
- bb) Urheberrechtliche Schranken für den Erwerb und die Nutzung digitaler Inhalte
- (1) Vorübergehende Vervielfältigungshandlungen, § 44a Nr. 2 UrhG
- (2) Vervielfältigungen zum privaten Gebrauch, § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG
- (3) Bestimmungsgemäße Nutzung von Computerprogrammen, § 69d Abs. 1 UrhG
- (4) Anfertigung von Sicherungskopien von Computerprogrammen, § 69d Abs. 2 S. 1 UrhG
- c) Beschränkung des Zugangs zu und der Nutzung von digitalen Inhalten mittels EULAs
- aa) Überblick
- bb) Rechtsnatur von EULAs
- cc) Zulässigkeit der vertraglichen Abbedingung urheberrechtlicher Schranken in EULAs
- (1) Meinungsstand
- (2) Streitentscheid
- (3) Zwischenergebnis
- dd) Zusammenfassung
- d) Möglichkeit technischer Schutzmaßnahmen
- 3. Keine explizite Berücksichtigung von Verbraucher:innen im (europäischen) Urheberrecht
- 4. Zwischenfazit
- II. Schutz der wirtschaftlichen Selbstbestimmung von Verbraucher:innen als Aufgabe des Verbrauchervertragsrechts
- 1. Generelle Legitimation verbraucherschützender Vorschriften
- a) Soziale Verbraucherschutzmodelle
- b) Das streng marktorientierte Informationsmodell
- 2. Begründung verbraucherschützender Vorschriften in der EU – Förderung des EU-Binnenmarktes
- a) Strategie für einen digitalen Binnenmarkt
- b) Die DI-RL als Teil der Strategie
- 3. Zwischenfazit
- III. Resultierendes Spannungsverhältnis der beiden Rechtsgebiete
- 1. Kriterium der vernünftigen Verbrauchererwartung im (EU-)Verbrauchervertragsrecht
- 2. Konflikt mit dem Urheberrecht
- IV. Zusammenfassung
- B. Verhältnis von Urheberrecht und DI-RL bei der Beurteilung von Nutzungsbeschränkungen in EULAs
- I. Möglichkeit der Überprüfung von Nutzungsbeschränkungen in EULAs in der Vertragsbeziehung von Verbraucher:in und Unternehmer:in durch die DI-RL
- 1. Art. 3 Abs. 9 DI-RL: Keine Beeinträchtigung des Urheberrechts durch die Vorgaben der DI-RL
- 2. Vertragsmäßigkeit urheberrechtlicher Lizenzbedingungen in der Vertragsbeziehung von Verbraucher:in und Unternehmer:in, Art. 10 DI-RL
- II. Ausgangspunkt: Subjektive und objektive Vertragsmäßigkeit, Art. 7 und 8 DI-RL
- 1. Gleichwertigkeit von subjektiver und objektiver Vertragsmäßigkeit
- 2. Subjektive Vertragsmäßigkeit, Art. 7 DI-RL
- 3. Objektive Vertragsmäßigkeit, Art. 8 DI-RL
- III. Kriterium der vernünftigen Verbrauchererwartung gem. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b DI-RL
- 1. Berücksichtigung urheberrechtlicher Wertungen bei der Beurteilung der vernünftigen Verbrauchererwartung
- 2. Bestimmung der vernünftigen Verbrauchererwartung anhand vertragsrechtlicher Leitbilder
- a) Fehlende vertragstypologische Einordnung durch die DI-RL
- b) Unterscheidung zwischen dauerhafter und vorübergehender Bereitstellung
- aa) Kaufähnliche Vertragskonstellationen
- bb) Mietähnliche Vertragskonstellationen
- c) Zwischenfazit
- IV. Beurteilung von Nutzungsbeschränkungen in EULAs in der Beziehung von Verbraucher:in und Rechteinhaber:in anhand urheberrechtlicher Wertungen
- V. Urheberrechtliche Zulässigkeit und objektive Vertragsmäßigkeit von Nutzungsbeschränkungen in EULAs
- 1. Beschränkung der Weiterveräußerung digitaler Inhalte
- a) Urheberrechtliche Wertungen
- aa) Der Erschöpfungsgrundsatz bei analogen Werkexemplaren
- bb) Der Erschöpfungsgrundsatz bei digitalen Inhalten
- (1) Erschöpfung aufgrund des Downloads eines Computerprogramms – EuGH: „UsedSoft“
- (2) Keine Erschöpfung aufgrund des Downloads eines E-Books – EuGH: „Tom Kabinet“
- (a) Meinungsstand vor der Entscheidung des EuGHs
- (b) Entscheidung des EuGHs
- (3) Beurteilung der EuGH-Rechtsprechung
- (a) Widersprüche zwischen „UsedSoft“ und „Tom Kabinet“
- (aa) Widersprüche in der dogmatischen Begründung
- (bb) Widersprüche in der ökonomischen Begründung
- (b) Widerspruch zwischen „Tom Kabinet“ und „Vereniging Openbare Bibliotheken“
- (c) Herausforderungen für die Beurteilung der Erschöpfung aufgrund des Downloads von Computerspielen
- (4) Zwischenergebnis
- b) Objektive Vertragsmäßigkeit gem. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b DI-RL
- aa) Argumente gegen die Weiterveräußerbarkeit digitaler Inhalte als vernünftige Verbrauchererwartung
- bb) Argumente für die Weiterveräußerbarkeit digitaler Inhalte als vernünftige Verbrauchererwartung
- cc) Streitentscheid
- c) Zwischenfazit
- d) Auswirkungen der Aktualisierungspflicht gem. Art. 8 Abs. 2 DI-RL auf die Verkehrsfähigkeit von Software
- 2. Beschränkung der Anzahl von (Sicherungs-)Kopien
- a) Urheberrechtliche Wertungen
- aa) Sicherungskopien und bestimmungsgemäße Nutzung von Computerprogrammen, § 69d Abs. 1, 2 UrhG
- (1) Sicherungskopien, § 69d Abs. 2 S. 1 UrhG
- (2) Bestimmungsgemäße Benutzung, § 69d Abs. 1 UrhG
- bb) (Sicherungs-)Kopien von E-Books, § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG
- (1) Einschränkung für E-Books gem. § 53 Abs. 4 Buchst. b UrhG
- (a) Meinungsstand
- (b) Stellungnahme
- (2) Zwischenfazit
- cc) Zusammenfassung
- b) Objektive Vertragsmäßigkeit gem. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b DI-RL
- c) Zwischenfazit
- 3. Beschränkung der Nutzung auf verschiedenen Geräten, CPU-Klauseln
- a) Urheberrechtliche Wertungen
- b) Objektive Vertragsmäßigkeit gem. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b DI-RL
- c) Zwischenfazit
- 4. Interoperabilität
- a) Urheberrechtliche Wertungen
- b) Interoperabilität als Merkmal der subjektiven Vertragsmäßigkeit gem. Art. 7 Buchst. a DI-RL
- c) Zwischenfazit
- 5. Erfordernis des Abschlusses von EULAs als Rechtsmangel i.S.d. Art. 10 DI-RL
- VI. Urheberrechtliche Zulässigkeit und objektive Vertragsmäßigkeit des Einsatzes technischer Schutzmaßnahmen
- 1. Technische Schutzmaßnahmen und ihr Schutz nach dem UrhG
- a) Schutz technischer Maßnahmen, § 95a UrhG und § 69f Abs. 2 UrhG
- b) Durchsetzung von Schrankenbestimmungen, § 95b UrhG und § 69f Abs. 3 UrhG
- c) Kennzeichnungspflicht, § 95d Abs. 1 UrhG
- d) Zwischenfazit
- 2. Objektive Vertragsmäßigkeit technischer Schutzmaßnahmen nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b DI-RL
- 3. Zwischenfazit
- VII. Rechtsbehelfe der Verbraucher:in bei vertragswidrigen Nutzungsbeschränkungen in EULAs sowie vertragswidrigen technischen Schutzmaßnahmen
- 1. Allgemeines
- 2. Rechtsbehelfe bei nicht erfolgter Bereitstellung
- 3. Rechtsbehelfe bei Vertragswidrigkeit aufgrund eines Rechtsmangels
- 4. „Take it or leave it“-Situation für die Verbraucher:in
- VIII. Zusammenfassung
- IX. Konsequenzen aus der widersprüchlichen Beurteilung von Nutzungsbeschränkungen in EULAs
- 1. Zunehmender Einsatz von negativen Beschaffenheitsvereinbarungen hinsichtlich abweichender Nutzungsbeschränkungen in EULAs gem. Art. 8 Abs. 5 DI-RL
- a) Voraussetzungen der negativen Beschaffenheitsvereinbarung
- b) Konsequenzen für eine negative Beschaffenheitsvereinbarung hinsichtlich abweichender EULAs
- c) Praktikabilität der negativen Beschaffenheitsvereinbarung
- d) Zwischenfazit
- 2. Angleichung des Inhaltes von EULAs an die Anforderungen der DI-RL
- a) Mittelbare Auswirkungen der Rechtsmängelhaftung der Unternehmer:in auf die Rechtsposition der Rechteinhaber:in
- b) Regressanspruch der Unternehmer:in gegenüber der Rechteinhaber:in
- c) Zwischenfazit
- 3. Verschiebung des Interessenausgleichs zwischen Rechteinhaber:innen, Werknutzer:innen und der Allgemeinheit vom Urheber- ins Verbrauchervertragsrecht
- a) Zunahme von Geschäftsmodellen mit befristetem Zugang zu digitalen Inhalten
- aa) Attraktivität der Geschäftsmodelle für Rechteinhaber:innen
- bb) Attraktivität der Geschäftsmodelle für Unternehmer:innen
- b) Wachsender Bedeutungsverlust des Erschöpfungsgrundsatzes
- c) Verschiebung des Interessenausgleichs
- C. Ergebnisse Teil 2
- Teil 3: Auflösung des Konflikts zwischen Urheber- und Verbrauchervertragsrecht auf dem Gebiet der Verträge über digitale Inhalte
- A. Parallele Anwendung der Vorschriften über Computerprogramme und „klassische“ urheberrechtlich geschützte Werke auf sonstige digitale Inhalte am Beispiel des E-Books
- I. Technische Anknüpfungspunkte für die Anwendbarkeit der Vorschriften über Computerprogramme auf E-Books
- II. Argumente für eine parallele Anwendbarkeit
- 1. Aufhebung des Widerspruchs in der EuGH-Rechtsprechung
- 2. Zunehmende Herausforderungen in der Differenzierung zwischen „einfachen“ und „komplexen“ digitalen Werken
- III. Anwendbare Regelungen in Konfliktfällen
- IV. Beurteilung einzelner Konfliktfälle am Beispiel des E-Books
- 1. (Sicherungs-)Kopien von E-Books
- 2. Umgehung technischer Schutzmaßnahmen
- 3. Weiterveräußerung von E-Books
- a) Beurteilung nach der bisherigen Rechtsprechung des EuGHs
- b) Erfordernis einer Reformierung der Rechtsprechung des EuGHs
- c) Zwischenfazit
- B. Zusammenfassung und Ausblick
- Fazit
Einleitung
A. Problemaufriss
Digitale Inhalte sind aus dem modernen Alltag nicht mehr wegzudenken.1 Ob Bücher, Musik, Filme oder Spiele – sie alle werden heutzutage digitalisiert oder digital erstellt, digital vertrieben und digital konsumiert.2
Auch im europäischen und – in dessen Umsetzung – im nationalen Privatrecht sind digitale Inhalte schon lange ein feststehender Begriff.3
Bereits die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher (Verbraucherrechte-RL)4 aus 2011 beinhaltete den Begriff des „digitalen Inhaltes“ (Art. 2 Nr. 11 Verbraucherrechte-RL) sowie den „Vertrag über die Bereitstellung von digitalen Inhalten“ (Erwägungsgrund (EG) 19 Verbraucherrechte-RL).5 Die Richtlinie setzte sich jedoch mit dem Recht der Verträge über digitale Inhalte nicht tiefergehend auseinander,6 sondern etablierte im Wesentlichen vorvertragliche Informationspflichten sowie ein Widerrufsrecht für Verbraucher:innen in Bezug auf Verträge über digitale Inhalte.7 Dementsprechend fehlte es bspw. an expliziten EU-Regelungen zum Schutz von Verbraucher:innen für den Fall, dass die digitalen Inhalte hinsichtlich der Zugänglichkeit, Funktionalität oder Interoperabilität Mängel aufwiesen.8 Um diesen Missstand zu beheben und auf die in der digitalen Wirtschaft im Bereich des Privatrechts bestehenden Bedürfnisse zu reagieren, erließ die EU die am 11. Juni 2019 in Kraft getretene Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen (DI-RL)9.10
I. Ein einheitliches Verbrauchervertragsrecht für Verträge über digitale Inhalte: Die Digitale-Inhalte-Richtlinie
Die DI-RL enthält Regelungen „über die Vertragsmäßigkeit digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen, Abhilfen im Falle ihrer Vertragswidrigkeit oder nicht erfolgten Bereitstellung, und die Art und Weise der Inanspruchnahme dieser Abhilfen, sowie die Änderung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen“.11 Damit verfolgt die DI-RL insbesondere das Ziel eines vereinheitlichten Gewährleistungsrechtes für digitale Verträge.12
Die Richtlinie ist dabei eng angelehnt an die Regelungen des Vorschlages der Kommission für eine Verordnung über ein gemeinsames Europäisches Kaufrecht (GEKR-E),13 die als nichtbindendes, optionales Instrument ein neben dem nationalen Vertragsrecht geltendes vertragsrechtliches Regelwerk schaffen sollte.14 Dieser Entwurf wurde durch die Kommission Ende 2014 aufgrund des absehbaren Widerstands des Europäischen Rates wieder zurückgezogen.15 Im Dezember 2015 unterbreitete die Kommission dann den Vorschlag zur DI-RL, die nicht mehr nur ein optionales Instrument, sondern eine vollharmonisierende Richtlinie darstellen sollte.16 Anstatt eines umfassenden vertragsrechtlichen Regelwerks wurde mit der DI-RL eine zielgerichtete, auf Verträge über digitale Inhalte begrenzte Gesetzgebung mit zwingenden Vorschriften verfolgt.17
Um das erwähnte Ziel eines vereinheitlichen Gewährleistungsrechtes für digitale Inhalte zu erreichen, sieht die DI-RL in Art. 4 eine Vollharmonisierung vor, sodass die Mitgliedsstaaten in der Umsetzung grundsätzlich nicht von den Vorgaben der DI-RL abweichen konnten. In Deutschland wurde das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen am 30. Juni 2021 veröffentlicht.18 Das Gesetz sieht eine Umsetzung der DI-RL im Wesentlichen in einem neuen Titel 2a „Verträge über digitale Produkte“ in den §§ 327–327u Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) im Allgemeinen Teil des Schuldrechts vor.19 Andere Ansätze, bspw. die Schaffung eigener (Grund-)Vertragstypen im Besonderen Teil des Schuldrechts20 oder die Umsetzung in einem eigenständigen Gesetz,21 blieben damit unberücksichtigt.22 Durch die in der Richtlinie vorgesehene Vollharmonisierung und die in der Richtlinie enthaltenen umfangreichen und detaillierten Regelungen übernimmt das Umsetzungsgesetz die Vorgaben größtenteils unverändert.23 Darüber hinaus enthält es ergänzende Vorschriften wie bspw. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche gem. § 327i Nr. 3 BGB.
II. Berührungspunkte mit dem Urheberrecht auf dem Gebiet der Verträge über digitale Inhalte
Das Verbrauchervertragsrecht ist auf dem Gebiet der Verträge über digitale Inhalte durch Überschneidungen mit dem Urheberrecht geprägt.24 Digitale Inhalte – ob E-Book, Film, Musik oder Computerprogramm – sind regelmäßig urheberrechtlich geschützt.25 Erwerben und nutzen Verbraucher:innen diese urheberrechtlich geschützten Inhalte, berühren sie damit zwangsläufig urheberrechtliche Ausschließlichkeitsrechte der Rechteinhaber:innen.26 Bei dem Erwerb, der Wiedergabe oder der Weiterveräußerung kommt es stets zu einer Kopie und damit auch zu einer urheberrechtlich relevanten Vervielfältigung des digitalen Inhalts.27
Daher gehen Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte häufig mit der Einräumung urheberrechtlicher Nutzungsrechte einher.28 Die Rechteinhaber:in und die Unternehmer:in, die den digitalen Inhalt bereitstellt, sind dabei regelmäßig personenverschieden.29 Die Einräumung von Nutzungsrechten erfolgt dementsprechend in der Praxis meist mittels eines sog. End User License Agreements (EULA), zu Deutsch Endnutzer-Lizenzvertrag, der unmittelbar zwischen Rechteinhaber:in und Verbraucher:in abgeschlossen wird und häufig weitreichende Beschränkungen der Nutzung digitaler Inhalte enthält.30
Trotz bestehender Überschneidungen wurde das Verhältnis von Urheber- und Verbrauchervertragsrecht auf dem Gebiet der Verträge über digitale Inhalte bisher – insbesondere bis zum Erlass der DI-RL – vergleichsweise wenig behandelt.31 Dabei weisen das Urheberrecht, das zuvörderst dem Schutz der Schöpfer:in in der persönlichen und wirtschaftlichen Beziehung zu ihrem Werk dient, und das Verbrauchervertragsrecht, das die wirtschaftlichen Interessen von Verbraucher:innen schützen und deren Rechtsposition in der wirtschaftlichen Beziehung zu einer Unternehmer:in stärken möchte, unterschiedliche Zielrichtungen auf. Diese unterschiedlichen Zielrichtungen bieten im digitalen Umfeld erhebliches Konfliktpotenzial, bedingt insbesondere durch den Umstand, dass Verbraucher:innen sowohl bei dem Erwerb als auch bei der Nutzung digitaler Inhalte, wie erwähnt, stets in Kontakt mit urheberrechtlichen Ausschließlichkeitsrechten geraten.
Auch die DI-RL vermeidet eine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zum Urheberrecht.32 Im Gegenteil besagt sie in Art. 3 Abs. 9, EG 20 und 36, dass sie das Urheberrecht unberührt lässt, und schließt es damit explizit aus ihrem Anwendungsbereich aus.33 Damit scheint das Verhältnis von Urheberrecht und der DI-RL auf den ersten Blick geklärt zu sein.34 Auf den zweiten Blick ergeben sich in diesem Verhältnis allerdings Unklarheiten, bspw. in Bezug auf das Verhältnis von DI-RL zur Verordnung zur grenzüberschreitenden Portabilität von Online-Inhaltediensten im Binnenmarkt (sog. Portabilitäts-VO)35 und bezüglich des Overblockings rechtmäßig hochgeladener Inhalte auf Grundlage von Art. 17 der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (kurz DSM-RL)36 durch Internet-Plattformen, die gleichzeitig als Anbieter digitaler Dienstleistungen i.S.d. DI-RL zu qualifizieren sind.37
Als besonders drängend erweist sich zudem die Frage, wie die DI-RL Nutzungsbeschränkungen in EULAs beurteilt. Denn EULAs und darin enthaltene Nutzungsbeschränkungen werden von der DI-RL gem. Art. 10 DI-RL jedenfalls mittelbar erfasst.38 Danach ist eine Vertragswidrigkeit im Vertragsverhältnis von Unternehmer:in und Verbraucher:in auch dann gegeben, wenn eine „Beschränkung, die sich aus der Verletzung von Rechten Dritter – insbesondere von Rechten des geistigen Eigentums – ergibt, die Nutzung der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen i.S.d. Art. 7 und 8 verhindert oder einschränkt“. Vor allem steht infrage, inwieweit die Beurteilung von Nutzungsbeschränkungen in EULAs durch die DI-RL von der urheberrechtlichen Bewertung dieser Beschränkungen abweicht und welche Auswirkungen sich ggf. aus einer solchen abweichenden Beurteilung ergeben.
B. Gang der Untersuchung
Die vorliegende Arbeit wird sich mit dem Verhältnis von Verbrauchervertrags- und Urheberrecht auf dem Gebiet der Verträge über digitale Inhalte im Rahmen einer rechtsdogmatischen Analyse befassen. Dabei wird zunächst das generelle Konfliktpotenzial der beiden Rechtsgebiete im digitalen Umfeld untersucht. Hierzu ist es erforderlich, die Zielrichtungen beider Rechtsgebiete zu analysieren und herauszuarbeiten, warum die jeweils verfolgten Schutzziele im digitalen Umfeld miteinander in einen Konflikt geraten. Dabei wird sich zeigen, dass das Urheberrecht den Rechteinhaber:innen weitreichende Möglichkeiten der Kontrolle über den Zugang zu und die Nutzung von digitalen Inhalten insbesondere mittels restriktiver Lizenzbedingungen in EULAs einräumt und gleichzeitig die Interessen von Verbraucher:innen, die bei dem Erwerb und der Nutzung digitaler Inhalte in Berührung mit dem Urheberrecht kommen, nur unzureichend berücksichtigt.
Auf den im Rahmen dieser Untersuchung gewonnenen Erkenntnissen aufbauend soll das konkrete Verhältnis des Verbrauchervertragsrechts für Verträge über digitale Inhalte, also der DI-RL, und des Urheberrechts bei der Beurteilung von Nutzungsbeschränkungen in EULAs analysiert werden. Im Wesentlichen gilt es dabei die Fragen zu beantworten, inwiefern die hinsichtlich dieser Nutzungsbeschränkungen zu untersuchende vernünftige Verbrauchererwartung als ein objektives Vertragsmäßigkeitskriterium der DI-RL im Widerspruch zur urheberrechtlichen Beurteilung der Nutzungsbeschränkungen steht und welche Auswirkungen sich aus einem möglichen Widerspruch ergeben. Bei der Untersuchung dieser Auswirkungen ist insbesondere zu klären, ob die Aussage der DI-RL, sie lasse das Urheberrecht unberührt, zutrifft oder ob sich – jedenfalls mittelbare – Implikationen für das Urheberrecht ergeben.
1 Oprysk, GRUR Int 2021, 943, 943.
2 Ebd.; Kuschel, S. 1.
3 S. schon Schmidt-Kessel, K&R 2014, 475, 475.
4 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates v. 25.10.2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, Abl. L 304/64.
5 Grünberger, AcP 2018, 213, 217.
6 Vgl. Schmidt-Kessel et al., GPR 2016, 54, 54.
7 Koukal, Masaryk University Journal of Law and Technology Vol. 15 No. 1 (2021), 53, 60.
8 Ebd.
9 Richtlinie (EU) 2019/770 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 20.5.2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen, Abl. L 136/1.
10 Koukal, Masaryk University Journal of Law and Technology Vol. 15 No. 1 (2021), 53, 56.
11 EG 11 DI-RL.
12 Wendland, ZVglRWiss 2019, 191, 196.
13 Vorschlag COM(2011), 635 v. 11.10.2011 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht.
14 Koukal, Masaryk University Journal of Law and Technology Vol. 15 No. 1 (2021), 53, 56 f.
15 Wendland in BeckOGK, Rom I-VO, Art. 3 Rn. 91.
16 Koukal, Masaryk University Journal of Law and Technology Vol. 15 No. 1 (2021), 53, 60.
17 Ebd.
18 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen v. 25.6.2021, BGBl. 2021 Teil I Nr. 37, 2123.
19 Sattler, NJW 2020, 3623, 3623; Spindler, MMR 2021, 451, 451.
20 So z.B. Metzger, JZ 2019, 577, 585 f.; Wendland, ZVglRWiss 2019, 191, 226 f.
21 So Sattler, CR 2020, 145, 153.
22 Spindler, MMR 2021, 451, 451.
Details
- Pages
- 232
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631922668
- ISBN (ePUB)
- 9783631922675
- ISBN (Hardcover)
- 9783631922538
- DOI
- 10.3726/b22043
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (October)
- Keywords
- rechtsdogmatische Analyse Lizenzverträge End User License Agreements Digitale-Inhalte-Richtlinie Verträge über digitale Inhalte digitale Inhalte Vertragsrecht Verbrauchervertragsrecht geistiges Eigentum Urheberrecht Rechtswissenschaften
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2024. 232 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG