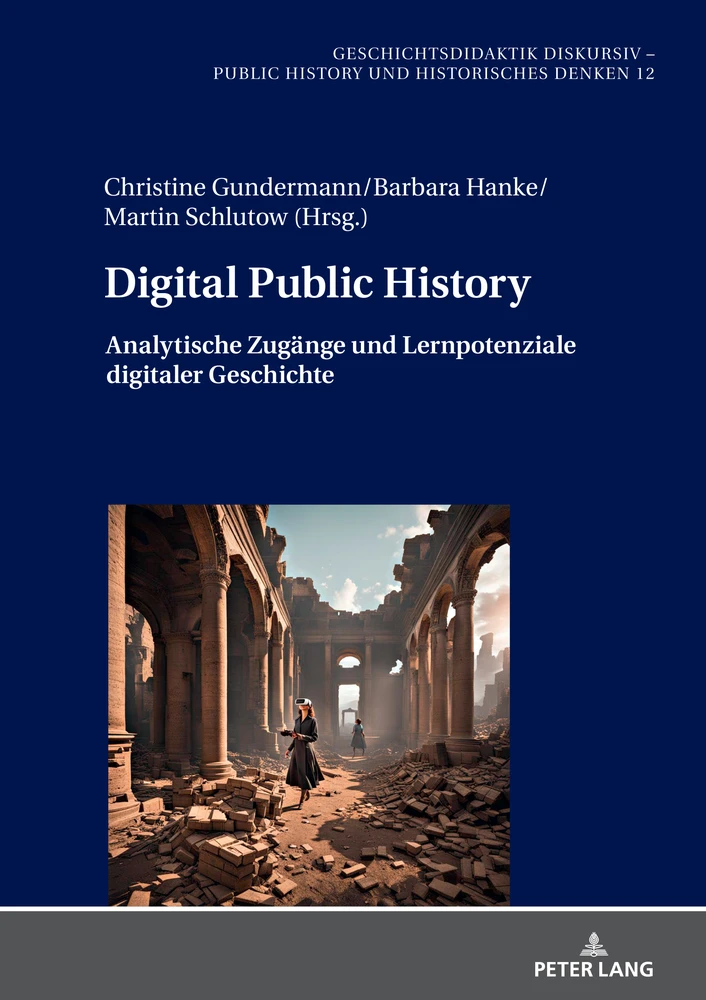Digital Public History
Analytische Zugänge und Lernpotenziale digitaler Geschichte
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Digital Public History im Spannungsfeld von Forschung, Vermittlung und Unterhaltung
- Digitale Erinnerungskulturen – Spielerische Erinnerungskulturen? Auf den Spuren des spielerischen Moments in den Digital Memory Cultures
- Vergangenheitsatmosphäre als analytischer Zugang zu geschichtskulturellen Erlebnisangeboten. Eine Herleitung über historisierende Digitale Spiele
- (A)Historisches in digitalen Spielen beschreiben. Skizzen für Auswege aus der Anachronismusfalle
- „I’m still trying to figure out which is the real one.“ Überlegungen zur Analyse digitaler historisierender Räume
- (Wie) funktionieren „Zeitreisen“ mit Virtual Reality und was können wir aus ihnen lernen?
- Speedrunning Anne Frank House VR. Disruption der Vergangenheitsatmosphäre
- Geschichtsvermittlung auf Instagram. Ein Vorschlag zur Analyse
- Wer ist Sophie Scholl? Der Instagram-Account@ichbinsophiescholl als Vergangenheitssimulation
- Inspirieren, um selbst zu entdecken. Das historische Museum im Übergang zur digitalen Kultur am Beispiel der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
- Postkoloniale Räume im digitalen Spiel Anno 1800
- Doing History auf TikTok. Überlegungen zur Untersuchung der transmedialen, performativen Aktivitäten der digitalen Mittelalterszene
- „wann er also das ganze Buch durchlauffen“. Über die Virtualität des Raumes im Orbis sensualium pictus (1658)
- Social Media und Public History. Digitales historisches Lernen mit Twitter, Instagram und TikTok
- „Je mehr Quellen wir auswerteten, desto widersprüchlicher standen sie zueinander.“ Konzeptionelle und empirische Einblicke in forschende und entdeckende Lernprozesse im digitalen Raum
- „Du musst einfach nur auf den Link klicken.“ Wie Schüler*innen digitale historische Lernaufgaben der Plattform segu lösen
- Der Laborversuch „When We Disappear“. Über Serious Games und historische Bildung
- Autor*innenverzeichnis
- Reihenübersicht
Christine Gundermann / Barbara Hanke / Martin Schlutow
Digital Public History im Spannungsfeld von Forschung, Vermittlung und Unterhaltung
Ob im Museum, im Spiel, in den Sozialen Medien, im Rahmen virtueller Zeitreisen oder auf einer Reihe von Lernplattformen – Geschichte wird von den unterschiedlichsten Akteur*innen in zunehmendem Maße auch digital gemacht und genutzt. Dabei sind die gewählten Zugänge äußerst heterogen: Die Entwicklung digitaler historisierender Spiele setzt beispielsweise eher auf einen unterhaltenden, immersiven Zugang zu Geschichte, während andere Formate sich in erster Linie als digitale Lernangebote verstehen, die eine kognitive, analytische Auseinandersetzung mit Geschichte fördern. Letztere wiederum machen teils ein deutlich vorstrukturiertes, teils ein inhaltlich und/oder methodisch offen gehaltenes Angebot historischen Lernens. Dennoch lassen sich zwei grundlegende Gemeinsamkeiten einer digitalen Public History1 auf Phänomen-Ebene konstatieren: Erstens zielt sie auf eine Aktivierung aller Beteiligten – sei es in informeller, spielerischer Art oder im Sinne des selbstgesteuerten, entdeckenden Lernens. Zweitens werden damit stets historische Denk- und Lernprozesse angeregt, die allerdings „unter den Bedingungen der Digitalität“2 stattfinden.
Diese Gemeinsamkeiten machen die digitalen Produkte und Praktiken des Umgangs mit Geschichte zu einem wichtigen Forschungsfeld für die Public History und Geschichtsdidaktik. Wer sich wissenschaftlich mit diesen Phänomenen befassen möchte, ist mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert: Erstens erschwert die ungeheure Vielgestaltigkeit eine Typologisierung der unterschiedlichen Phänomene. Sollten diese zum Beispiel nach Kriterien der verantwortlichen Institutionen, nach Praktiken des Umgangs mit Geschichte oder etwa nach dem Grad ihrer Dauerhaftigkeit gebildet werden? Mit der Vielgestaltigkeit geht zweitens Schnelllebigkeit einher, wie nicht zuletzt die jüngeren Entwicklungen rund um KI-Systeme wie ChatGPT belegen, die in diesem Sammelband noch nicht in Bezug auf digitale Public History diskutiert werden. Vielgestaltigkeit und Schnelllebigkeit machen drittens neue theoretische Ansätze und methodische Wege der Erforschung digitaler Public History erforderlich. Sie sind aufgrund der Verknüpfung digitaler Techniken mit dem Gegenstand Geschichte in aller Regel interdisziplinär zu entwickeln: Zwar bleibt die Geschichtswissenschaft auch in diesem Sammelband die Hauptbezugsdisziplin, darüber hinaus können aber auch Medienpsychologie, Game Studies und Kulturwissenschaften etc. Zugänge zu digitalen Repräsentationen von Geschichte eröffnen und geeignete Analysekategorien anbieten. Viertens geht mit der Digitalisierung auch eine Diversifizierung der Akteur*innen der Public History einher. Denn in der Regel bedeutet digitale Public History eben nicht, dass Historiker*innen und weitere Professionals digitale Produkte für bestimmte Publika entwickeln, die letztere dann als „Fertigkost“ rezipieren, wie ältere Definitionen von Digital Public History dies noch vorsehen.3 Stattdessen ist digitale Public History einerseits geprägt von partizipativen Praktiken äußerst heterogener Akteur*innen im Umgang mit Geschichte, teilweise wird hier deswegen auch von Prosumer gesprochen. Andererseits treffen jedoch in der „Kultur der Digitalität“ auch widersprüchliche Tendenzen aufeinander, wie Felix Stalder betont. Denn der partizipativen Commons-Kultur steht die Macht großer Medienkonzerne entgegen, die mit Hilfe von Algorithmen eben nicht allen Nutzer*innen die gleichen Mitbestimmungsrechte im Digitalen gewähren.4 Dieses „Partizipationsparadoxon“ betrifft auch die digitale Geschichtskultur5 und erschwert die analytische Einordnung der Handlungsspielräume beteiligter Akteur*innen.
In Anbetracht dieser Herausforderungen kann es nicht das Ziel des vorliegenden Sammelbandes sein, einen abschließenden Forschungsüberblick über digitale Public History vorzulegen. Hilfreich ist als erste Annäherung an dieses vielgestaltige Phänomen jedoch die von Serge Noiret, Mark Tebeau und Gerben Zaagsma vorgelegte Arbeitsdefinition, die auch für diesen Sammelband gelten soll, da sie sowohl das partizipative Element als auch die Varianz der Praktiken im Umgang mit Geschichte im Digitalen betont: „DPH [= Digital Public History, Anm. der Hrsg.] is characterized by the digitally enabled ways in which historians and their publics, in mutual interaction and co-dependency, gather, collect, consume, disseminate and engage with history and its sources.“6
Die Forschungsansätze einer digitalen Public History, die in diesem Band zusammengetragen werden, sollen zudem entlang dreier Sichtachsen präsentiert werden, indem sie in theoretisch-methodische Zugänge, konkrete Fallanalysen und Beiträge zur Frage nach Lernpotenzialen unterteilt werden. Dementsprechend befasst sich eine erste Gruppe von Beiträgen auf grundlegender Ebene mit theoretischen und methodischen Fragen zur Untersuchung digitaler Public History: Welche Wissenschaftsdisziplinen ermöglichen ein vertieftes Verständnis der unterschiedlichen Formen und Funktionen digitaler Public History? Welche Forschungsfragen stellen sie? Und welche Begriffe und Analysekategorien bieten sie an?
Tabea Widmann präsentiert ganz grundsätzliche Überlegungen zu digitalen Formen von Geschichte und geht der Frage nach, inwiefern digitale erinnerungskulturelle Praktiken deutliche Kennzeichen von Fluidität und vor allem Fragmentierung aufweisen, die nur bedingt identitätsstiftende Wirkung entfalten können. Anhand von digitalen Angeboten, die die nationalsozialistischen Verbrechen thematisieren, beleuchtet sie die Bedeutung von spielerischen Elementen in diesen und fragt, wie diese Qualität unser Verhältnis zur Vergangenheit bestimmt und was dies für das Erinnern, aber auch für die Erforschung von Erinnerungskultur bedeuten kann.
Felix Zimmermann führt in einen nunmehr längst überfälligen theoretischen Diskurs ein, der endgültig die Frage nach der „korrekten Darstellung“ von Geschichte im Spiel ablöst und fragt, wie eigentlich überzeugend ein historisches Setting im digitalen Spiel erschaffen wird. Er präsentiert dafür seine Theorie der Vergangenheitsatmosphären und zeigt exemplarisch anhand des Spiels „Anno 1800“, wie man diese analysieren kann.
Auch Tobias Winnerling diskutiert die Frage nach der „korrekten Geschichte“. Im Gegensatz zu Felix Zimmermann widmet er sich aber dem Anachronismus in digitalen Spielen, also Darstellungen, die (meist) Gegenwärtiges in vergangene Zeiten projizieren und als historisch darstellen. Winnerling entwickelt daher in seinem Beitrag anhand der „Civilization“-Reihe von Sid Meier den (Ana)Chronismus als Schlüsselbegriff für die Analyse digitaler Spiele und erweitert damit sowohl unser theoretisches Verständnis als auch methodische Zugänge zu Geschichte in digitalen Spielen.
Christine Gundermann setzt sich in ihrem Beitrag mit der Frage auseinander, wie historisierende Räume in digitalen Spielen entstehen. Davon ausgehend, dass historische Sinnbildung nicht nur ein kognitiver Vorgang ist, sondern zunächst über körperliche Praktiken konstituiert wird, schlägt sie vor, für die Analyse digitaler historisierender Spiele die Kategorien Raum und Körper zu nutzen. Ihre Auseinandersetzung mit Raumbezeichnungen und performativen Schlüsselbegriffen bzw. Aneignungsmodi wie Authentizität und Erlebnis veranschaulicht dabei nicht nur das heuristische Potenzial dieser Kategorien für die Erschließung digitaler Spiele, sondern sie verdeutlicht auch den Wert transdisziplinärer Zugänge für eine digitale Public History.
Elena Lewers rückt in ihrem Beitrag die mittlerweile in zahlreichen Städten angebotenen „Zeitreisen“ mit Hilfe von Virtual Reality in den Fokus und fragt auf theoretischer Ebene danach, mittels welcher Kategorien derartige Produkte untersucht werden können. Sie knüpft dabei insbesondere an medienpsychologische Forschungen von Werner Wirth und Matthias Hofer zum „Präsenzerleben“ an7 und schlägt vor, deren Kategorien „Medium“, „Person“ und „Situation“ für die Untersuchung von „Zeitreisen“ geschichtswissenschaftlich und -didaktisch zu wenden.
Christian Günther konzentriert sich in seiner Analyse auf ein Phänomen, das systematisch nur schwer zu erfassen ist: den eigensinnigen Umgang von User*innen mit Angeboten digitaler Geschichte. Ausgehend von der Anwendung Anne Frank House VR, die einen Rundgang durch eine digitale Rekonstruktion des Hinterhauses, in dem sich die Franks versteckt hielten, ermöglicht, geht er zunächst der Frage nach, mit welchen Mitteln ein solcher historisierender Raum Authentizität beansprucht und damit letztlich eine Vergangenheitsatmosphäre für die User*innen anbietet. Günther zeigt danach anhand der Praxis des Speedrunnings einen von den Erschaffenden nicht antizipierten Nutzungsmodus auf und fragt, wie sich dadurch die Rezeption von Vergangenheit verändert und welche Rückschlüsse sich so auf zukünftige Anwendungen im Gedenkstättenbereich ziehen lassen.
Von den medienlogischen Prämissen der Social-Media-Plattform Instagram ausgehend, präsentiert Julia Pater in ihrem Beitrag eine Webformat-Analyse, die drei Analyseebenen erfasst: die deskriptive, die interpretative und die diskursive Ebene. In einem exemplarischen Zugriff auf den Instagram-Kanal Terra X History arbeitet sie systematisch Charakteristika historischer Produkte auf Instagram-Kanälen heraus und leitet damit direkt zur nächsten Beitragsgruppe über.
Die zweite Gruppe von Beiträgen konzentriert sich auf die Analyse und Diskussion ausgewählter Fallbeispiele. Einerseits widmen sich die Analysen dabei klassischen Institutionen und Medien wie dem Museum oder dem Buch, andererseits beschäftigen sie sich auch mit Geschichte in digitalen Spielen und Sozialen Medien. Damit illustrieren die Beiträge nicht nur die Spannbreite und Heterogenität einer digitalen Public History, sondern auch den Wandel geschichtskultureller Praktiken.
Die Journalistin Nora Hespers und die Historikerin Charlotte Jahnz analysieren in ihrem Beitrag den 2021 und 2022 viel diskutierten Instagram-Account @ichbinsophiescholl. Sie führen dafür zunächst in die Funktionsmechanismen des Social Media-Kanals ein und zeigen am konkreten Beispiel, warum die hier produzierte Form der Vergangenheitssimulation zwar eine große emotionalisierende und auch immersive Wirkung entfalten konnte, aber vor allem über Fragmentierungen und Intransparenz eher Mythenbildung und weniger Geschichte anbietet. Sowohl die Herausforderungen als auch Potenziale bei der Präsentation und Verhandlung von Geschichte auf Instagram werden so sichtbar.
Ruth Rosenberger von der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bietet in ihrem Beitrag einen Einblick in die digitalen Transformationsprozesse, die das zeitgeschichtliche Museum aktuell umsetzt. Dies reicht von der nunmehr etablierten Kommunikation über Social-Media-Kanäle über die Gestaltung von ausstellungsspezifischen Apps bis hin zur konkreten Gestaltung von musealer Vermittlung über digitale Lernstationen. Dabei geht es immer wieder darum, Verbindungen zwischen der analogen und digitalen Museumswelt für alle Beteiligten herzustellen. Ruth Rosenberger kombiniert dabei Ergebnisse der hauseigenen Besuchendenforschung mit den gegenwärtigen Herausforderungen, denen sich das Haus der Geschichte stellen will.
Digitale Spiele in historischen Settings erfreuen sich bereits seit Jahren großer Beliebtheit. Eine der erfolgreichsten Reihen der deutschen Computerspielindustrie ist die Reihe „Anno“, deren 2019 erschienener Titel „Anno 1800“ die Spielenden in die Welt des Imperialismus entführt. Kritik an kolonialrevisionistischen Tendenzen des Spiels ließ jedoch nicht lange auf sich warten, worauf Blue Byte/Ubisoft mit der Veröffentlichung der kolonialkritischen Spielerweiterung „Land der Löwen“ reagierte. Beides – Spiel und Spielkritik – veranlasst Marian Bodden zu einer Fallanalyse von „Anno 1800“ aus postkolonialer Perspektive, die im Wesentlichen zu dem Befund gelangt, dass die Spielerweiterung „Land der Löwen“ zwar punktuell auf narrativer und ludischer Ebene kolonialkritisch ausgerichtet sei, nicht jedoch mit dem imperialistischen Grundprinzip des Spiels breche.
Während hinter Spielen wie „Anno 1800“ in der Regel professionelle Entwicklerstudios stecken, finden auf TikTok auch zahlreiche Semi-Professionals und Laien eine Plattform für ihren performativen Umgang mit Geschichte. So bedient sich beispielsweise auch die digitale Mittelalterszene dieses Formats für ihr „Doing History“.8 Anhand ausgewählter Videos des selbst ernannten Wikingers „RonsonKR“ untersucht Christina Sachs in ihrem Beitrag die Aktivitäten dieser Szene und fragt danach, welcher Authentifizierungsstrategien im Umgang mit der Welt der Wikinger sich „RonsonKR“ bedient.
Einen gänzlich anderen Zugriff auf das Rahmenthema dieses Bandes wählt demgegenüber Simon Huber in seinem Beitrag: Er nähert sich dem Phänomen gegenwärtiger Immersionsversprechen in zahlreichen Produkten der digitalen Public History durch Historisierung. Hierfür analysiert er die frühneuzeitliche Bildenzyklopädie „Orbis sensualium pictus“ (1658) des Johannes Amosius Comenius im Hinblick auf die Frage, inwiefern das Eintauchen in eine virtuelle Welt durch die Rezeption der Bild- und Textelemente bereits in diesem Buch als geeigneter Weg des Lernens verstanden wurde.
Die dritte Gruppe des Bandes versammelt schließlich Beiträge, die nach dem historischen Lernen im Kontext digitaler Public History fragen, wie dies in der Geschichtsdidaktik bereits seit längerem etabliert ist.9 Dabei bilden die Beiträge nicht nur unterschiedliche Forschungsrichtungen ab (Forschung zu historischem Denken und Lernen, Phänomenforschung, Entwicklungsforschung), sondern sie nehmen auch ganz unterschiedliche Medien und Lernsituationen in den Blick.
Einen Überblick zum Zusammenhang von Sozialen Medien und historischem Lernen liefert Hannes Burkhardt in seinem Beitrag. Am Beispiel von Social Media-Auftritten über Nationalsozialismus und Holocaust führt er zunächst in die grundlegenden Erzählstrategien verschiedener Plattformen ein und fragt anschließend nach Lernpotenzialen und Nutzungsmöglichkeiten im Geschichtsunterricht. Dass diese äußerst vielfältig sein können, eröffnen die gewählten Beispiele über die Erinnerung an den Mauerfall 1989 auf Twitter,10 historische Reenactments auf Instagram oder die sogenannte Holocaust-Challenge auf TikTok.
Alexandra Krebs widmet sich in ihrem Beitrag dem historischen Lernen in digitalen Settings aus der Perspektive der empirischen Lehr-Lernforschung. Sie führt zunächst in das didaktische Konzept der „App in die Geschichte“ ein, die ihrem Forschungsprojekt zugrunde liegt und im Wesentlichen auf forschendes Lernen durch Recherche und Interpretation digitalisierter Quellen aus dem Hauptarchiv der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel abzielt. Im Mittelpunkt des Beitrags steht sodann die Frage, wie zwei Kleingruppen von Proband*innen im Rahmen der Arbeit mit dieser App Quellenrecherche und -auswahl realisieren. Die Daten wertet Krebs quantitativ mit Hilfe des Webanalyse-Tools Matomo und qualitativ mit einer qualitativen Inhaltsanalyse aus.
Wie Krebs befasst sich auch Lena Liebern in ihrem Beitrag mit historischem Lernen in digitalen Settings. Lernplattform segu nimmt sie ein digitales Format in den Blick, das aufgrund seiner didaktischen Vorstrukturierung gerade im schulischen Kontext an Bedeutung gewonnen hat. Im Zentrum des Forschungsprojekts, das Liebern im Bereich der Phänomenforschung ansiedelt, steht die Frage, wie Nutzer*innen digitale Lernaufgaben bearbeiten. Nach der Beschreibung des Untersuchungsdesigns präsentiert sie empirische Befunde zu den Denkoperationen, Lösungsstrategien und Sprachhandlungen der Lernenden. Dabei kann sie u.a. zeigen, dass die Nutzer*innen dazu tendieren, Informationen im digitalen Medium durch ein systematisches Abarbeiten der Inhalte zu erschließen.
Während sich Liebern in ihrem Forschungsprojekt mit der Nutzung eines didaktisch vorstrukturierten digitalen Lernmediums befasst, reflektieren Anne Schillig und Astrid Schwabe in ihrem Beitrag die Herausforderungen des Game-Based Learning aus der Perspektive der Entwicklungsforschung. Ihr Einblick in die Entwicklung des Projekts „When We Disappear“ fokussiert die Spannungsfelder und Zielkonflikte von Serious Games und historischer Bildung (insbesondere im Themenfeld Holocaust) und veranschaulicht zugleich, dass die Verbindung von Spielen und Lernen sowie der Konflikt zwischen geschichtsdidaktischen Ansprüchen und marktwirtschaftlichen Zielen für die digitale Public History ganz grundsätzliche Herausforderungen darstellen.
In der Gesamtschau kreisen die Beiträge trotz ihrer Vielfalt an Untersuchungsgegenständen, theoretischen Rahmungen und methodischen Vorgehensweisen damit um mindestens drei wiederkehrende Fragen: Wie entstehen Produkte digitaler Public History? Schlüsselkategorien sind in diesem Zusammenhang also Akteur*innen und Partizipation. Welche Praktiken prägen den Umgang mit Geschichte im Digitalen? Dem Spielen scheint dabei laut den Autor*innen des Sammelbandes eine besondere Bedeutung zuzukommen. Und nicht zuletzt: Wie sollen oder können die Angebote digitaler Public History auf ihre Nutzer*innen wirken? „Vergangenheitsatmosphäre“ (Zimmermann), „Immersion“ (Huber) oder „Präsenzerleben“ (Lewers) können hilfreiche Kategorien sein, um das Spannungsfeld zwischen Geschichte und Digitalität in den untersuchten Produkten auszuleuchten. Erste empirische Befunde zur Wirkung digitaler Produkte auf ihre Nutzer*innen liegen jedoch in erster Linie für den Aspekt des historischen Lernens vor (vgl. die Beiträge von Krebs und Liebern). Wie die digitale Public History selbst, so befindet sich auch die Forschung zur digitalen Public History weiterhin im Fluss. Die hier versammelten Beiträge möchten deshalb dabei helfen, erste analytische Zugänge zu diesem jungen Forschungsfeld zu eröffnen.
Der Band geht einerseits aus einer durch die Herausgebenden veranstalteten Ringvorlesung an der Universität zu Köln im Wintersemester 2021/2022 hervor, andererseits aus Beiträgen der Konferenz „Vergangenheitsatmosphären und Verkörperung in digitalen historischen Räumen“, die von Nico Nolden und Felix Zimmermann 2021 ausgerichtet wurde.11 Sie erweitern und ergänzen unsere Überlegungen auf historisierender und theoretisierender Ebene wie auch durch konkrete Analysen. Wir danken beiden für die Zusammenarbeit bei der Publikation. Schließlich möchten wir hier noch einmal allen Beteiligten unseren herzlichen Dank aussprechen: den Autor*innen, die mit viel Geduld ihre Texte für diesen Band vorbereitet haben, Yves Schwarze für seine hervorragende Arbeit beim Lektorat des Bandes und Meenakshi Murugesan für die angenehme Verlagsbetreuung bei der Drucklegung.
1 In diesem Sammelband wird auf Grund der Interdisziplinarität der Beiträge digitale Public History bis auf wenige Ausnahmen als Kofferbegriff für digitale Repräsentationen öffentlicher Geschichte und Vergangenheit verwendet, wie auch die weiter unten präsentierte Arbeitsdefinition zeigt. Damit treffen wir bewusst in diesem Text keine Aussagen über die Matrix einer (Digitalen) Public History als Wissenschaft.
2 Christoph Pallaske: Die Vermessung der (digitalen) Welt. Geschichtslernen mit digitalen Medien. In: Ders. /Marko Demantowsky (Hrsg.): Geschichte lernen im digitalen Wandel. Berlin/Boston 2015, S. 135–147, hier S. 136.
3 Fien Danniau gibt hier einen historisierenden Überblick: Vgl. Fien Danniau: Public History in a Digital Context. Back to the Future or Back to Basics? In: BMGN. Low Countries Historical Review 128 (2013), H. 4, S. 118–144.
4 Felix Stalder: Kultur der Digitalität. Berlin 2016, u.a. S. 218 u. 245.
5 Henrike Rehders: Partizipation für alle? Partizipative Geschichtskultur auf YouTube. In: Christian Bunnenberg/Nils Steffen (Hrsg.): Geschichte auf YouTube. Neue Herausforderungen für Geschichtsvermittlung und historische Bildung. Berlin/Boston 2019, S. 193–210, hier S. 197.
Details
- Seiten
- 316
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631911600
- ISBN (ePUB)
- 9783631916988
- ISBN (Hardcover)
- 9783631911594
- DOI
- 10.3726/b21702
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (Mai)
- Schlagworte
- Social Media History Public History Digital History Digital Public History Digital Historical Learning Digitales Geschichtslernen Computerspiele Lernplattformen Instagram
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 316 S., 23 s/w Abb., 8 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG