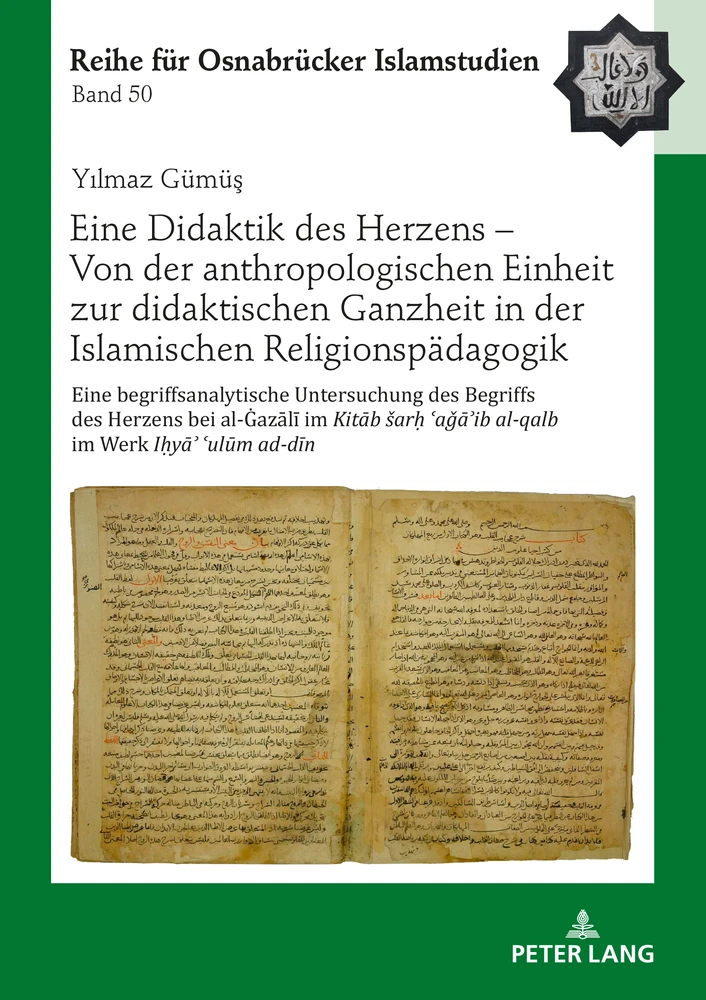Eine Didaktik des Herzens – Von der anthropologischen Einheit zur didaktischen Ganzheit in der Islamischen Religionspädagogik
Eine begriffsanalytische Untersuchung des Begriffs des Herzens bei al-Ġazālī im Kitāb šarḥ ʿaǧāʾib al-qalb im Werk Iḥyāʾ ʿulūm ad-dīn
Summary
Diese Arbeit zielt auf die Erschließung des theologisch-anthropologischen Menschenbilds und der religionspädagogischen Implikationen in der o. g. Quelle. Hierbei erfolgt zudem die umfassende Analyse des Herzbegriffs im Koran, welcher dem Herzkonzept al-Gazālīs gegenübergestellt wird. Ziel der Arbeit ist es, die Grundlagen einer theologisch-anthropologisch begründeten islamischen Religionspädagogik zu entwickeln. Die Untersuchung basiert auf der Prämisse, dass der Herzbegriff in al-Gazālīs Werk pädagogisch-anthropologische und religionspädagogische Implikationen aufweist, die zur Etablierung einer ganzheitlichen Theorie der Bildungs- und Erziehungspraxis beitragen können.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Vorwort, Dank und Widmung
- Einleitung
- Ganzheitlichkeit in der (Schul-)Pädagogik und in der Religionspädagogik
- Ursprung der Ganzheit in der antiken Philosophie und in der Entstehungsphase der Psychologie
- Ursprung der Ganzheit in der Antike
- Implikationen von Ganzheit und Menschenbild in der Korrelation von Staatsbildung und Pädagogik bei Aristoteles
- Grundlagen der lerntheoretischen Ganzheitlichkeit in der Psychologie
- Gestaltpsychologie/-theorie und die Berliner Schule
- Ganzheitspsychologie und die Leipziger Schule
- Ganzheitliche Ansätze in der schulpädagogischen Praxis
- Wissenschaftstheoretische Verortung der Ganzheit in der Pädagogik
- Schulpädagogische Umsetzung der Idee der Ganzheit
- Konzentration und Gesamtunterricht
- Weitere ganzheitliche Konzepte in der Schulpädagogik
- Voraussetzungen und Notwendigkeit einer ganzheitlichen Schulpädagogik
- Prinzipien und Kategorien der pädagogischen Ganzheitlichkeit
- »Dreifaches Verständnis von Ganzheit« – Ganzheit des Subjekts, des Objekts (Welt) und der Werte (Erkenntnis, Wille und Handlung)
- Subjektbezogene bzw. personale Ganzheit
- Objektbezogene Ganzheit
- Werte- und handlungsbezogene Ganzheit
- Theologisch-anthropologische und religionspädagogische Implikationen des Begriffs des Herzens im Koran
- Etymologischer Ursprung und lexikalische Bedeutung des Begriffs qalb
- Eigenschaften und Zustände des Herzens im Koran
- Das versiegelte Herz
- Das versiegelte Herz in Beziehung zu den Sinnesorganen und - wahrnehmungen
- Theologisch-anthropologische und religionspädagogische Implikationen
- Die Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den Versen zur Versiegelung des Herzens
- Das kranke Herz
- Etymologischer Ursprung und koranlexikalische Bedeutung des Begriffs maraḍ
- Vers 2:10 – Das kranke Herz des Heuchlers
- Zusammenfassung der theologischen und religionspädagogischen Implikationen
- Allgemeine Definition des Krankseins des Herzens
- Kranksein des Herzens als Hypokrisie aufgrund von Zwiespältigkeit und Eigennützigkeit – Ethisch-moralisch-glaubensbezogene Ebene
- Kranksein des Herzens in Glaubensfragen – Erkenntnis- und glaubensbezogene Ebene
- Kranksein des Herzens als Charaktereigenschaft – Ethisch-moralische Ebene
- Kranksein des Herzens als Handlung – Ethisch-moralische Ebene
- Kranksein des Herzens als emotionaler Zustand
- Das gestillte Herz bzw. das Herz, das Ruhe gefunden hat
- Etymologischer Ursprung und lexikalische Bedeutung des Begriffs iṭminān
- Vers 2:260 – Das Herz Ibrāhīms, das gestillt werden möchte
- Zusammenfassung der theologischen und religionspädagogischen Implikationen
- Zusammenfassung der möglichen Erkenntnisse aus den Ausführungen Elmalılıs
- Zusammenfassung der möglichen Erkenntnisse aus den Ausführungen in Kuran Yolu
- Mit dem Herzen denken, verstehen bzw. Lehren ziehen
- ʿaqala bzw. taʿaqqul
- ḏakara bzw. taḏakkar
- faqaha bzw. tafaqquh
- dabara bzw. tadabbur
- Zusammenfassung der Erkenntnisse zur Beziehung zwischen dem Verstandesvermögen und dem Herzen
- Das gesunde, heile Herz
- Mit dem Herzen zu Gott – Die Herz-Reise-Metapher
- Kommentierte Analyse des Buchs Kitāb šarḥ ʿaǧāʾib al-qalb hinsichtlich pädagogisch-anthropologischer und religionspädagogischer Implikationen
- Historische Bildungsforschung und die religionspädagogische Relevanz der Analyse des Kitāb šarḥ ʿaǧāʾib al-qalb
- Kitāb šarḥ ʿaǧāʾib al-qalb – Das Buch über die Besonderheiten des Herzens (aus Iḥyāʾ ʿulūm ad-Dīn)
- 2.1 Einleitung
- 2.2 »Kapitel 1: Die Bedeutungen von nafs, rūḥ, qalb und ʿaql und der Zweck dieser Bezeichnungen«
- 2.3 »Kapitel 2: Die Heere des Herzens«
- 2.4 »Kapitel 3: Die inneren Armeen des Herzens und ihre Erläuterung«
- 2.5 »Kapitel 4: Die Besonderheiten des Herzens des Menschen«
- 2.6 »Kapitel 5: Eine Darstellung der Sammlung der Eigenschaften des Herzens und ihrer Beispiele«
- 2.7 »Kapitel 6: Die Beschaffenheit des Herzens in Relation zu den Wissensarten«
- 2.8 »Kapitel 7: Der Zustand des Herzens im Verhältnis zu den Wissenschaften: rational, religiös, weltlich und jenseitig«
- 2.9 »Kapitel 8: Der Unterschied zwischen Inspiration (ilhām) und Lernen (taʿallum) und zwischen dem Streben der Sufis zur Enthüllung der Wahrheit und dem Weg der spekulativen Wissenschaftler (an-nuẓẓār)«
- 2.10 »Kapitel 9: Eine Darstellung des Rangunterschieds zwischen den beiden Gruppen anhand eines konkreten Beispiels«
- Erkenntnistheoretische Einordnung der zentralen Erkenntnisse der kommentierten Analyse des Kitāb šarḥ ʿaǧāʾib al-qalb
- Der Begriff des Herzens und seine epistemische Bedeutung in einer islamischen Epistemologie
- Die Symbiose unterschiedlicher Epistemologien als ein Kunstgriff al-Ġazālīs
- Erworbenes Wissen und Gottesnähe – Epistemische und religionspädagogische Herausforderungen
- Über die Beziehung zwischen nafs-Erkenntnis und Gotteserkenntnis
- Eine komparative Analyse der beiden Epistemologien – ʿilm al-muʿāmala und ʿulūm al-mukāšafa
- Komplementäre oder isolierte Epistemologien? – ʿilm al-muʿāmala und ʿulūm al-mukāšafa
- ʿIlm al-muʿāmala: Epistemologische und inhaltliche Zuordnungen im Iḥyāʾ al-ʿulūm ad-dīn
- Besonderheiten, Inhalte und Ziele der ʿulūm al-mukāšafa
- Die beiden Epistemologien im Iḥyāʾ – Kitāb al-ʿilm und Kitāb ʿaǧāʾib al-qalb
- Grundzüge der pädagogisch-anthropologischen Einheit des Menschen und die Prinzipien einer islamischen Religionspädagogik
- Schulpädagogisch relevante Ganzheitsansätze im Kitāb ʿaǧāʾib al-qalb
- Wissenschaftstheoretische Verortung: ʿilm al-muʿāmala (Wissenschaft des rechten Verhaltens)
- Menschenbild-Implikationen im Begriff des Herzens und die Einheit des Menschen
- Elemente der Einheit des Herzens
- Qalb
- Rūḥ
- Nafs
- Aql
- Pädagogisch-anthropologische Grundlegung der Einheit des Menschen
- Synthese bzw. das synthetische (synthetisierende) Selbst
- Habitualität
- Autopoiese
- Spiritualität
- Reziprozität – Merkmal des Menschenbilds und ein religionspädagogisches Prinzip
- Dynamik
- Prinzipien/Grundzüge einer ganzheitlich orientierten islamischen Religionspädagogik
- Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein und Selbstreflexivität
- Sinnhaftigkeit
- Rationalität/Intellektualität
- Verantwortung und Gewissenhaftigkeit
- Theologie
- Gläubige Objektivität
- Integrität
- Religiöse Mündigkeit/Urteilsfähigkeit
- Subjektivität/Individualität
- Symbolik
- Reziprozität – Merkmal des Menschenbilds und ein religionspädagogisches Prinzip
- Performativität
- Anschauung – istibṣār
- Leiblichkeit/Körperlichkeit
- Lebensweltbezug
- Ausblick
- Literatur
Vorwort, Dank und Widmung
Einschneidende Ereignisse im Leben sind oftmals auf Verdichtungen zurückzuführen, die in bestimmten Lebensabschnitten durch das Zusammenwirken von mehreren Faktoren zustande kommen. Das Ereignis selbst, sei es freudig oder auch traurig, wird der Bedeutsamkeit würdig gesehen. Die Wahrnehmung dessen durch Außenstehende ist die augenscheinliche Manifestation lediglich des Ergebnisses und des Hauptakteurs. Versucht man den Prozess zu rekonstruieren, der zu diesem Ereignis geführt hat, so drängt sich seine Geschichte als eine Erzählung auf, in der sich mehrere Mitwirkende zusammenfinden.
Der Rückblick auf die Zeit der Promotion drängt zu einem Vergleich mit einer Reise. Die Vielfalt an Anknüpfungspunkten ließen die Neugier nicht nur wachsen, sondern lenkten sie auch zu weiteren Ufern, an denen man vertiefend verweilte, um dann bereichert immer wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren, der dann nicht immer der gleiche war und von wo aus nun mit einer erweiterten und geschärften Blickweise die Fortsetzung der Reise anstand. Angestoßen durch das Interesse, etwas Grundlegendes zu erarbeiten, bot sich bald die Auseinandersetzung mit dem zentralen Begriff des Herzens, der sich durch seine hohe islamisch religionspädagogische Relevanz als wesentlich bedeutsam erwies. Vom ersten Gedanken bis zur Abgabe und Verteidigung der Arbeit durfte ich mit einer Reihe von Experten intensive Gespräche führen, die mit ihren Einblicken mir erweiterte Perspektiven eröffneten. Für diese Beiträge möchte ich Prof. Tahsin Görgün, Prof. Ömer Türker, Prof. Ekrem Demirli, meinem früheren Erstbetreuer Prof. Bülent Ucar, Dr. Martin Kellner, Prof. Merdan Günes und Taha Tarik Yavuz für ihre unterschiedlichen Beiträge in unterschiedlichen Phasen herzlich danken. Die Reihenfolge der Aufzählung spiegelt teilweise die Chronologie der Gespräche wider. Meinem früheren Zimmerkollegen aus dem IIT, Dr. Hakki Arslan und auch Prof. Muna Tatari möchte ich für die mehrmaligen intensiven Gespräche ganz besonders danken! Ein herzliches Dankeschön verdienen auch die (noch/ damaligen) Promovierenden des religionspädagogischen Doktorandenkolloquiums der AIWG, die ich hier in alphabetischer Reihenfolge der Vornamen nennen möchte. Auch von ihren bereichernden Feedbacks habe ich profitiert: Amina Boumaaiz, Canan Balaban, Deborah Grün, Erkan Binici, Mehmet Soyhun, Nadire Mustafi, Dr. Selcen Güzel und Süheda Koc. Das Wort Bereicherung in Zusammenhang mit allgemeiner Sachkunde und analytischer Reflexivität lässt unweigerlich bestimmte Personen in meinem Gedächtnis aufkommen, von denen ich ebenfalls reichlich profitiert habe. Von diesen möchte ich allen voran meinem Bruder Murat Gümüş, meinen langjährigen Kollegen und Freunden Dr. Coşkun Sağlam, Dr. Murat Karacan und Dr. Jens Bakker danken. Danken möchte ich auch meiner Lektorin Sina Nikolajew dafür, dass sie die Arbeit in einen druckreifen Zustand gebracht hat. Ein außerordentlicher, herzlicher Dank gilt jenen wenigen wichtigen Personen – namenlose Freunde! – in meinem Leben, die mich immer wieder spüren lassen haben, dass sie hinter mir stehen, ihnen mein Erfolg so bedeutsam ist wie ihr eigener Erfolg und mir, ob im Privaten oder im Ehrenamt, Lasten abgenommen haben. Ohne sie wäre das Ganze uner-träg-lich.
Er hat seit der ersten Vorstellung meines Vorhabens an diese Arbeit und an das darin schlummernde Potential geglaubt und mich stets motiviert, diese Arbeit alsbald wie möglich zum Abschluss zu bringen. Sein Interesse für das Thema und der stete Austausch waren fördernd, die Intensität seines Nachhakens teilweise demoralisierend und mit Blick auf den Abschluss der Arbeit letztlich jedoch zielführend. Als ein kritischer Geist hat er durch gezielte Fragen die Weiterentwicklung der Arbeit vorangetrieben. Aus diesen und vielen weiteren Gründen gebührt meinem Erstbetreuer, Prof. Rauf Ceylan, ein besonders großer Dank. Ebenso überzeugt von der Bedeutsamkeit des Themas schloss sich mein Zweitgutachter, Prof. Egon Spiegel, der Betreuung dieser Arbeit an. Für die Aufwände, die er im Rahmen der Begleitung der Arbeit auf sich nahm, und für seinen Blick allen voran bezüglich der interreligiösen Anschlussfähigkeit der Arbeit, bin ich ihm sehr dankbar.
Der Dank, den ich mit Worten nicht gebührend ausdrücken kann, gilt meiner Familie: meinen Eltern, meiner Frau Rabia, meiner Tochter Munise und meinen Söhnen Haris Duha sowie Ahmed Said. Ihnen möchte ich für ihre Geduld danken und mich für die entbehrungsreiche Zeit aufgrund der Mehrbelastung entschuldigen. In vielen Bereichen des Familienlebens mussten sie die Lücke schließen, die ich offenließ, während ich gleichzeitig Kraft und Energie aus ihrer Wärme schöpfte. Vielen herzlichen Dank für alles. Möge unser Schöpfer diese Arbeit und mein Wirken als eine unmittelbare Folge dieser Arbeit Seinem Willen entsprechend dem Guten, Nützlichen und Richtigen dienlich machen und meine Familie an den Erträgen teilhaben lassen. Amin.
Gewidmet sei die Arbeit meinem Vater und meiner Mutter. Sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihre Kinder auf beste Art und Weise herangezogen und auf die Gesellschaft und das Leben vorbereitet; und zwar mit Werten wie Vertrauen, Hingabe und Würde. Beide sind in der Endphase meiner Dissertation zu ihrem Schöpfer gegangen. Meine Mutter sogar etwa eine Woche nach meiner Disputation. Die Lücke, die sie in meinem Leben und in meiner Gefühlswelt hinterlassen haben, ist unbeschreiblich groß. Ihre Stimmen, Sprüche und Worte hallen noch in meinen Ohren, ihre typischen Gesten und Haltungen sind erwärmende Erinnerungen, die ich immer wieder gerne abrufe, um mit ihnen kurze Momente in meinem Alltag zu verbringen. Ich vermisse sie sehr. Sie wären, glaube ich, am stolzesten auf meinen Doktortitel gewesen.
Darüber hinaus sei dieses Werk meiner Schwester Gülseren gewidmet. Diese schwerbehinderte Frau, die nie mehr als 23 kg wog und Erwartungen der Mediziner zufolge eigentlich hätte nicht länger als 10–12 Jahre leben sollen, doch in den 40 Lebensjahren, in denen wir die Art ihres Verweilens auf dieser Erde bewundern durften, gute Werke vollbracht hat. Sie konnte diese Werke aber auch nur deshalb vollbringen, weil sie schwerbehindert war. Denn sie wollte Zeichen setzen; und zwar nicht nur jenes Zeichen, dass es keine Hindernisse gibt, mit jenen Möglichkeiten sich für das Gute einzubringen, die einem gerade zur Verfügung stehen, sondern auch das Zeichen, dass auch Hindernisse Möglichkeiten darstellen, mittels derer man Gutes bewerkstelligen kann und sollte - teilweise sogar mit viel mehr Wirkung, so wie es bei ihr der Fall war. Ich habe es ihr, glaube ich, nie persönlich gesagt und möchte es deshalb hiermit schriftlich festhalten: Ich bin unheimlich stolz auf dich, Gülseren. Möge Allah dich für deine Werke reichlich belohnen.
Duisburg, 5. Juni 2024
Einleitung
1. Einführende Bemerkungen zur Gliederung
Muslimische Kinder und Jugendliche sowie muslimische Familien insgesamt erfahren seit den 1970er Jahren in Deutschland ihre religiöse Persönlichkeitsbildung in Moscheegemeinden. Damit blickt diese Säule der Islamischen Religionspädagogik auf eine nahezu vierzigjährige Historie zurück, die wichtige Erfahrungswerte für diese außerfamiliäre Institution liefert. Der schulische Islamische Religionsunterricht dagegen ist ein relativ neues Feld in der Religionspädagogik, das seit Ende der 1990er bzw. zu Beginn der 2000er Jahre von der Politik eingeleitet wurde. In Form von Schulversuchen ist dieser Unterricht in mehreren Bundesländern eingeführt und wie in Niedersachsen zunehmend in ein ordentliches Fach überführt worden. Die wissenschaftliche Konzeption und Reflexion dieses Fachs wird dabei von den neu gegründeten Instituten für Islamische Theologie – konkret durch die dort angesiedelten Professuren für Islamische Religionspädagogik – übernommen. Wie jede neue wissenschaftliche Disziplin steht dieses Fach dabei vor der Herausforderung, dass es zunächst Grundlagenforschung betreiben muss. Zwar hat in der islamischen Historie seit der Verkündung dieser Weltreligion immer religiöse Bildung und Erziehung in Familien und außerfamiliären Institutionen wie Moscheen und Madrasas stattgefunden, allerdings ist die akademische Etablierung des Fachs Religionspädagogik eine moderne Errungenschaft. Im westlichen Kontext haben die Geisteswissenschaften durch die Renaissance und die Reformation wichtige Grundsatzdebatten über die Fundamente ihres jeweiligen Fachs durchlebt. Wissenschaftstheoretische, normativ-philosophische sowie methodische Diskussionen wurden in Gang gesetzt. Die Theologie und die Erziehungswissenschaft – beide wichtige Bezugswissenschaften der Religionspädagogik – haben dabei große Sprünge vollzogen.
Wenn auch in islamisch geprägten Ländern die Islamische Religionspädagogik sich an den Universitäten inzwischen etabliert hat und teilweise auf eine langjährige Auseinandersetzung mit ihren verschiedenen Themenfeldern zurückgreifen kann, so ändert doch dies vor allem mit Blick auf die schulpraktische Dimension und ihre rechtlichen und historisch gewachsenen Rahmenbedingungen kaum etwas daran, dass im Rahmen der Etablierung des Fachs eine ›Vor-Ort-Prägung‹ erforderlich ist. Insofern kann die Islamische Religionspädagogik in Deutschland nicht einfach auf eine Tradition universitärer Lehre und schulischen Unterrichts beispielsweise im arabischen Raum zurückgreifen, die man adaptieren könnte. Sie steht damit vor der Herausforderung, entsprechend den gegebenen Rahmenbedingungen ihren Weg zu finden und zu gehen.
Die Bestrebungen zur Etablierung des Schulfachs Islamischer Religionsunterricht (IRU) haben nicht nur im Bereich der schulpraktischen Umsetzung, sondern inzwischen auch im Bereich der akademischen Auseinandersetzung ein Repertoire entstehen lassen, das diese Arbeit um einen weiteren Ansatz zu bereichern intendiert. Gleichzeitig hat die Islamische Religionspädagogik in Deutschland die Möglichkeit, sich auf einen fruchtbaren Diskurs mit der Christlichen Religionspädagogik einzulassen. Allerdings stellt sich hier die Frage, inwieweit Parallelen zum eigenen Fach bei Themen wie Menschenbild, Offenbarung, religiösen Erziehungszielen und weiteren bestehen. Daher ist die Islamische Religionspädagogik in Deutschland als neues Fach damit konfrontiert, neben der empirischen Aufarbeitung der Gegebenheiten, Erwartungen und Bedürfnisse Grundlagenforschung in der Auseinandersetzung sowohl mit der islamischen als auch mit der christlichen und pädagogisch-philosophischen Wissenschaftstradition zu betreiben.
Die vorliegende Dissertation hat in diesem Kontext das Ziel, sich im Rahmen der historischen Bildungsforschung mit einem besonders wichtigen Quellentext aus der Bildungstradition dahingehend auseinanderzusetzen, dass sie theologisch anthropologische Grundlagen exzerpiert, um auf dieser Grundlage elementare Leitlinien für die Grundlegung eines Entwurfs einer Islamischen Religionspädagogik und ihrer Praxis zu formulieren. Hierzu wird auch der Einfluss der primären islamischen Quelle, des Korans, auf die zu untersuchende theoretische Abhandlung analysiert. So kann als ein erweitertes Ziel dies als ein Beitrag zur Entwicklung einer genuinen wissenschaftlichen Disziplin-Identität gesehen werden, die sich dadurch auszeichnet, dass sie aus dem gegenwärtigen Bedarf mit ihren entsprechenden Herausforderungen heraus eine fruchtbare Auseinandersetzung mit den Quellen sucht. Der Gegenwartsbezug manifestiert sich unter anderem durch das (schul-)pädagogische Prinzip der Ganzheitlichkeit und aus dem Anspruch der Bekenntnisbindung und Authentizität der neuen Disziplin und des neuen Fachs. Ausgehend von der Prämisse, dass der zentrale Begriff des Quellentextes, das ›Herz‹, den Menschen als eine Einheit von unterschiedlichen Dimensionen bezeichnet, der Quellentext eine Abhandlung darstellt, die die pädagogisch-philosophische Theoretisierung der Beziehungen dieser Dimensionen zur wesentlichen Aufgabe hat und diese Dimensionen aus der koranischen Verwendung des Herzensbegriffs herrühren, wird die oben erläuterte Auseinandersetzung unter expliziter Berücksichtigung der Art der Ganzheitlichkeit, die dem Begriff innewohnt, und deren Bestimmung vollzogen. Die Erkenntnisse hinsichtlich des Menschenbildes und der Leitlinien sind gleichsam auch als Ausdrucksformen des ermittelten Ganzheitsverständnisses zu betrachten.
In der Gliederung der Arbeit drückt sich diese Intention folgendermaßen aus: Die Arbeit besteht aus vier Hauptbereichen, die in sich in mehrere Kapitel und Unterkapitel unterteilt sind. Im ersten Teil der Arbeit steht die (schul-)pädagogische Ganzheitlichkeit im Mittelpunkt der Betrachtung. Beginnend mit den historischen Wurzeln in der Antike wird die Entwicklung der Forderung nach Ganzheitlichkeit in Theorie und Praxis und deren Formen im deutschen Schulwesen bis in die Gegenwart nachgezeichnet. Unumgänglich steht hierbei die Beziehung zwischen dem Menschenbild und der Bildung und Erziehung des Menschen im Mittelpunkt. Dieses Kapitel zielt darauf ab, die Formen der schulpädagogischen Ganzheitlichkeit mit Blick auf ihre theoretischen Grundlegungen zu kategorisieren. Bereits zuvor wurden unter dem Abschnitt zum Forschungsstand im einleitenden Kapitel die Beziehung zwischen theologischem Menschenbild und Ganzheitlichkeit im christlich religionspädagogisch-praktischen Kontext und die methodisch-didaktische Ausarbeitung der aus dem theologischen wie auch pädagogischen Menschenbild heraus entwickelten Ganzheitlichkeit für den christlichen Religionsunterricht exemplarisch aufgezeigt. Dem voraus gehen zwei Entwürfe, die jeweils unterschiedliche ganzheitliche Ansätze im Zusammenhang mit dem Islamischen Religionsunterricht formulieren, welche analysiert und unter anderem mit Blick auf die bestimmten Formen von Ganzheitlichkeit ausgewertet werden.
Der zweite Abschnitt (B) ist gänzlich der Analyse des Begriffs des Herzens im Koran gewidmet. Hier wird es darum gehen, die unterschiedlichen Verwendungsweisen des Begriffs hinsichtlich der in ihm enthaltenen anthropologischen wie religionspädagogischen Implikationen auszuarbeiten und anhand von Regelmäßigkeiten Strukturen festzuhalten und Kategorien zu bestimmen. Da eine Analyse aller der über 150 Verse im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, wird die Analyse des koranischen Herzensbegriffs mit Blick auf die Eigenschaften des Herzens exemplarisch analysierend und resümierend vorgehen. Die Auswahl der Verse wird entsprechend der exemplarischen Aussagekraft und danach, wie detailliert und andere Verwendungsformen umfassend dieser Vers in der Exegeseliteratur analysiert wird, getroffen, sodass mit der Auswahl nach der ›strategischen‹ Bedeutung und der umfassenden Aussagekraft der Verse die Exemplarität gewährleistet ist. Die Darlegung des Bedeutungsrahmens des Begriffs des Herzens und weiterer Begriffe, die in einem unmittelbaren Bezug zum Herzen stehen, erfolgt zudem anhand von unterschiedlichen historischen Wörterbüchern bzw. Koranwörterbüchern.
Der dritte Abschnitt C stellt die kommentierte Analyse des Quellentextes Kitāb šarḥ ʿaǧāʾib al-qalb von al-Ġazālī dar. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um eine textimmanente Analyse mit dem Ziel der Ausarbeitung der theologisch- wie pädagogisch-anthropologischen Implikationen sowie auch der Prinzipien einer Islamischen Religionspädagogik. Zuvor wird die Relevanz des Werks aus der wissenschaftstheoretischen Perspektive heraus dargelegt, die unter anderem auch die Begründung der gegenwärtigen Auseinandersetzung beinhaltet. Abgeschlossen wird der dritte Abschnitt mit der Vorstellung der beiden Epistemologien im Gesamtwerk für die Wiederbelebung der Religions- wissenschaften.
Im vierten Abschnitt D werden die Erkenntnisse der kommentierten Analyse festgehalten. Zu Beginn werden die Ausführungen im Kitāb šarḥ ʿaǧāʾib al-qalb dahingehend ausgewertet, ob und welche Formen der pädagogischen Ganzheitlichkeit, die im ersten Abschnitt festgehalten wurden, sich in welcher Gewichtung bestimmen lassen. Im Anschluss daran erfolgt eine wissenschaftstheoretische Bestimmung der Epistemologie, die im Kitāb šarḥ ʿaǧāʾib al-qalb theoretisiert wird und die eine wesentliche Bedeutung für die religionspädagogische Grundlagenbestimmung vorweist. Auf dieser Grundlage werden nunmehr die Grundzüge des impliziten theologisch-pädagogischen Menschenbildes und die Leitlinien einer ganzheitlich orientierten Islamischen Religionspädagogik aufgezeigt, die allesamt die Grundlage für eine inhaltliche wie methodische weiterführende Auseinandersetzung im Rahmen des schulischen wie auch gemeindlichen Religionsunterrichts darstellen sollen.
2. Forschungsstand
2.1 Menschenbild und Ganzheitlichkeit in der Religionspädagogik
2.1.1 Die Frage nach der Normativität von Menschenbildern in der Pädagogik
Aussagen zur Stellung von Menschenbildern in der Pädagogik wie z. B., dass »alles erzieherische Handeln und Geschehen eine irgendwie geartete anthropologische Dimension«1 impliziert, oder Feststellungen wie die, dass Bemühungen um eine Definition des Begriffs Mensch (so Schumann) unschwer erkennen lassen, dass die Grenze zwischen Deskription und normativem Anspruch fließend ist, und drittens die Antwort nach der Frage, was den Menschen ausmacht, unumgänglich in die Frage mündet, wie der Mensch sein sollte,2 verdichten sich allesamt im folgenden Prinzip: Das Menschenbild, sei es explizit oder implizit, bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt, ist ein konstitutiver und grundlegender Aspekt jeglicher erziehungswissenschaftlichen Reflexion. Hamann spricht dem erziehungswissenschaftlichen Fachbegriff Menschenbild grundlegendes Mitbestimmungsrecht in Theorie und Praxis zu, allerdings mit der wichtigen Einschränkung, dass es keine
weltanschaulich, politisch oder sonstwie konstruierte Setzung oder Normvorstellung vom Menschen [vorgeben], sondern dem Wissensstand entsprechende begründete Aussagen vom Menschen (bezüglich humaner Existenz, menschlicher Eigenart und universaler (Bestimmung) [treffen darf],
sodass dem Menschenbild zwar ein Anspruch bezüglich der Bestimmung der Ziele und Methoden des Bildens und Erziehens zugesprochen wird, dieser Anspruch jedoch mit der empirischen bzw. naturwissenschaftlichen Fundierung einhergehen soll.3 Doch liegen auch Gegenpositionen vor wie die von Meinberg, der sich »gegen eine sozialwissenschaftlich orientierte Pädagogik« ausspricht und dies damit begründet, dass den Erziehungswissenschaften als eine Erkenntnis produzierende Disziplin die »wissenschaftliche Ergründung der Erziehungswissenschaft« zufalle.4 Meinberg erachtet die Bezüge anderer Disziplinen als reduktionistisch und verweist mit der Forderung nach Ganzheitlichkeit in der philosophischen Anthropologie, die die »personale Lebenseinheit« einfordert und »rückhaltlos für die Idee des ›ganzen Menschen‹ eintritt«, auf einen Anspruch, dem andere Disziplinen nachzukommen haben.5 Es wird deutlich – wenn auch inhaltlich nicht geklärt –, dass Meinberg elementaristische, sprich: nicht ganzheitliche Konzepte als nicht aussagekräftig erachtet. Als Gegenposition zu Meinberg bietet sich der Ansatz von Marie-Anne Berr an. Berr spricht sich für das kybernetische Menschmodell und damit für die Aufhebung der »Differenz zwischen Mensch und Maschine« aus, wonach »die materielle Welt [… bzw.] die Körper-Funktionen zum Gegenstand operationalisierender Verfahren« wird bzw. werden, was Kühnle mit den Worten »kybernetisch-systemtheoretisches Automatenmodell des Menschen« kritisch begutachtet.6
Als ein entgegengesetztes Konzept kann der Ansatz aus der pädagogischen Anthropologie von Christoph Wulf als ein pluralistischer Ansatz erachtet werden, der – ausgehend davon, dass der Mensch nicht voll umfänglich und schon gar nicht nur durch eine Disziplin ergründbar und dessen Erschließung mittels »geschlossener anthropologischer Systeme und ganzheitlicher Deutungen«7 nicht zeitgemäß ist – von einem einschränkenden »Gesamtbild des Menschen«8 absieht. Wulf plädiert für »die Erzeugung pluralen anthropologischen Wissens«; mit anderen Worten für zusammengetragene Erkenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen, die (mit Blick auf den wissenschaftlichen Erkenntnisstand) relevant, schlüssig und kompatibel sind. Es geht ihm dabei nicht darum, ein Patchwork-Menschenbild zu konstruieren, sondern mehrere Ansätze, die ggf. sich ergänzen oder entgegenstehen, nebeneinander stehen zu lassen.9 Der Ansatz von Wulf ist demzufolge offen, doch andererseits auch nicht darauf fokussiert, die einzelnen Erkenntnisse in einer Gesamtheit verstehen zu wollen, und widersetzt sich demzufolge teleologischen Deutungen und metaphysischen respektive theologischen Sinnzuweisungen. Dies unterliegt seinem grundlegenden Verständnis der Pädagogischen Anthropologie, die Wulf als eine Bezugswissenschaft ohne praktischen Bezug versteht. Sie gebe kein »geschlossenes normatives Wissenssystem« her. Akteure, die in einem pädagogischen Theorie-Praxis-Dualismus agierten, verfügten über ein gewisses implizit normatives Menschenbild, »ohne das der eine nicht wissenschaftlich arbeiten und der andere nicht praktisch handeln kann«. Die Aufgabe der Pädagogischen Anthropologie liege nun darin, dieses implizite und unbewusste Wissen hervorzubringen und bewusst zu machen, damit es ggf. »reflektiert und verändert werden« könne.10 Der Ansatz von Wulf ist aufgrund seiner pluralistischen Offenheit zu würdigen, jedoch auch dahingehend zu korrigieren, dass metaphysische Ansätze und Deutungsversuche nicht grundsätzlich einschränkend sein müssen bzw. auch bei einer normativ deterministischen Ausrichtung als Bereicherung erachtet werden können. Gerade in »einer im metaphysischen Rahmen argumentierenden Pädagogik«11 – wozu auch der pädagogisch- anthropologische Ansatz einer Religionspädagogik gezählt werden kann – ist die Auseinandersetzung mit dem Menschenbild unumgänglich. In einer derart begründeten Pädagogik erhalten Geburt und Tod »als von Ewigkeit her determinierte Durchgangsstadien zur wahren Existenz« eine ontologische Bedeutung zugewiesen, die sich letztlich auf alle Ebenen des Lebens und der Bildung und Erziehung erstreckt und dort sich widerspiegelt. Zirfas weist in diesem Zusammenhang exemplarisch auf Comeniusʼ Formulierung hin, wonach die Welt den Ort und das Leben die Zeit der Erziehung und Bildung darstellt.12
2.1.2 Menschbild in der Religionspädagogik
So wie jedwede pädagogische Theorie und Praxis implizit oder gar explizit auf einer anthropologischen Grundlage fußt, so liegt auch jeder religionspädagogischen Theorie und Praxis unter anderem in direktem Zusammenhang mit dem Gottesbild und der Beziehung Gott-Mensch eine theologisch anthropologische (und folgerichtig eine pädagogisch-anthropologische) Begründung zugrunde,13 deren Gestaltung am Beispiel der Ausführungen Boschkis dargelegt werden soll. Die Auswahl Boschkis geht aus der Annahme hervor, dass seine Verortung der Bedeutung des Menschenbilds übertragbar ist auf das zu erschließende Menschenbild in dem zu untersuchenden Text von al-Ġazālī.
Boschki sieht die theologisch-anthropologische Verortung mit Blick auf die religionspädagogische Methodik als eine Art Vorphase an, die er als Orientieren bezeichnet und dem Drei-Schritt Sehen – Urteilen – Handeln vorsetzt. Somit stellt die theologische Anthropologie ein wesentliches Fundament der religionspädagogischen Theorie wie auch des Religionsunterrichts und einen bestimmenden Ausgangspunkt der Unterrichtsplanung und -praxis dar, was unter anderem mit den Worten »systemisch-theologische[n] Vergewisserungen [als …] Voraussetzung für Handlungskompetenz im Feld religiöser Erziehung und Bildung«14 entsprechend hervorgehoben wird.15 Im Kapitel über Anthropologische Entwürfe von Erziehung weisen Dörpinghaus/Uphoff genau auf diese Vorphase hin, wobei es sich bei ihnen nicht zwingend um einen bewussten Akt des Orientierens handeln muss, sondern lediglich um die Übernahme von »Auffassungen von Mensch und Welt«, die in dem Verständnis von Erziehung »vorreflexiv« vorgeben, »was erzieherisch in den Blick geraten« soll und welche »normativen Annahmen« und »impliziten Anthropologeme« maßgeblich sein sollen.16 Anders ausgedrückt handelt es sich dabei um eine perspektivische Grundlage, auf der und rückbezüglich auf sie theoretische wie auch praktische Prozesse vollzogen werden sollen.
In Anlehnung an diese Grundprämisse hinsichtlich der elementaren theologisch-anthropologischen Grundlage der Religionspädagogik führt Boschki einige wichtige Annahmen theologisch-anthropologischer Art von wichtigen Vertretern der Theologie und Religionspädagogik an, die den wesentlichen Charakter des Menschenbildes für die religionspädagogische Theorie und Praxis exemplarisch exponieren sollen. Boschki folgert aus dem christlichen Menschenbild die konstitutive Annahme, dass der Mensch ein »Beziehungswesen« ist, das zu Gott in Beziehung steht, da ihm jene Eigenschaft Gottes vorausgeht, nach der er »in Beziehung« steht. Nach Metz sei der Mensch demnach »gottbegabt« und in Anlehnung an Rahner bezeichnet er den Menschen gemäß dieser göttlichen Eigenschaft als »Wesen der Transzendenz«, womit die menschliche Art der Beziehungsmöglichkeit festgehalten wird. Die Religion erhält in dieser theologisch-anthropologischen Begründung der religiösen Bildung und Erziehung die Stellung des Mittels der Beziehung, wonach ihr aufgrund der »Kreatürlichkeit« und somit grundsätzlichen Unterschiedlichkeit und Abhängigkeit des Menschen von Gott die Möglichkeit der wortwörtlichen »›Rückbindung‹ an Gott« gewährleistet sei. Die Beziehung zu Gott durch die Religion und der Ausgang aus der eigenen Gottesbegabung, so Boschki, münde beim Menschen in die Selbsterkenntnis (Selbstentdeckung) und die eigene Identität.17
Als Konsequenz dieser Beziehungskonstellation und Kausalität formuliert Boschki als konstitutiven Zweck religionspädagogischen Handelns die Aufgabe, dass der Mensch »durch Impulse aus religiösen Lehr- und Lernprozessen für diese Gottesbegabung sensibilisiert werden« könne bzw. solle, sodass »[r]eligiöse Erziehung […] nicht etwas Fremdes in den Menschen einpflanzen, sondern dem Menschen zu seiner Bestimmung, seiner Identität verhelfen« vermöge – womit die Rückbezüglichkeit zum Menschenbild wieder gewährleistet wäre. Das Menschenbild als anthropologische Vorgabe und Orientierung zieht sich durch alle Ebenen des religionspädagogischen Handelns
Religionspädagogisches Handeln begleitet und unterstützt [… den Menschen], Gottes Beziehungswirklichkeit zu erfassen und für sich, in seinem Leben zu ›realisieren‹.[...]18
Gottes Schöpfung und Offenbarung [Gottes ›Wort‹] gehen jeder menschlichen Aktivität voraus, die Reaktion des Menschen darauf aber ist dessen eigener Entscheidung überlassen [menschliche ›Antwort‹]. Katechese [und Religionspädagogik] stimulieren und stärken die Fähigkeit zur Antwort auf Gottes Wort.19
2.2 Theologische Anthropologie und Islamische Religionspädagogik
Bildungs- und Erziehungskonzepte haben stets einen unmittelbaren Bezug zum Menschenbild; so auch bzw. erst recht im religionspädagogischen Kontext. Nicht selten wird in diesem Zusammenhang auf die unterschiedlichen Facetten des Kindes bzw. des Menschseins und daran geknüpft auf die Ganzheit des Menschen hingewiesen bzw. von dieser ausgegangen. Dass im islamisch religionspädagogischen Zusammenhang dann auch noch das Herz in dieses Konzept eingebettet wird, ist eher in mystischen Abhandlungen und Praktiken anzutreffen, da das Herz im gängigen Gebrauch eher dem mystischen und demnach dem irrational spirituellen Bereich zugeschrieben wird. In akademischen Beiträgen mit Vorgaben für die schulpädagogische Praxis ist der Begriff des Herzens kaum bzw. nur beiläufig und in Bezug zum Spirituellen und Emotionalen von Relevanz. Ein Überblick über die wissenschaftlichen Arbeiten der letzten Jahre legt vor Augen, dass die Beziehung zwischen islamtheologisch anthropologischen Grundlagen und allen voran der schulpädagogischen Praxis trotz ihrer grundlegenden Bedeutung nur beiläufig und oftmals lediglich durch Hinweise auf selektive Koranpassagen aufgegriffen wird; so auch im Kerncurriculum für die Sekundarstufe I des Landes NRW, worin die Würde und Verantwortung der Menschen als Geschöpfe Gottes als ein Menschenbild auf bestimmte Koranverse zurückgeführt wird.20
Allen voran Harry Harun Behr, Zekirija Sejdini und Fahimah Ulfat widmen sich ausführlicher und mit Bezug zur gegenwärtigen Verwertbarkeit in der Religionspädagogik der Beziehung zwischen theologischem Menschenbild und der pädagogischen Relevanz dessen. Hinsichtlich der Ausarbeitung der historischen Entwürfe von Bildungs- und Erziehungsvorstellungen und ihrer impliziten Menschenbilder stechen insbesondere die Beiträge von Sebastian Günther hervor, die unter anderem auch die historische Grundlage für die deskriptive und wenig detaillierte Aufarbeitung des Beitrags21 von Ulfat darstellt. Ulfat hält fest, dass das theologisch anthropologische Konzept, das im Wesentlichen auf drei Begriffen basiert, »für die moderne islamische Religionspädagogik wichtige Impulse setzen kann«. Dieses Konzept basiert auf den Begriffen fiṭra, die sie in Anlehnung an Behr als ein Ausdruck für die ›Religionsbedürftigkeit‹ und ›Religionsfähigkeit‹ und in Anlehnung an eine Vielzahl muslimischer Theologen als das vorausgesetzte »Wissen um die Existenz Gottes als angeborener Teil der menschlichen Natur« bezeichnet,22 al-insān al-kāmil, das »das spirituelle, ethische und moralische Idealbild des Menschen« bezeichnet, und tazkīya, die »Kultivierung des Selbst«, die die charakterliche Vervollkommnung durch Läuterung bezeichnet und für die Vorgehensweise steht, mittels dieser die Ausgangsdisposition (fiṭra) zum Idealbild (al-insān al-kāmil) geführt werden soll.23 Ihre Ausführungen münden mit Blick auf die religionspädagogische Essenz in die wesentliche Feststellung, dass »Bildung aus einer islamischanthropologischen Perspektive als Förderung und Anregung der Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung der intellektuellen, sozialen und spirituellen Fähigkeiten und Potenziale des Menschen angesehen werden« kann.
Details
- Pages
- 380
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631925058
- ISBN (ePUB)
- 9783631925065
- ISBN (Hardcover)
- 9783631925041
- DOI
- 10.3726/b22229
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (November)
- Keywords
- Didaktik Religionsunterricht Islamunterricht Aristoteles Menschenbild Anthropologie Holismus Ganzheitlichkeit Ganzheit Religion Theologie Bildung Religionspädagogik islamische Philosophie Iḥyāʾ Koran qalb Herz al-Gazālī
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 380 S., 5 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG