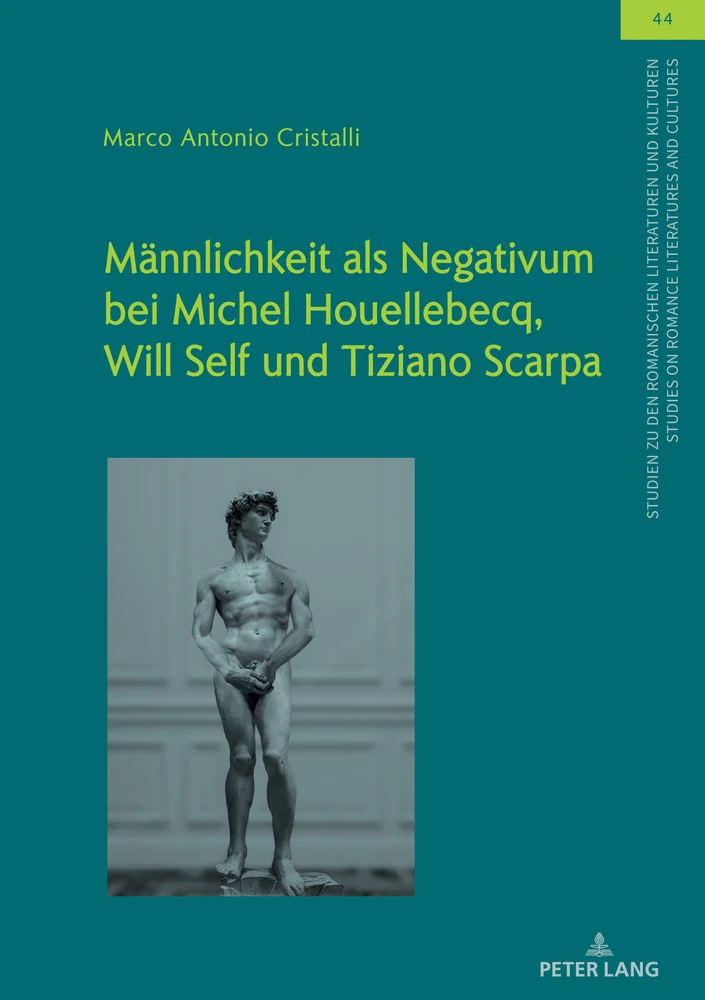Männlichkeit als Negativum bei Michel Houellebecq, Will Self und Tiziano Scarpa
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Dedication
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Methoden und kultureller Kontext
- 2. Die Unbeständigkeit des Mannseins – Einführung in das Forschungsfeld
- 2.1. Grundlagen der Männlichkeitsforschung
- 2.2. Ansätze der Männlichkeitsforschung
- 2.2.1. Rollenmodell
- 2.2.2. Interaktion und Performativität
- 2.2.3. Hegemoniale Männlichkeit und männlicher Habitus
- 2.3. Überlegungen zu einer Methodik des männlichkeitssensiblen close reading
- 2.3.1. Reflektionen über eine männlichkeitssensible Literaturwissenschaft
- 2.3.2. Männlichkeitssensibles close reading
- 2.3.2.1. Snapshots of masculinity als Kristallisationspunkt von Männlichkeit im Text
- 2.3.2.2. Vielgestaltigkeit und Relationalität
- 2.3.2.3. Narrative der Männlichkeit
- 2.3.2.4. Der männliche Körper
- 3. Das kulturelle Feld: Männlichkeit als Negativum in der Postmoderne
- 3.1. Männer ohne Grenzen? Historischer Überblick
- 3.2. Die Gefahr der „Männlichkeit“ – Männlichkeit als Negativum
- Textanalysen
- 4. Männlichkeit als neoliberales Wirtschaftssystem? Michel Houellebecqs düstere Betrachtung postmoderner Männlichkeit
- 4.1. Michel Houellebecqs Trilogie der Männlichkeit
- 4.2. Houellebecqs Thesen zum Zustand von Männlichkeit im 20. Jahrhundert
- 4.3. Die Einsamkeit eines Mannes: Extension du domaine de la lutte
- 4.3.1. Der Ich-Erzähler als Zeitdiagnose von Männlichkeit in der Postmoderne
- 4.3.2. Unter Männern: männliche Hierarchien in EDL
- 4.3.3. Körper und Gewalt
- 4.3.3.1. Der um Männlichkeit betrügende Körper
- 4.3.3.2. Gewalt als Sex-Ersatz?
- 4.4. Die Söhne der sexuellen Revolution: Les Particules élémentaires
- 4.4.1. Ausgangssituation
- 4.4.2. Zwei ungleiche Brüder als Exempel für den Wandel von Männlichkeit
- 4.4.2.1. Das Ende des Königreichs der Männlichkeit
- 4.4.2.2. Der übersexualisierte Mann: Bruno
- 4.4.2.3. Der entsexualisierte Mann: Michel
- 4.4.3. Michels Ende – oder das Ende des Mannes oder des Menschen?
- 4.5. Sex-Tourismus als männliche Utopie? – Plateforme
- 4.5.1. Ausgangssituation
- 4.5.2. Michel und Valérie: Liebe als Erlösung der männlichen souffrance
- 4.5.2.1. Michel als weiterer Prototyp von postmoderner Männlichkeit
- 4.5.2.2. Erfüllung in der Beziehung zu Valérie
- 4.5.3. Sex-Tourismus als Antwort auf die Erweiterung der Kampfzone
- 4.5.3.1. Die Freier-Figuren
- 4.5.3.2. Sex-Tourismus als Zeitdiagnose
- 4.5.4. Das Ende des Paradieses – der Terroranschlag
- 4.5.4.1. Islamismus als Ausdruck einer Männlichkeitskrise
- 4.5.4.2. Das verlorene Glück
- 4.6. Zwischenfazit: Männlichkeit bei Houellebecq
- 5. Will Self und die Metamorphosen der Männlichkeit in der britischen Literatur der 1990er-Jahre
- 5.1. Frauen, Bier und Fußball: lad culture und lad lit
- 5.2. Will Self – Beobachter des Wahnsinns der Gegenwart
- 5.2.1. Einführung in sein Werk
- 5.3. Cock and Bull
- 5.3.1. Ausgangssituation
- 5.3.2. „Cock – A Novelette“
- 5.3.2.1. Carol – sexuelle Frustration und körperliche Wandlung
- 5.3.2.2. Nutzlose Männer: Dan und Dave 2
- 5.3.2.3. Rahmenhandlung
- 5.3.3. „Bull: A Farce“
- 5.3.3.1. „A man’s man“ – John Bull
- 5.3.3.2. Eine verhängnisvolle Affäre – Bull und Alan Margoulies
- 5.3.3.3. Eine neue Form von Männlichkeit? Bulls duale Natur
- 6. Flüssige Männlichkeiten? Männlichkeit bei Tiziano Scarpa
- 6.1. Verhandlungen von Männlichkeit bei den Autoren der Gioventù Cannibale
- 6.2. Den Mann sezieren: Tiziano Scarpa und seine flüssigen Darstellungen von Männlichkeit
- 6.2.1. Einführung in das Werk
- 6.3. Occhi sulla graticola
- 6.3.1. Ausgangssituation
- 6.3.2. Alfredo
- 6.3.3. Alfredos Studien: Fabrizio und Giampaolo oder Sperma als Reflexionsobjekt von Männlichkeit
- 6.3.4. Die Rache der Frau: Carolina
- 6.4. Kamikaze d’Occidente
- 6.4.1. Ausgangssituation
- 6.4.2. „Just a Gigolo“ – Prostitution und Körper
- 6.4.3. Die Selbstzerstörung des Westens
- 6.5. Erzählungen
- 7. Fazit
- 8. Bibliographie
- Reihenübersicht
Abkürzungsverzeichnis
Werke von Michel Houellebecq:
- EDL
- Extension du domaine de la lute
- PE
- Les Particules élémentaires
- PF
- Plateforme
Werke von Tiziano Scarpa
- OG
- Occhi sulla graticola
- KO
- Kamikaze d’Occidente
Werke von Will Self
1. Einleitung
I need a hero
Where have all the good men gone
(…)
Isn’t there a white knight upon a fiery steed
Late at night, I toss and I turn
And I dream of what I need
I need a hero
I’m holding out for a hero ‘til the end of the night
He’s gotta be strong, and he’s gotta be fast
And he’s gotta be fresh from the fight
(Bonnie Tyler)1
In dem 1984 veröffentlichen Song „Holding Out for a Hero“ der britischen Sängerin Bonnie Tyler wartet das lyrische Ich, eine klassische „Jungfrau in Nöten“, voller Sehnsucht auf die Rettung durch einen wahren Helden, einen wahren Mann. Sei es nun der Halbgott Herkules, sei es Superman oder sei es der weiße Ritter in seiner strahlenden Rüstung, der insbesondere in dem zugehörigen Musikvideo äußerst eindrucksvoll in Szene gesetzt wird – alle verkörpern eine ideale, nahezu perfekte Männlichkeit, die zwar fiktiv und surreal bleibt, aber dennoch über eine enorme Wirkungsmacht verfügt und bis heute bestimmte Vorstellungen der Frage prägt, was einem Mann zu einem Mann macht. Der vom lyrischen Ich beschriebene Mann und seine Männlichkeit scheinen über einen sublimen Charakter zu verfügen, was sich vor allem in der hochinteressanten Gleichstellung von Gott, Held und Mann zeigt, da diese Begriffe synonym verwendet werden. Insbesondere der Figurentypus des Helden wird dabei zu einer Verkörperung von perfekter und somit positiver Maskulinität. Die ihm zugeschriebenen Eigenschaften entscheiden dabei nicht nur, wie er seine Männlichkeit performativ in Szene setzt, sondern sie sind auch die Grundlage für die Bewertung, ob er als wahrer Held und somit zugleich als wahrer Mann wahrgenommen wird oder nicht. Diese Eigenschaften – in diesem Fall passender: Tugenden – sind sicherlich nicht grundsätzlich männlich markiert, werden aber in Folge einer patriarchalen Kultur und Heldentradition vorrangig dem männlichen Geschlecht zugeschrieben. Eine Betrachtung diesbezüglich illustriert, dass sich jene Helden vor allem dadurch auszeichnen, das Gemeinwohl über das individuelle beziehungsweise persönliche, eigene Wohl zu stellen. Es handelt sich somit um Tugenden wie Tapferkeit, Mut, Kampfgeist, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinsinn, Stärke, Opferbereitschaft und Entschlossenheit, sie sich oftmals im Äußeren des Helden widerspiegeln, der traditionell außerordentlich schön ist.
„Holding Out for A Hero“ kann auf den ersten Blick als ein gewöhnlicher Popsong der 1980er-Jahre gedeutet werden, der männliche Tugenden und traditionelle Geschlechterverhältnisse – der Mann als Retter, die Frau als Gerettete – in Szene setzt. Dies wird dem Lied jedoch auf keiner Ebene gerecht. Die zentrale Aussage dieses Lieds ist nämlich die von dem lyrischen Ich gleich zu Beginn gestellte Frage, die das den Ausgangspunkt dieser Studie darstellt: die Verhandlung von Männlichkeit in der postmodernen Literatur. Die Frage lautet: „Where have all the good men gone?“ Die Art, wie diese Frage formuliert ist, zeigt uns, dass sich Bonnie Tylers wohl bekanntester Song innerhalb einer bestimmten Literaturtradition ansiedeln lässt, denn er rekurriert auf den aus dem Mittalter stammenden, aber auch in anderen Epochen auftauchenden Topos des „Ubi sunt.“ Auf diesen Topos wird vor allem dann zurückgegriffen, wenn auf gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen hingewiesen werden soll. Dabei beschreibt dieser nicht nur an erster Stelle die Vergänglichkeit bestimmter Phänomene, sondern stellt ebenso einen Ausdruck von Nostalgie und Verklärung der vermeintlich besseren Vergangenheit dar. Während sich das „Ubi sunt“ des französischen Renaissance-Dichters François Villons in seiner „Ballade des dames du temps jadis“ noch an die edlen Frauen der Antike richtet („Mais où sont les neiges d’antan?“), besingt das lyrische Ich in „Holding Out For a Hero“ 1984 nun die heldenhaften Männer, die scheinbar nicht mehr Teil ihrer Gegenwart und Gesellschaft sind. Gerade Erzeugnisse aus der Populärkultur erweisen sich oft als Gradmesser von Gegenwartsphänomenen und führen dadurch Zeitdiagnosen durch. Dies wird in diesem Fall durch die Verwendung des „Ubi sunt“-Topos mehr als deutlich, was zu unserer ersten Schlussfolgerung führt: Der Mann und seine Männlichkeit befinden sich in einem extremen Wandlungsprozess, da sich dessen Wesen völlig verändert hat. Dabei darf die ursprünglich enge Verknüpfung zwischen Männlichkeit und Tugendhaftigkeit nicht vergessen werden, wie sie am Beispiel des Lateinischen deutlich wird, wo die Tugend (virtus) direkt etymologisch vom Mann (vir) abgeleitet wird. Tugend- und Mannhaftigkeit sind dort dasselbe oder zumindest stark miteinander verzweigt, was nun, in den 1980er-Jahren und auch heute, nicht mehr der Fall zu sein scheint. Eine Konzeption von Männlichkeit, die den Mann mit dem Helden und das Männliche mit dem Heroischen gleichsetzt, scheint der Vergangenheit anzugehören, weswegen das lyrische Ich diese nostalgisch beweint und sich nach einer Männlichkeit zurücksehnt, die sich durch die eben genannten Eigenschaften konstituiert. Der Halbgott oder edle Ritter gehört der Vergangenheit an. Aufbauend auf dieser Feststellung ergibt sich hier zunächst die entscheidende Frage, wie Männlichkeit sich stattdessen in der Postmoderne konstituiert: Was bleibt vom Mann und seiner Männlichkeit übrig, wenn diese sich nicht mehr an ehemals zentralen heroischen Eigenschafen orientiert?
Ein Blick in die Presse, Populärwissenschaft, Populärkultur und die gerade in den letzten 20 Jahren immer üppigere Ratgeberliteratur2 gibt darauf eine erste Antwort, die einen wenig optimistischen Ausblick auf Männer und Männlichkeit gibt: Der Mann ist ein Problemfall und Konzepte wie „toxische Männlichkeit“ sind längst zentrale Topoi der Gegenwartsbeschreibung der letzten 40 Jahre geworden. In Gleichklang mit diesen erscheint die ebenfalls omnipräsente „Krise der Männlichkeit“, in deren Zusammenhang die bereits erwähnte Frage „Wann ist ein Mann ein Mann?“ in aller Regelmäßigkeit gestellt wird. Es lässt sich daher ein sehr reger Diskussionsbedarf erkennen, der sehr verschiedene Diskurse, angefangen bei Feminismus, Maskulinismus, über Männer- und Väterrechtler bis hin zu Vertretern einer neuen Männlichkeit aufeinandertreffen lässt. Es ist dabei jedoch zu betonen, dass die „Krise der Männlichkeit“ ein Topos ist, der aus historischer Perspektive in regelmäßigen Abständen aufgegriffen wird, weswegen es grundlegend falsch wäre, diesen als spezifisch für das Ende des 20. Jahrhunderts beziehungsweise das beginnende 21. Jahrhundert zu definieren. Die heutigen Debatten werden vielmehr von der starken Instabilität und der Polymorphie sowie der Pluralität von Männlichkeiten ab den 1980er-Jahren3 ausgelöst. Diese werden zusätzlich von einem Diskurs bezüglich der Negativität von Männlichkeit begleitet, der schließlich zum Politikum wird. Männlichkeit erregt die Gemüter. Sie provoziert, sie schockiert, sie skandalisiert. Sie ist nicht heldenhaft, sondern ein Gegenstand moralischer Normverstöße.
Der politische Diskurs, in dem Männlichkeit und Mannsein zu einem fast alltäglichen Gegenstand geworden sind, zeigt dies eindrücklich. Wobei hier, was in der Literatur- und Kulturwissenschaft zu selten geschieht, auf die Perspektivierung geachtet werden muss. Eine fehlgeleitete und negative Männlichkeit gilt – nicht zu Unrecht – im politisch linksliberalen oder globalistischen Lager als zentraler Auslöser für die Krisen unserer Zeit: Sei es das Erstarken der Neuen Rechten, #MeToo, Brexit, Klimawandel, islamistischer Terrorismus oder die Attentate in Colombine und auf der norwegischen Insel Utøya. Der britische Soziologe Anthony Giddens kommt daher schon Anfang der 1990er zu dem Schluss, dass weder Kriminalität noch Gewalt die größte Bedrohung für eine Gesellschaft darstellen, sondern der Mann und seine fehlgeleitete Männlichkeit.4 Im politischen entgegengerichteten Lager mag es auf den ersten Blick anders aussehen, aber auch hier steht die Frage nach dem Männlichen im Vordergrund, wie sich im Rechtspopulismus zeigt, wo Männlichkeit einen zentralen Gegenstand der politischen Kommunikation darstellt. Das betont männliche Gebaren von Politikern wie Matteo Salvini, Nicolas Sarkozy, Björn Höcke, Boris Johnson, Silvio Berlusconi, Viktor Órban oder Wladimir Putin zeigt dies deutlich. Wenn Donald Trump „Make America Great Again“ postuliert, verbirgt sich dahinter auch der Wunsch nach der Re-Etablierung einer archaischen Form von Männlichkeit, die durch den Einfluss der sozialen Bewegungen der 1980er-Jahre vermeintlich verloren gegangen ist und in der Männer jenseits aller Political Correctness noch „echte Männer“ sein können. Es wird evident, wie stark Männlichkeit in alle politischen Lager hin polarisierend wirkt. Was dabei jedoch verloren geht, sind die eben genannten männlichen Tugenden. Während das eine Lager Männlichkeit allein als Negativum betrachtet und selbst mögliche Tugenden als Ausdruck einer bevormundenden patriarchalen Kultur umdeutet, konzentriert sich das andere Lager hingegen allein auf präpotentes, überhebliches und gewaltvolles Verhalten als Wesensmerkmal von Männlichkeit.5 Diese diametral entgegengerichteten Positionen lassen sich, um zu unserem Ausgangspunkt zurückzukehren, bereits in „Holding Out for A Hero“ finden, das auf Interpretationsebene recht offen bleibt, weswegen von einem doppelten „Ubi sunt“ gesprochen werden kann: So zeigt sich in dem Lied einerseits die Sehnsucht nach einer positiven Form von Männlichkeit, da diese in der Gegenwart scheinbar nicht existent ist6, aber zeitgleich auch nach einer „wahren“ Männlichkeit, die sich vor allem durch die Fähigkeit des Kämpfens auszeichnet. Verschiedene Männlichkeitsentwürfe konkurrieren miteinander. Das Gute oder Tugendhafte spielt dabei jedoch keine Rolle mehr. Männlichkeit befindet sich daher in einem enormen Spannungsverhältnis, das über fast schon schizophrene Züge verfügt. Sie befindet sich, wie auch der im Lied genannte Herkules, am Scheideweg zwischen positivem und negativem Verhalten. Männlichkeit ist ein Problemfall, ein Negativum.
Männlichkeit in der Literatur der Postmoderne (Frankreich, Großbritannien, Italien)
Dieses Spannungsverhältnis ist grundlegend für das Verständnis von Männlichkeit in der Literatur der Postmoderne. In dieser Epoche, deren Ästhetik sich vor allem im Signum der Dekonstruktion von Traditionen und bekannten Identitäten vollzieht, lässt sich ein besonders ausgeprägtes Interesse an der Verhandlung von Männlichkeit erkennen, was in der Forschung, in der männlich- universalistische Deutungen dominieren, noch nicht umfassend behandelt wurde, da Mann und Mensch oft gleichgestellt werden, wodurch männlichkeitsspezifische Aspekte kaum Berücksichtigung erfahren haben. Im Folgenden soll nun als Gegenstand dieser Studie vor allem auf die Kulturräume Frankreich, Großbritannien und Italien sowie die Werke dreier Autoren aus diesen Ländern eingegangen werden. Es sei an dieser Stelle jedoch bereits gesagt, dass die meisten genannten Prinzipien bezüglich der Verhandlung von Männlichkeit ebenfalls außerhalb der Literaturen dieser Kulturräume beobachtet werden können. Es handelt sich hierbei nur um eine exemplarische, qualitative Analyse dieses Phänomens in der generell breit gefächerten Literatur der Postmoderne, die problemlos um weitere Kulturräume und/oder Autoren erweitert und ergänzt werden kann. Eine systematisch-historische Überblickdarstellung von Männlichkeit im Spiegel der insbesondere jüngeren Literaturgeschichte, stellt bezüglich aller drei Zielländer auf komparatistischer wie nationalphilologischer Ebene eines der größten Desiderata der literaturwissenschaftlichen Männlichkeitsforschung dar und liegt nicht vor. Die vorliegende Studie wird dieses Forschungsdefizit bezüglich eines Aspektes postmodernen Schreibens zu beheben versuchen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass diese Studie keine umfassende Literaturgeschichte über Männlichkeit zu ersetzen vermag und diesen Anspruch dementsprechend auch nicht erhebt. Es erfolgt vorrangig eine exemplarische Betrachtung einiger Strömungen postmodernen Schreibens, in denen evident wird, dass die Verhandlung von Männlichkeit in diesen literarischen Texten eine fundamentale Rolle einnimmt. Diese Strömungen mögen an sich sehr unterschiedlich sein, doch eine ähnliche Verhandlung von Männlichkeit, neben bestimmten ästhetischen und inhaltlichen Aspekten, liegt allen zugrunde: Männlichkeit erscheint dort oft in zwielichtigem Gewand. Sie mag vielleicht nicht immer vollends als Negativum dargestellt und wahrgenommen werden, wird aber aufgrund ihres stark normativen Charakters dennoch als bedrückend und belastend charakterisiert. Zu nennen sind an dieser Stelle zum Beispiel die Autoren des literarischen Minimalismus oder der Mid-Fiction, deren Werke sich durch einen starken Gebrauch von Ironie kennzeichnen und Männlichkeit durch Protagonisten darstellen, die unter dem Druck gesellschaftlicher Erwartungen bezüglich Männlichkeit leiden, aber diesen gar nicht zu entsprechen versuchen, sondern sich aus Überforderung in die Passivität zurückziehen. Angesichts verschiedener Diskurse und Vorstellungen von Männlichkeit scheitern die Protagonisten bereits daran, ihren Alltag zu meistern, was zumeist humorvoll dargestellt wird, wie zum Beispiel bei Jean-Philippe Toussaint (La salle de bain, Monsieur, L’appareil- photo, La télévision), Christian Gailly (Dit-il), Giuseppe Culicchia (Tutti giú per terra, Paso doble) oder auch Julian Barnes (Metroland, Bevor she met me). Elegantere Formen des postmodernen Schreibens entwickeln in ästhetischer Hinsicht einen alternativen Zugang zu Fragen des Virilen, aber auch hier wird hauptsächlich eine männliche Identitätskrise anhand männlichkeitsspezifischer Erfahrungswelten konstruiert, in der sich vor allem ein Konflikt zwischen den Rollenbildern entwickelt. Beispiele hierfür sind Antonio Tabucchi (Notturno indiano, Requiem, Sostiene Pereira), Jean Echenoz (Cherokee, Je m’en vais) und allen voran Ian McEwan (Saturday, Chesil Beach, Enduring Love). Die Strömung, die sich hingegen am offensichtlichsten und zugleich am publikumsträchtigsten mit Männlichkeit in der Postmoderne beschäftigt, ist die Popliteratur. Dies kann auch jenseits der drei Zielländer eindrucksvoll beobachtet werdet. Die Verbindung von Popliteratur und Männlichkeit wurde insbesondere im deutsch- und englischsprachigen Raum umfassend beschrieben, vergleichende beziehungsweise transnationale Studien fehlen jedoch bisher, was verwundern mag, denn innerhalb der Werke der Popliteraten lassen sich, auch auf intertextueller Ebene, große Übereinstimmungen finden. Zu nennen – es handelt sich auch hierbei lediglich um eine Auswahl – sind hier Autoren wie Christian Kracht (Faserland), Benjamin von Stuckrad-Barre (Soloalbum), Frédéric Beigbeder (Mémoires d’un jeune homme dérangé, Vacances dans le coma, L’Amour dure trois ans), Enrico Brizzi (Jack Frusciante è uscito dal gruppo), Bret Easton Ellis (American Psycho), Chuck Palahniuk (Fight Club) und sicherlich Nick Hornby (Fever Pitch, High Fidelity, About a Boy), der „Über-Vater“ der Popliteratur. Das Thema Männlichkeit ist in dieser Form postmodernen Schreibens ubiquitär, weswegen hierbei eigentlich schon von Männerliteratur gesprochen werden kann, was im britischen und deutschsprachigen Kulturraum mit den Bezeichnungen lad lit oder „Männerroman“7 auch geschieht. Der Held, vielmehr der Anti-Held des Popromans repräsentiert wie kaum ein anderer literarischer Typus den Zwiespalt zwischen Last und Lust am Mannsein. Im Mittelpunkt dieser Betrachtung von Männlichkeit stehen dabei nicht nur die Auseinandersetzung zwischen neuen und alten Männlichkeitskonzepten, sondern vorrangig auch der lasterhafte Charakter von Männlichkeit, der sich vor allem in der Flucht vor eigener Verantwortung und einer egozentrischen „Kindsköpfigkeit“ konkretisiert.
Skandalautoren: Houellebecq, Self, Scarpa
Die Autoren Michel Houellebecq (1956), Will Self (1961) und Tiziano Scarpa (1963) können grosso modo der Popliteratur zugeordnet werden, auch wenn sie in bestimmten Aspekten ihrer Ästhetik eigene Wege gehen, die beim Leser gänzlich andere Reaktionen hervorrufen sollen als die ansonsten eher humoristischen und selbstironischen Pop-Autoren. Es handelt sich im Falle dieser Drei um Autoren, die durch ihr Werk und ihr öffentlichen Auftreten als enfants terribles beziehungsweise als Skandallautoren und somit umstrittene Persönlichkeiten wahrgenommen werden, die sich in regelmäßigen Abständen öffentlichkeitswirksam gegen den Mainstream positionieren. Ihr Werk entsteht jeweils im Zeichen einer Schockästhetik, in der auf provozierende, irritierende und skandalisierende Weise eine radikale Kritik an der Gesellschaft der Gegenwart formuliert wird, die als Zeitdiagnose im soziologischen Sinne verstanden werden kann. Es verwundert, dass bisher noch keine komparatistische Lektüre des Werkes dieser Autoren stattgefunden hat, obwohl sie deutliche Parallelen, insbesondere bezüglich der Darstellung von Männlichkeit, aufweisen. Dies könnte darauf zurückgeführt werden, dass allein Michel Houellebecq international zu Berühmtheit gelangt ist, während der Bekanntheitsgrad von Will Self und Tiziano Scarpa die eigenen Ländergrenzen nicht überschritten hat und nur ein kleiner Teil ihres je umfangreichen Werkes in andere Sprachen übersetzt wurde. Bezüglich einer vergleichenden Perspektive auf die Auseinandersetzung mit Männlichkeit in der Postmoderne bietet die komparatistische Lektüre einen besonders lohnenswerten Ansatz, da die Werke der drei Autoren viele Übereinstimmungen aufweisen. Diese deuten darauf hin, dass es sich bei Männlichkeit als Negativum in postmoderner Skandalliteratur um ein europäisches und kein landesspezifisches Phänomen handelt, worin sich nicht nur der transnationale Charakter von Literatur, sondern auch von Männlichkeit entfaltet.
Eine vergleichende Betrachtung der Werke dieser Autoren offenbart, dass deren zentraler Berührungspunkt die Verhandlung von Männlichkeit ist, die nicht nur in den Mittelpunkt ihrer jeweiligen Gegenwartsbetrachtung gestellt wird, sondern anhand derer auch die Schockästhetik entwickelt wird. Männlichkeit stellt in diesem Zusammenhang, was in der Forschung derart noch keinen Widerhall gefunden hat, das zentrale Skandalon der Schockästhetik des Werkes dieser Autoren dar. Houellebecqs, Selfs und Scarpas Werke brechen deutlich mit den sozialen Konventionen ihrer Zeit. Dies führt uns zurück zu unserer Ausgangsthese, dass Männlichkeit in der Literatur der Postmoderne ein Negativum repräsentiert. In diesem Kontext ist es nur konsequent, dass das Negativum Männlichkeit schließlich zum Skandalon erhoben wird, was durch bestimmte Faktoren besonders begünstigt wird: So stellt sich hier zunächst sicherlich die Frage, wie sich Literaturskandale in einer Epoche des Anything Goes vollziehen, die sich vorrangig durch nicht-normierte Kunst und die Überwindung christlich geprägter konservativer Moralvorstellungen auszeichnet. Zu bedenken ist jedoch, dass die Postmoderne zugleich die Epoche ist, in der die Political Correctness etabliert wird und ihre Wirkungsmacht in Form eines neuen Moralismus entfaltet, was neue Skandalpotentiale schafft. Diese richten sich nicht mehr vorrangig gegen konservative Kräfte, die den Status Quo aufrechterhalten wollen, sondern nun auch gegen jene, die sich als Progressive verstehen. Das Werk von Michel Houellebecq, Will Self und Tiziano Scarpa illustriert diese Tendenz sehr eindrucksvoll, was eine weitere Gemeinsamkeit ihrer Texte ausmacht. Diese entfalten ihr Skandalpotential gerade deswegen, weil sich ihre Schockästhetik gegen alle politischen Lager und Milieus richtet. Ein grundlegendes Merkmal ihrer Provokation liegt in der puren Verweigerung, sich zu einer Ideologie zu bekennen. Dies gilt ebenso für die Autorenpersönlichkeiten, die im Rahmen dieser Studie nicht ausführlich betrachtet werden, aber an dieser Stelle getrennt vom Werk kurze Erwähnung finden sollen. So mag Houellebecq im öffentlichen Diskurs aufgrund seiner Aussagen in Interviews als politisch rechts gelten, während Will Self und Tiziano Scarpa als dezidiert links wahrgenommen werden. Diese Zuschreibungen – deren Wahrheitsgehalt sich aufgrund der provokanten Selbstinszenierung dieser Autoren nicht überprüfen lässt und denen daher nicht zu viel Bedeutung beigemessen werden sollte – hindern sie jedoch nicht daran, in ihren Texten eine allgemeine, alle politischen Lager übergreifende Gesellschaftskritik zu üben. Es kann daher gesagt werden, dass ein weiteres Merkmal ihrer Provokation und Schockästhetik letztendlich ihre politische wie schriftstellerische Freiheit ist, die ihnen erlaubt, in ihren Texten eine Form der Schockästhetik zu schaffen, die konservative Moralvorstellungen kritisiert, aber zugleich soziale und gesellschaftliche Entwicklungen, unter anderem bezüglich Sexualität und Familie, die beide in großem Maße Männlichkeit betreffen, in Folge der 1968er-Revolution schonungslos kritisch offenlegt. Der provokante und skandalisierende Charakter von Männlichkeit als Negativum in der Postmoderne wird durch diese duale Struktur greifbar, wie die Textanalysen zeigen werden.
Methodik
Wie ersichtlich geworden sein sollte, stellt das zentrale Anliegen dieser Studie die Analyse von Männlichkeit in literarischen Texten der Postmoderne dar, was anhand der Methodik einer männlichkeitssensiblen Form des close reading erfolgen soll, die jedoch erst zu entwickeln ist. Dies ist notwendig, denn obwohl sich die Männlichkeitsstudien sicherlich nicht mehr in ihren Anfängen befinden, lässt sich bezüglich des Forschungsstandes dennoch beobachten, dass es keine standardisierte Methode gibt, um Männlichkeit in der Literatur zu analysieren. Dies gilt insbesondere für heterosexuelle beziehungsweise mehrheitsgesellschaftliche Männlichkeitsentwürfe, die in der Forschung bisher weitaus weniger Beachtung erfahren haben als marginalisierte beziehungsweise nicht-mehrheitsgesellschaftliche Männlichkeitsentwürfe, zum Beispiel im Rahmen der Queer-Studies. Es lassen sich daher sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Texte beobachten, die Männlichkeit in den Vordergrund ihrer Analyse stellen und deren größte Gemeinsamkeit die Rekurrenz auf soziologische und kulturanthropologische Literatur ist. Diese Literatur stellt auch in Rahmen dieser Studie die Grundlage des hier zu entwickelnden Modells zur Analyse von Männlichkeit im literarischen Text dar, das nicht nur auf die hier zu behandelnden Texte, sondern ebenso auf literarische Erzeugnisse anderer Epochen angewandt werden kann. Ein Novum dieser Arbeit wird es sein, Zugänge aus verschiedenen Philologien zu vereinen, wobei Ansätze aus der Romanistik, Lateinamerikanistik, Anglistik und schließlich der Germanistik zusammengeführt werden sollen, um ein solches Modell des männlichkeitssensiblen close reading zu erarbeiten. Die grundlegende Methode bleibt close reading, also eine intensive Betrachtung und Analyse bestimmter Textpassagen, die für unsere Fragestellung essenziell sind und in denen die Darstellung von Männlichkeit als Negativum besonders greifbar wird. Diese genderspezifische Form des close reading muss daher über bestimmte Analyseparameter verfügen, die Männlichkeit im Text sichtbar werden lassen. Uns ist bewusst, dass wir uns durchaus in die Gefahr begeben, die Studie durch diese Fokussierung beziehungsweise Zuspitzung auf einen speziellen Aspekt des Textes eindimensional erscheinen zu lassen. Ein zentrales Anliegen dieser Studie ist jedoch, ein neues Paradigma zu schaffen und dabei eine Alternative zu den bisher dominierenden univer- salistisch-männlichen Lektüren anzubieten. Somit sind diese Gefahren unausweichlich, da dieses neue Paradigma zunächst etabliert werden muss. Es geht dabei keineswegs darum, einen allgemeinen oder gar absoluten Anspruch auf eine Deutungshoheit zu erheben, sondern vorrangig aufzuzeigen, dass weitere Lesarten möglich sind und eine männlichkeitssensible Form des close reading neue Bedeutungsebenen erkennbar werden lässt, darunter nicht zuletzt die Verbindung von Schockästhetik und Männlichkeitsdarstellung. Dies gilt umso mehr bei den zu analysierenden Texten, die trotz ihres jüngeren Erscheinungsdatums bereits als kanonisch aufgefasst werden, bei denen jedoch der Aspekt des Männlichen nur partiell betrachtet, aber noch nicht in einen breiteren, insbesondere transnationalen Kontext eingeordnet wurde, was durch die vorliegende Studie nun geschehen soll. Ziel einer solchen Verfahrensweise ist es, eine weitere Perspektive auf die Literatur der Postmoderne zu gewinnen, in der geschlechtsspezifische Aspekte eine relevantere Rolle einnehmen, wodurch ein anderes Verständnis dieser Epoche und ihrer Skandalliteratur gewonnen werden kann. Immerhin stellt sich zwangsläufig die Frage, ob tatsächlich von einem postmodernen, allgemeinen Subjekt gesprochen werden kann oder ob es sich dabei nicht eigentlich nur um den Mann in der Postmoderne handelt, was zu einem anderen Verständnis dieser Texte führen würde.
Struktur der Arbeit
Im ersten Teil dieser Arbeit werden wir uns mit den Grundlagen der Männlichkeitsforschung aus interdisziplinärer Perspektive beschäftigen und diese sorgfältig darstellen, da es sich immer noch um ein recht neues Forschungsfeld handelt, weswegen dieses Wissen nicht vorausgesetzt werden kann. Darauf aufbauend erfolgt eine Darstellung der Überlegungen zu einer Methodik des männlichkeitssensiblen close reading, in der soziologische und kulturanthropologische Ansätze auf die literaturwissenschaftliche Praxis übertragen werden sollen. Dabei wird vor allem das Fundament für die späteren Analysen gelegt, indem bestimmte Parameter, die für eine solche Lektüre besonders wichtig sind, dargestellt werden. Im Anschluss erfolgt eine Skizzierung des historischen Hintergrundes und des dazugehörenden kulturellen Feldes. Dort soll die These, dass Männlichkeit in der Postmoderne ein Negativum darstellt, anhand bestimmter Koordinatenpunkte abgebildet werden, an denen sich Männlichkeit in dieser Epoche vollzieht und einen besonderen Wandlungsprozess erfahren hat. In Anbetracht dessen, dass die Literatur dreier Kulturräume betrachtet werden soll, erfolgt diese Skizzierung möglichst breitgefächert und konzentriert sich dabei auf Phänomene, die als gesamteuropäisch gelten dürfen. Einen besonderen Schwerpunkt stellt dabei der Einfluss der Populärkultur als zentraler Verhandlungsort männlicher Performanz dar. Im Anschluss erfolgt die eigentliche Textarbeit, wobei mit der Analyse der ersten drei Romane Michel Houellebecqs begonnen wird. Es handelt sich dabei um das umfangreichste Kapitel, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die entwickelte Methode hier ihre erste Erprobung erfahren soll. Zudem ist zu beachten, dass Houellebecqs Werk als das im negativen Männlichkeitsdiskurs paradigmatischste angesehen werden kann, da er in seinen ersten drei Romanen, die hier als „Trilogie der Männlichkeit“ begriffen werden, zahlreiche elementare Aspekte postmoderner Männlichkeit aufgreift. Bei den zu analysierenden drei Romanen handelt es sich außerdem um ein intertextuelles Netzwerk, da sie sich, insbesondere bezüglich der Verhandlung von Männlichkeit, gegenseitig bespielen, weswegen sie als Einheit betrachtet werden sollen. Im Kapitel zu Michel Houellebecq wird auf eine literaturhistorische Situierung innerhalb der französischen Literatur der 1990er weitestgehend verzichtet, was der Tatsache geschuldet ist, dass Houellebecq und sein Werk keiner eindeutigen Schule oder Generation zuzuordnen sind und daher isoliert betrachtet werden können. Ganz anders sieht es hingegen bei Will Self und Tiziano Scarpa aus, die als Vertreter der lad lit beziehungsweise der gioventù cannibale eindeutig einer literarischen Strömung angehören, in deren Kontext die Werke zu untersuchen sind. Es erfolgt daher eine literaturhistorische Situierung dieser Autoren, die ebenfalls vorrangig vor dem Hintergrund der Männlichkeitsdarstellung erfolgen soll und dabei einen Ausgangspunkt für eine mögliche Literaturgeschichte von Männlichkeit darstellt. Die Aufgabe dieser beiden Analysekapitel wird vor allem sein, eine Verknüpfung zwischen den Werken dieser Autoren zu schaffen, wodurch deren Parallelen und Verbindungen illustriert werden sollen. Last but not least sollen im Fazit die gewonnen Erkenntnisse und Ergebnisse zusammengetragen und schließlich anhand eines kurzen Blickes auf die deutsche und US-amerikanische Literatur in einen breiteren literaturhistorischen Kontext überführt werden. Dieser soll nicht nur zeigen, dass es sich bei Männlichkeit als Negativum in postmoderner Skandalliteratur um ein länderüberschreitendes Phänomen handelt, sondern auch darlegen, wie sinnvoll beziehungsweise ergiebig es ist, Männlichkeit aus einer komparatistischen Perspektive zu betrachten.
1 Tyler, Bonnie: „Holding Out for a Hero.“ Secret Dreams and Forbidden Fire, 1986.
2 Gerade im deutsch- und englischsprachigen Raum kann regelrecht von einem „Boom“ der „Männerratgeber“ gesprochen werden, in denen sich die Krisenhaftigkeit von Männlichkeit zumeist bereits im Titel zeigt. Um nur einige besonders prägnante Beispiele zu nennen: Was vom Manne übrig blieb (2008), Männerdämmerung: Auf dem Weg zur wahren Identität und Stärke (2010), Altherrensommer: Männer in der Drittlife-Krise (2012), Das entehrte Geschlecht (2012), 31 Days to Masculinity: A Guide to Help Men Live Authentic Lives (2017), How to Be a Big Strong Man: A Modern Guide to Masculinity (2019), Reclaiming Your Masculinity: The Guide to Becoming a Man (2019), Mindful Masculinity Workbook: A Practical Guide to Healthier Masculinity (2020).
Details
- Pages
- 444
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631911679
- ISBN (ePUB)
- 9783631911686
- ISBN (Hardcover)
- 9783631911662
- DOI
- 10.3726/b22254
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- Pulpliteratur Popliteratur Männlicher Habitus Schockästhetik Skandalliteratur Postmoderne Skandalforschung Britische Literatur Italienische Literatur Französische Literatur Toxische Männlichkeit Negative Männlichkeit Männlichkeit
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 444 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG