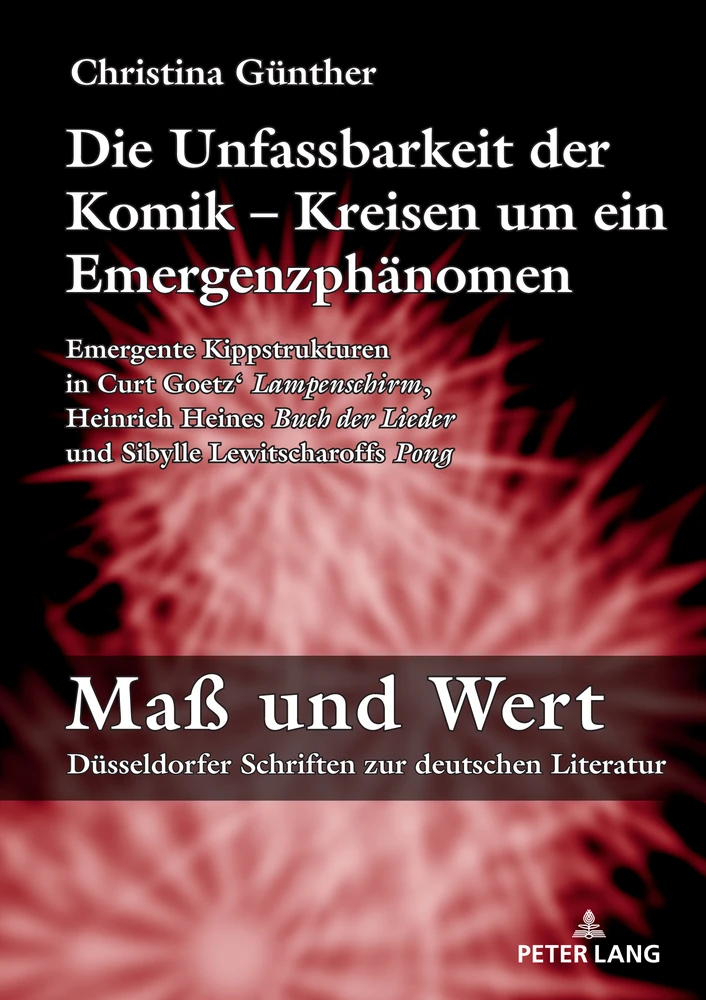Die Unfassbarkeit der Komik – Kreisen um ein Emergenzphänomen
Emergente Kippstrukturen in Curt Goetz‘ «Lampenschirm», Heinrich Heines «Buch der Lieder» und Sibylle Lewitscharoffs «Pong»
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Zu dieser Reihe
- Inhalt
- Einleitung
- 1. Die Emergenzqualifikation der Komik
- 1.1. Blackbox Emergenz
- 1.2. Zugangsversuche via Wort und Begriff – Erste Verdachtsmomente für Emergenz
- 1.3. Der Proteus in den Prokrustesbetten wissenschaftlicher Reflexion
- 1.3.1 Komik als objektives Phänomen
- 1.3.2 Von der subjektiven Seite der Komik und ihrer schöpferischen Kraft
- 1.3.3 Auf dem Weg zur Irreduzibilität
- 1.4. Universell unfassbar
- 2. Das Operieren und Wirken der Komik als Emergenz
- 2.1. Kants entschärftes Nichts
- 2.2. Die Fortsetzung des Emergenten bei Plessner
- 2.3. Ritters humoristisch gefesselte Emergenzdynamik
- 2.4. Transgressiv lachen mit Bachtin, Nietzsche und Bataille – Die generative Kraft der Emergenz
- 2.5. Isers Kippkomikmodell – Eine Beschreibung von Emergenz und der Entstehung des Emergenten
- 2.5.1 Veranlassung und Verlauf
- 2.5.2 Gestaltwerdungen des Emergenten
- 2.5.3 Emergenzglanzverläufe der Komik
- 3. Komik als Emergenz im literarischen Text
- 3.1. Curt Goetz’ gemütliche Komik
- 3.1.1 Gattungsbedingte Dynamikbremsen
- 3.1.2 „Der Lampenschirm“ (1911)
- 3.2. Heinrich Heine und das schwebende „Buch der Lieder“ (1827)
- 3.3. Sibylle Lewitscharoffs „Pong“ (1998) – Der komische Rezipient
- 3.3.1 Formale Schwebesituation
- 3.3.2 Intertextuelle Verführungen
- 3.3.3 Unversöhnlich verstrickt
- Schluss
- Literaturverzeichnis
- Reihenübersicht
Einleitung
Das Komische zählt zu jenen schillernden Phänomenen – wie Liebe, Neugierde, Bewusstsein, Imagination –, die den Menschen allezeit in den Bann ziehen, Genuss und Lust bereitend in Bewegung halten, zum Nachdenken anregen und nicht zuletzt ob ihrer Nicht-Fassbarkeit und Nicht-Begreiflichkeit dem Leben Bedeutung geben. Komik ist so faszinierend wie sie komplex ist. Bedenkt man den unerschöpflichen Phänomenbereich, die Vielfalt der Erfahrungsfelder und Erscheinungsweisen der mit einem Wort Jean Pauls nur als phänomenaler „Proteus“1 zu bezeichnenden Komik, wird ihre Komplexität bereits aus vortheoretischer Warte unmittelbar einsichtig.
Das Komische taucht unversehens auf, gern ungeladen, oder institutionalisiert. Es tritt auf in der Kunst wie Literatur, bricht ein in Lebenswelt und Kultur, präsentiert sich in alltäglich-derbem Gewand oder ist ästhetisch-anspruchsvoll zurechtgemacht. Komik erscheint in Form gegossen als Satire, Ironie, Parodie und Komödie, profiliert sich als Humor wie Witz und vermag sich in einem Lachen niederzuschlagen, dabei jedoch weitaus mehr als pure Heiterkeit und ungetrübte Freude zu bewirken. Von den plattesten Verkörperungen bis zum komplexen ästhetischen Spiel ist Komik respektive die Erfahrung des Komischen ubiquitär.2
In den abwandlungsreichen Formen der komischen Erscheinung, des komischen Aussehens und Benehmens, komischer Dinge und Bewegungen, der Situations-, Wort- und Charakterkomik, im täglichen Leben und in der Kunst begegnet es [das Komische /C.G.] uns und übt […] seinen Zwang auf uns aus.3
Unmittelbar ersichtlich ist überdies, dass das Komische alle buntscheckigen Bereiche menschlichen Lebens zu betreffen vermag, alle Tätigkeitsfelder und Artikulationsweisen. Dementsprechend hat Helmuth Plessner festgestellt, dass bedingt durch die Exzentrizität seiner Existenz „so gut wie alles“, was der Mensch „ist, hat und tut, komisch wirken“4 kann. Das Heiligste, Erhabenste genauso wie das Profanste und Weltliche – nichts und niemand ist vor dem Einbruch des Komischen sowie „vor dem Umbruch ins Komische“5 gefeit, losgelöst von der Intention des Menschen und dessen Anstrengungen.
In diesem Ein- und Umbruchscharakter mutet dem Komischen etwas Ereignishaftes an. Es erscheint als ein Widerfahrnis. Sein Auftauchen bedeutet für das Subjekt stets eine Irritation im Wirklichkeitsgeschehen bzw. bewirkt eine Veränderung des Kontextes. Das Komische fährt uns unerwartet in unsere automatisierten Paraden habitueller Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Erkenntnismuster und lässt uns dadurch vom Beobachter zum verstrickten Teilnehmer einer Situation werden, in der wir für einen Moment dem Anderen, Ungewohnten und Unbekannten anheimgegeben sind.6
Man weiß nämlich spätestens seit Helmuth Plessner, daß sich dem, der lacht, die Welt keineswegs in reduzierter Komplexität, in der Überschaubarkeit eines zweigliedrigen Paradigmas darbietet, sondern daß ihm das Durchhalten von Erwartungen angesichts der „Gegensinnigkeit“ des Komischen nicht gelingt. Das Komische nämlich ist dadurch gekennzeichnet, daß es selbst einem Minimum an erwartbarer Eindeutigkeit, Ordnung, Gliederbarkeit, Stabilität nicht genügt. Mit ihm wird man daher nicht fertig, und doch kann man sich nicht einfach von ihm lösen.7
Doch ob die vis comica ihre Magie entfaltet, ist unberechenbar. Das Komische lässt sich weder von den Intentionen eines Komikproduzenten, einem vorgegebenen institutionellen Rahmen noch vom Rezipienten restlos erzwingen. Eine sattsam bekannte, jedermann zugängliche Erfahrung ist, hoffnungsvoll von Kopf bis Fuß auf Komik eingestellt in einer Komödie, im Kabarett oder vor einem deutschen TV-Comedy-Format zu sitzen und vergeblich auf das Erscheinen des Phänomens zu warten. Komik erscheint in ihrer Unberechenbarkeit und Widersprüchlichkeit als eine unverfügbare Macht, als etwas, das dem Willen und der Intention des Subjektes entzogen ist.
Dann wiederum ist das komplexe Komische als spezifisch menschliches8 Phänomen universell, „Hauptbestandteil des Menschlichen selbst“,9 genauso wie seine typischste Manifestwerdung, das mit ihm gedanklich wie bestenfalls körperlich sich unmittelbar aufdrängende, zur anthropologischen Serienausstattung des Menschen gehörende Lachen als empirische Bewandtnis der Komik. Eine menschliche Kultur ohne das Komische und das Lachen hat es allen Verfemungen, Lachverboten und beharrlichen Domestikationsversuchen seitens der ewigen metaphysischen Spielverderberinnen Philosophie, Moral und Religion zum Trotze zu keiner historischen Zeit gegeben.10
So umtreibt die unbeugsame Komik den Menschen seit Jahrtausenden als eine fundamentale Menschheitsfrage, wenn nicht gar als ein unergründliches Rätsel menschlichen Daseins, und hat eine Vielfalt erkenntnistheoretischer Bemühungen in Gang gesetzt. Seit den greifbaren Anfängen der Komikforschung in der Antike – dokumentiert mit ihren systematischen Kinderschuhen in Form von Platons Annahmen über das Wesen des Lächerlichen in den Dialogen „Philebos“ und „Nomoi“ – ist spätestens ab 1700 dann ungebrochen bis heute versucht worden, der Komik auf die Spur zu kommen.11
Die „erlauchtesten Namen der europäischen Geistesgeschichte“12 – von Platon und Aristoteles über Hobbes, Kant, Schopenhauer, Baudelaire bis zu Bergson, Freud, Ritter, Plessner und Wolfgang Iser – haben über das Komische sowie die mit ihm verbundenen Phänomene des Humors und Lachens nachgedacht: sei es im Rahmen der altehrwürdigen Wesensfrage, bei dem Versuch, eine allgemeine Bestimmung und Theorie zu liefern; sei es im Zuge der Beschäftigung mit den Spielarten und Darstellungsweisen der Komik, also mit Komödie, Groteske und Karikatur, Witz und Ironie.13
Vor dem Horizont der bewegten Geschichte der Komik als Gegenstand wissenschaftlicher Reflexion, der Verfasstheit des komiktheoretischen Diskurses und seiner Erzeugnisse sowie in Anbetracht der eigenen Erfahrung abstrahierenden Nachdenkens über das „komplexe, disparate Bereiche verbindende Phänomen“14 ist Folgendes zu diagnostizieren: Nicht nur stellt sich Komik in Wirklichkeit und Literatur für das jeweilig mit ihr konfrontierte individuelle Subjekt als Irritation im Wahrnehmungs- und Erkenntnisgeschehen dar – ereignishaft, unkontrollierbar, Geordnetes verwirrend, den Verstand verblüffend, (zwerchfell-)erschütternd, lustvoll befreiend wie überfordernd und cum grano salis numinos.
Vielmehr scheint sich das aller Komik „eigentümliche[] Irritationsmoment“15 in der generalisierenden, systematischen Begegnung fortzusetzen. Sie entzieht sich auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung der Greifbarkeit, widersetzt sich widerborstig jeglicher Schematisierung, unterminiert etablierte Ordnungs- und Normsysteme, bringt den auf Erkenntnis bezogenen Geist an die Grenzen und theoretische Systematik wie Objektivität zu Fall. Nicht nur des Rezipienten, sondern auch des Forschers nach Sinn und Stabilität suchendem Verstand verweigert das komplexe und ambivalente Phänomen den logischen Zugang.
Die subjektive, emotionale Seite der Komik und die Notwendigkeit ihrer Bewältigung scheint sich somit auch im komiktheoretischen Diskurs zu dokumentieren, sei es allein in dessen Reaktion, sie unentwegt begrifflich und theoretisch zu fixieren zu versuchen. Doch seit jeher legt sich die Komik nicht vorbehaltlos in die Prokrustesbetten wissenschaftlicher Systematisierung, Begriffsbestimmung und Theoriebildung, in die Philosophie und Wissenschaft sie immer wieder zu zwingen versucht haben. Oder wie Odo Marquard treffend formuliert: „Komisch ist […] etwas oder muß es sein, mit dem man – grausamer- und angenehmerweise – nicht fertig wird, schon gar nicht durch eine Theorie.“16
Schließlich führt nach Erfahrung der Verfasserin das Nachdenken über Komik sogar dazu, ausgerechnet jener maßgeblichen Fröhlichkeit verlustig zu gehen, die gemäß Friedrich Nietzsches Programm von der heiteren Wissenschaft ein „Gut-Denken“17 nötig hat. Nietzsche und Walter Benjamin, der genauso für eine fröhliche Wissenschaft plädiert, wenn er konstatiert, dass „die Erschütterung des Zwerchfells dem Gedanken gewöhnlich bessere Chancen dar[bietet] als die der Seele“,18 hatten bei ihrem Programm offensichtlich nicht den Forschungsgegenstand „Komik“ auf dem Schirm.
Diese Einschätzung teilt auch F. W. Bernstein, der allerdings noch einen weiteren empfindlichen Punkt berührt: Nicht nur ist „die ernsthafte Beschäftigung mit Komiktheorien […] keine fröhliche Wissenschaft“ mehr, vielmehr macht sie auch noch „früh altern“.19 Doch über das Bekenntnis zu dem Mutieren zur „ernsten Bestie“,20 den „Erschütterungen der Seele“ und der korrelierenden Faltenbildung hinaus soll an dieser Stelle vielmehr von vorneherein frontal eingestanden werden, kognitiv wie emotiv überfordert an der Komik als Gegenstand der Erkenntnis gescheitert zu sein. Paradoxerweise ist das Scheitern gerade ein zentraler Topos der Handlungskomik.21
Im Hinblick auf die die Fortsetzung des konstitutiven Irritationsmoments – das in der Forschung auch als „das ‚befreiende‘, Unterscheidung auflösende Moment“, „,dionysische[s]‘ Moment“,22 „kritisches und krisenhaftes Element“,23 „innewohnende[s] subversiv-anarchische[s] Potential“,24 „Widerstandspotential“25 etc. bezeichnet wird – anzeigenden Reaktionen des komiktheoretischen Diskurses auf die Komik gereicht es insofern zum Trost, sich in dem verzweifelten Ringen mit dem „glitzernden, sich stets entziehenden Gegenstand“,26 wie Peter L. Berger sie beschreibt, als einem ewigen Kreisen bzw. Kreißen immerhin in illustrer Gesellschaft zu befinden:
So empfiehlt angesichts des allseitigen „Elend[s] der Komikdebatte“27 auch Siegfried J. Schmidt für den Umgang mit Begriff und Theorie der Komik, „ehe man vom eigenen Scheitern düpiert wird“, sich zum Scheitern zu bekennen, „denn beim Umgang mit dem Begriff ‚Komik‘ kann man nur scheitern, wenn man sich etwas Endgültiges von diesem Umgang verspricht“.28 Joachim Ritter beklagt ebenfalls die Nebenwirkungen der Beschäftigung mit dem Phänomen, wenn er zu erkennen gibt, dass ihn „das Nachdenken über das Lachen melancholisch macht“.29
Ágnes Heller diagnostiziert die Ungleichartigkeit komischer Phänomene wie mangelnde Fassbarkeit der Komik und alludiert auch auf deren kritisches, derangierendes Moment: „Wenn wir […] über das Komische sprechen, stehen wir vor einem Durcheinander. […] Das Komische ist chaotisch wie das Leben selbst […], absolut, hoffnungslos heterogen.“30 Joseph Vogls Auffassung vom Komischen, das „destabilisiert oder […] auf eine Destabilisierung [verweist]“ und von ihm „eine Umständlichkeit im engsten Sinne“31 genannt wird, referiert ebenfalls auf den Rezipient wie Forscher irritierenden, Umstände bereitenden Charakter der Komik.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel wiederum konstatiert die Regellosigkeit wie Unvorhersehbarkeit vom Komischen und Lachen, wenn er auf die Divergenz der Gegenstände, die je als komisch aufgefasst und mit einem Lachen quittiert werden, hinweist: „Überhaupt lässt sich nichts Entgegengesetzteres auffinden als die Dinge, worüber die Menschen lachen“.32 Henri Bergson beschwert sich einführend zu „Das Lachen“, seinem berühmten Essay über die Bedeutung der Komik von 1900, ebenfalls über deren Ungreifbarkeit: „Seit Aristoteles haben sich die größten Denker in dieses kleine Problem vertieft, und doch entzieht es sich jedem, der es fassen will, es gleitet davon, verschwindet, taucht wieder auf: eine einzige spitzbübische Herausforderung an die philosophische Spekulation.“33
Und Sigmund Freud eröffnet gleichermaßen angesichts der variantenreichen Wechsel der Konzeptualisierung des Phänomens in dessen Geschichte seine Erörterungen der Komik mit einer Captatio Benevolentiae:
An das Problem des Komischen […] wagen wir uns nur mit Bangen heran. Es wäre vermessen zu erwarten, daß unsere Bemühungen etwas Entscheidendes zu dessen Lösung beitragen könnten, nachdem die Arbeiten einer großen Reihe von ausgezeichneten Denkern eine allseitig befriedigende Aufklärung nicht ergeben haben.34
Gegenüber Freuds freundlichem rhetorischen Kratzfuß einigermaßen bärbeißig nimmt sich die Reaktion Arthur Schopenhauers auf eine systematische Begegnung mit der Komik aus, die als Paradebeispiel „theoretisierender Großsprecherei“35 symptomatisch für die in diversen Beiträgen der Komikforschung anzutreffende Position ist, dass das Komische und das Lachen als jeweils klarer Fall erledigt werden könnten, „jenseits derer Ambivalenz und Hintergründigkeit“.36
Nachdem er in einer dogmatisch-hoffärtigen Verwerfungsgeste Kants und Jean Pauls Theorien des Lächerlichen in den Wind geschossen hat, deren „Unrichtigkeit nachzuweisen […], [er] für überflüssig“ befindet aufgrund ihrer scheinbar evidenten Unzulänglichkeit, macht er für seinen Entwurf geltend,
daß hier nach so vielen fruchtlosen früheren Versuchen die wahre Theorie des Lächerlichen gegeben und das schon vom Cicero aufgestellte, aber auch aufgegebene Problem [sc. des Ursprungs des Lächerlichen und der Bedeutung des Lachens /C.G.] definitiv gelöst sei.37
Abschließend, allumfassend und allseitig befriedigend ist die Komik indes bis heute nicht erklärt, enträtselt und schon gar nicht begründet. Bis heute vermochte die traditionelle Komikforschung in ihrem Bestreben, eine allgemein anerkannte und gültige Theorie zu präsentieren, nicht zu reüssieren. Den zahllosen Versuchen der Forschung, welche die Komik „kurzerhand in eine Formel zu pressen“ suchen, „um das Thema ein für allemal zu erledigen“, ist mit Bergson entgegenzuhalten, dass all diese Definitionen „gleich annehmbar sind, wiewohl sie nicht das gleiche aussagen“, indes „keine von ihnen das Rezept zur Erzeugung der Komik liefert“.38
Die Auseinandersetzung über eine Konzeptualisierung der Komik ist jedoch auch heute noch nicht vom Tisch, wovon allein die Flut stetig neuer Abhandlungen zu dem Thema kündet. Der ad infinitum angeschwollenen Zahl an vorhandenen Theorien bzw. Definitionen des Komischen eingedenk hegt dieser Beitrag mitnichten die Absicht, eine weitere und damit vom zwingenden Anspruch her bessere Eule nach Athen zu tragen. Die Möglichkeit einer solchen bestechenderen Theorie oder schärferen Definition ist vielmehr infrage zu stellen.
Ausgehend von den für die Komik geltend gemachten und durch die zahlreichen Zitate, sprich ausuferndes Namedropping untermauerten Aspekte der Komplexität, Unfassbarkeit, Un(be)greifbarkeit, Instabilität, Umständlichkeit, Unvorhersehbarkeit, Regellosigkeit und dem damit einhergehenden Befund, dass die Komik gerade nicht allgemeingültig zu erklären, geschweige denn zu begründen ist, will die vorliegende Abhandlung der Rätselhaftigkeit der Komik vielmehr Rechnung tragen und ihr das „numinose“, magische Moment belassen.
Dieses Vorhaben führt direkt zum Gedanken von der „Blackbox Emergenz“ und zu Wolfgang Isers unvollendet gebliebenem Emergenz-Projekt. In dem nachgelassenen Textfragment richtet er nämlich sein Augenmerk auf nicht-determinierte Vorgänge, beschäftigt sich mit dem auf bestehende Vorgaben irreduziblen Unvorhersehbaren, mit plötzlichen Kippmomenten und Transformationen. Laut David E. Wellerby stand Iser stets „auf du und du mit dem Unaussprechlichen“ und verfolgte dementsprechend mit seinem Emergenz-Projekt das Anliegen, „ein entgleitendes, gegenständlich nicht fassbares Etwas zu begreifen oder, wie er es oft formulierte, einzukreisen“.39
Der Komik den Begriff der Emergenz an ihre kapriziöse Seite zu stellen, erscheint dem Untersuchungsgegenstand insofern dienlich, als Emergenz für eine von Intention und Bewusstsein unabhängige, freie Entwicklung steht. Das in einem Emergenzprozess entstehende Unvorhersehbare setzt sich ohne Rücksicht auf konzertierte menschliche Steuerungs- und Kontrollbemühungen frei, jenseits diskursiver Vorgaben und normativer Geltungen, und vermag seinerseits wiederum ungeahnte Folgen zu zeitigen. Entsprechend der der Emergenz eigentümlichen Logik der permanenten Bewegung sowie des „Breschenschlagens“ zum Neuen hin gestattet sie keine identitätsförmigen Festlegungen. Emergenz eignet vielmehr ein Bekenntnis zur absoluten Freiheit.40
Vermöge dieses Konzeptes können Phänomene in den Blick genommen werden, derer ob ihrer multifaktoriellen Komplexität mit traditionell gepflogener Kausalitätslogik und theoretischer Rationalität nicht Herr zu werden ist. Denn alternativ zu unserem abendländischen Bedürfnis, für das Begreifen einer Sache einen Grund postulieren zu müssen, auf den die Sache zurückgeführt wird, befasst sich der Gedanke der Emergenz mit den jeweilig verschiedenen Bedingungen des Hervorbringens oder Entstehens in der Lebenswelt und der Kunst.41
Im ersten Kapitel der Arbeit werden zuvorderst anhand des Iserschen Emergenz-Essays die einschlägigen Voraussetzungen und charakteristischen Merkmale von Emergenz und dem Emergenten skizziert. Gemäß dem Ansinnen der Abhandlung Komik / das Komische als Emergenz bzw. ihre Effekte, Wirkungen und funktionalen Folgen als Veranschaulichungen des Emergenten zu plausibilisieren, gilt es zunächst zu prüfen, ob die basalen Ausgangsbedingungen von Emergenz erfüllt sind, sprich die Komik sich dafür qualifiziert, als Emergenz beschrieben werden zu können.
Details
- Pages
- 220
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631926024
- ISBN (ePUB)
- 9783631926031
- ISBN (Hardcover)
- 9783631926017
- DOI
- 10.3726/b22304
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- Rätselhaftigkeit des universalen, allzumenschlichen Phänomens der Komik die Entstehung des Emergenten Emergenz Komiktheorien komiktheoretischer Diskurs multifaktorielle Komplexität, Ambivalenz, Unvorhersehbarkeit, Irreduzibilität der Komik
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025., 220 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG