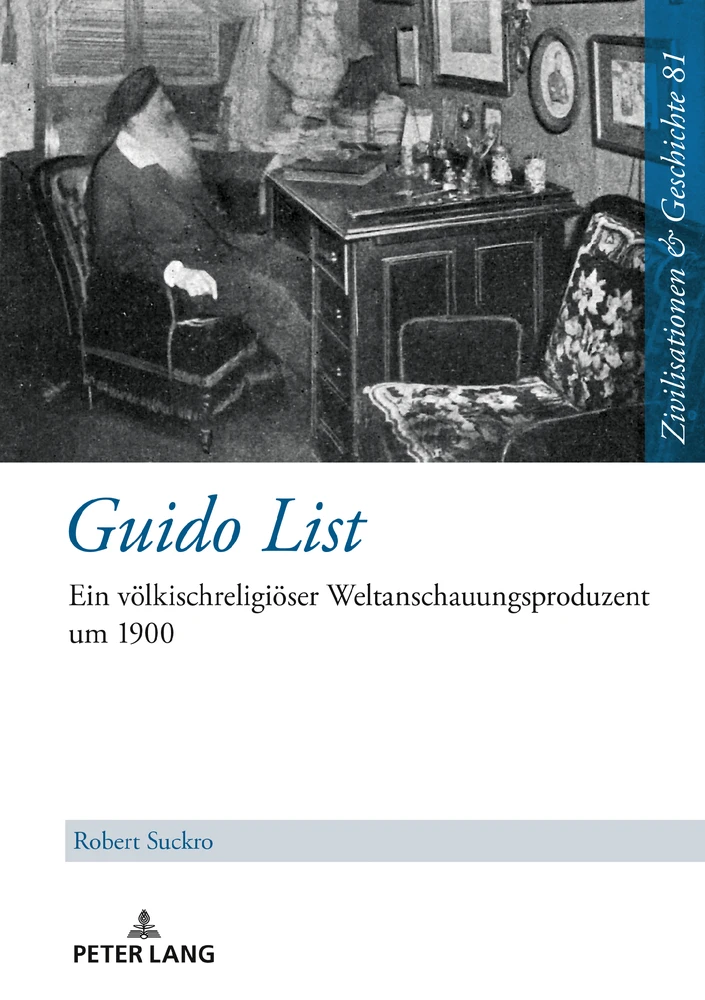Guido List
Ein völkischreligiöser Weltanschauungsproduzent um 1900
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Danksagung
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Thematische Hinführung
- 1.1 Ariosophie oder Armanismus?
- 1.2 List und ‚der‘ Nationalsozialismus
- 1.3 Das Jahr 1902 – Eine Zäsur im Gesamtwerk?
- 1.4 Der Armanismus – Eine ‚germanisierte Theosophie‘?
- 1.5 List als Ahnvater der Runenesoterik
- 2. Forschungsvorhaben
- 2.1 Fragestellung und Methode
- 2.2 Aufbau, Quellen und Einbettung in den Forschungsstand
- Teil I: Guido List – eine Biobibliographie
- 1. Die frühen Jahre (1848–1887)
- 2. List als Publizist der Deutschnationalen Bewegung (1888–1905)
- 3. Suche nach einem neuen Publikum (1902–1907)
- 4. Die Guido von List-Gesellschaft (gegr. 1908)
- 5. Die Guido-List-Bücherei – Ein bibliographischer Überblick
- 6. Vom zeitweiligen Hellgesicht zur Erberinnerung – Aktualisierung des Selbstbildes
- 7. Der Hohe Armanen Orden, die Kriegsjahre und Lists Tod
- Teil II: Phase II (1902–1919)
- 1. Zum Ursprung von Ariern und Ario-Germanen
- 2. Die Natur-Ur-Gesetze
- 2.1 Die ‚beideinig-zwiespältige Zweiheit‘, die ‚Hochheilige Drei‘ und der ‚Apolare Ausgleich‘
- 2.2 Reinkarnation und Garma
- 3. Die ario-germanische Gesellschafts- und Rechtsordnung
- 3.1 Die Einheit von Recht, Wissenschaft und Religion – Die ‚Rita‘
- 3.2 Die Armanenschaft
- 4. Der verborgene Armanismus – Lists Methodologie
- 4.1 Die etymologische Methode
- 4.1.1 Das Runengeheimnis
- 4.1.2 Die Arische Ursprache
- 4.2 Die Geheimsprache ‚Kala‘
- 4.2.1 Skalden
- 4.2.2 Herolde
- 4.2.3 Feme
- 5. Die ‚Wiedergeburt des Ario-Germanentums‘
- 6. Zwischenergebnisse
- Teil III: Phase I (1871–1901)
- 1. Politischer und geistesgeschichtlicher Kontext
- 1.1 Nationalismus und Nationalitätenproblem in Österreich-Ungarn
- 1.1.1 Sprache als Identitätsmarker nationaler Zugehörigkeit
- 1.1.2 Der tschechisch-deutsche Sprachenstreit
- 1.2 Die Entwicklung des österreichischen Antisemitismus
- 1.2.1 Antisemitismus, Antiliberalismus und Antikapitalismus
- 1.2.2 Antisemitische Stereotype um 1900
- 1.2.2.1 Wilhelm Marr (1819–1904)
- 1.2.2.2 Eugen Dühring (1833–1921)
- 1.2.2.3 Adolf Wahrmund (1827–1913)
- 1.2.2.4 Zusammenfassung
- 1.3 Die Deutschnationale Bewegung
- 1.3.1 Georg von Schönerers (1842–1921) politisches Programm
- 1.3.2 Die Synthese von Deutschnationalismus und Antisemitismus
- 1.3.3 Karl Lueger und die Christlichsozialen
- 1.3.4 Deutschnationalismus und Völkische Bewegung
- 1.4 Völkische Religiosität als Teil des alternativreligiösen Milieus um 1900
- 1.5 Zwischenergebnisse
- 2. List als Weltanschauungsproduzent der Deutschnationalen Bewegung
- 2.1 Carnuntum (1888) als Türöffner zur Deutschnationalen Bewegung
- 2.1.1 Dichter oder Gelehrter? – Lists Selbstpositionierung im literarischen Diskurs
- 2.1.2 Friedrich Wannieck (1838–1919) und das Deutsche Haus in Brünn
- 2.1.3 Der ‚Wiederaufbau von Carnuntum‘
- 2.2 Lists Verortung im deutschnationalen Netzwerk
- 2.2.1 Mitarbeit bei der Ostdeutschen Rundschau (1892–1898)
- 2.2.2 Mitgliedschaft in deutschnationalen und literarischen Vereinen
- 2.2.2.1 Der Bund der Germanen
- 2.2.2.2 Der Verein Iduna und die Deutschösterreichische Schriftsteller-Genossenschaft
- 2.2.2.3 Die Literarische Donaugesellschaft
- 2.2.2.4 Weitere Vereine
- 2.2.3 Lists Engagement für die deutschnationale Theaterkultur
- 2.3 Politische Implikationen in Lists Werken
- 2.3.1 Zum Antisemitismus bei List
- 2.3.1.1 Antisemitismus in Carnuntum (1888) und früheren Schriften
- 2.3.1.2 Die Juden als Staat und Nation (1896)
- 2.3.1.3 Jerusalem die Hypothekenbank des cäsarischen Rom (1903)
- 2.3.1.4 Juden als ‚Nager am Volksstammbaum‘
- 2.3.1.5 Juden und Joten
- 2.3.1.6 Ostara’s Einzug (1896)
- 2.3.2 Entwurf einer germanischen Topographie – Lists Beitrag zum Sprachenstreit
- 2.3.3 Lists Rolle in der Los-von-Rom-Bewegung
- 2.3.3.1 Der Unbesiegbare (1898) – Ein ‚germanischer Katechismus‘
- 2.3.3.2 Rom = Rom? – Die Gleichsetzung von Römischem Imperium und Römisch-Katholischer Kirche
- 2.4 Zwischenergebnisse
- 3. Historische und mythologische Arbeiten
- 3.1 Relevante Progonen und ideengeschichtliche Verortung
- 3.1.1 Jacob Grimm und die Deutsche Mythologie (1835)
- 3.1.2 Eddarezeption in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
- 3.1.3 H. H. G. F. Schliep – Der „verdienstvolle Entdecker der Zwiesprache“
- 3.2 „All Ihr geeint in Allvater dem Einen“
- 3.2.1 Der Begriff der (Gott-)Innerlichkeit
- 3.2.2 Germanischer Monotheismus
- 3.3 Die Vorläufer der Armanenschaft
- 3.3.1 Wuotanspriester und Gottesfrohnde
- 3.3.2 Heilsräthinnen
- 3.3.3 Der ‚Deutsche Barden- und Skalden-Orden‘
- 3.4 Naturmythologie als Wurzel der Hochheiligen Drei
- 3.4.1 Naturmythologische Interpretationen der Edda im populären und akademischen (Fach-) Diskurs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
- 3.4.2 Lists naturmythologische Thesen
- 3.4.2.1 Naturmythologie und Reinkarnationsvorstellungen
- 3.4.2.2 ‚Weltenjahr‘ (Makrokosmos) und ‚Erdenjahr‘ (Mikrokosmos)
- 3.4.2.3 ‚Der Starke von Oben‘ – Naturmythologie und Dekadenzvorstellungen
- 3.5 Lists Freimaurerrezeption
- 3.5.1 Freimaurerei in Österreich-Ungarn
- 3.5.2 Lists Aktivität in der Humanitas
- 3.5.3 Freimaurerrezeption in Lists Werken
- 3.6 Zwischenergebnisse
- Schluss
- Fazit
- Ausblick
- Anhang
- 1. Literaturverzeichnis
- 1.1 Lists Werke
- 1.2 Weitere Primärquellen
- 1.2.1 Österreichisches Staatsarchiv
- 1.2.2 Österreichische Nationalbibliothek
- 1.2.2.1 Historische Rechts- und Gesetzestexte (ALEX)
- 1.2.2.2 Austrian Newspapers Online (ANNO)
- 1.2.3 Sonstige Quellen
- 1.3 Sekundärliteratur
- 2. Abbildungsverzeichnis
- 3. Tabellenverzeichnis
- 4. Anhang
- 4.1 Lists Publikationen nach Jahren und Anzahl
- 4.2 Lists Publikationstätigkeit in den Jahren 1888–1902
- 4.3 Stammbaum der Familie List
- 4.4 Lists und Schlieps Runendeutungen im Vergleich
- 5. Personenregister
Einleitung
1. Thematische Hinführung
Im Sommer des Jahres 1911 lud der Schriftsteller Guido List (1848–1919) seine engsten Freunde und Anhänger aus Österreich und dem Deutschen Reich zu sich nach Wien ein, um mit ihnen über die Verwirklichung und Verbreitung seiner bis dato in sieben Werken dargelegten Thesen zur germanischen Vorgeschichte zu diskutieren. Diese – so behauptete List – waren nicht allein das Ergebnis einer jahrelangen Forschungsarbeit, sondern in erster Linie das Produkt intuitiver Schauungen, die er nach einer zeitweiligen Erblindung im Jahr 1902 gemacht hatte. Bei dem Treffen wollte List seinen Freunden diejenigen Orte zeigen, die in seinem Werdegang vor diesem Zeitpunkt eine besondere Rolle gespielt hatten. Der erste Ausflug der Gruppe galt den Katakomben des Stephansdoms in Wien. Diese habe er – so schreibt List 1912 – im Jahr 1862, also als Vierzehnjähriger, das erste Mal besucht.
„Wir stiegen hinab und das Geschaute und Empfundene regte mich mit einer Mächtigkeit an, welche ich heute nicht mehr nachzuempfinden vermag. Da kamen wir […] vor einen verfallenen Altar. […] Da war meine Erregung aufs höchste gestiegen und wie im Fieberwahne rief ich mir vor diesem Altar laut das feierliche Gelübde zu: ‚Wenn ich einmal groß bin, werde ich einen Wuotanstempel bauen!‘ – Ich wurde selbstverständlich ausgelacht und mehrere Begleiter meinten, ein Kind gehöre nicht an solch einen Ort und dergleichen mehr. Freilich, sie alle, diese Guten, erfaßten es nicht, was in meiner Kinderseele vorgegangen war, konnten es nicht erfassen, und selbst mir ist es heute schwer erklärbar. […] Ja, dieses geheimnisvolle Erberinnern wurde damals in hoher, heiliger Weihestunde in mir […] geheimnisvoll geweckt, was die anderen nicht verstanden, nicht verstehen konnten, weil sie eben das nicht hatten, was uns zu eigen.“1
Der Wahrheitsgehalt dieser Erzählung aus Lists Jugendjahren lässt sich nicht überprüfen, wohl aber die Frage beantworten, warum List diese Jugenderinnerung mit seiner Leserschaft teilte. Er versuchte hier – das war auch für andere Passagen in seinen Werken kennzeichnend – ein Bild von sich zu konstruieren, nach welchem er, durch eine besondere Intuition begabt, wegweisende Entdeckungen über die germanische Vorzeit machen konnte, aber von seiner Umwelt, hier den Erwachsenen, später der akademischen Altertumswissenschaft, immer unverstanden blieb. Zu eigen war List zweifelsohne das lebenslange Interesse an der Geschichte und Mythologie der Germanen, welches sich wie ein roter Faden durch Lists Biographie zieht.2
Das reziproke Verhältnis von Eigen- und Fremddarstellung sowie die daraus resultierende Sicht auf Guido List als Person, sein Werk und insbesondere seine posthume Bedeutung ist Gegenstand dieser die Rezeptions- und Forschungsgeschichte vielfach problematisierenden ‚Hinführung‘. Sie soll einerseits den Blick dafür schärfen, dass ein rezeptionsgeschichtlicher Ansatz zu einer selektiven und damit verzerrten Sicht auf das Ausgangsmaterials führen kann. Andererseits gilt sie der Kontrastierung der Forschungsgeschichte mit der in dieser Arbeit postulierten These, das Früh- und Spätwerk Lists sei stärker durch Kontinuitäten von Ideen als von Brüchen gekennzeichnet (vgl. Kap. 2.1).
Vor der einleitend zitierten biographischen Erzählung über die Visionen des 14-Jährigen hatte List stets seine temporäre Erblindung im Jahr 1902 als Schlüsselerlebnis gekennzeichnet, welche ihm zu revolutionären Erkenntnissen über die Kultur und Religion der Germanen verholfen habe. Der Historiker Nicholas Goodrick-Clarke, der 1982 mit Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus ein Standardwerk zu Guido List vorlegte, charakterisierte dieses Jahr als „Zeuge einer grundlegenden Veränderung des Grundzuges seiner Ideen. Okkulte Vorstellungen durchdrangen seine Phantasie über das Schicksal der alten Germanen.“3 Damit folgte Goodrick-Clarke der Zäsur, die List selbst vorgenommen hatte, ohne zu prüfen, wie ‚grundlegend‘ diese Veränderung tatsächlich war. Das führte zu einer Teilung des list’schen Gesamtwerks in zwei Phasen, die in der Auseinandersetzung mit List in den vergangenen 40 Jahren immer wieder reproduziert wurde. Dass das bisherige Interesse an Lists Werken vor 1902, vornehmlich Dramen und Romane, aber auch historische Studien und vor allem über 160 Artikel, so gering war, ist mit Ausnahme der rezenten Studie Guido List – Poeta Vates der Österreichischen Alldeutschen (2019) des Literaturwissenschaftlers Petr Pytlík dem in der Listforschung dominanten rezeptionsgeschichtlichen Ansatz geschuldet. Viele der Listepigonen kannten die frühen Werke nicht, weil einige bereits zu Lists Lebzeiten vergriffen waren, während seine zahlreichen in den 1890ern publizierten Artikel nie gesammelt neu herausgegeben wurden, obgleich das eines der erklärten Ziele der 1908 gegründeten Guido von List-Gesellschaft (im Folgenden: GvLG) war.4
Offenbar war das Interesse an Lists Frühwerken weder in der posthumen Rezeption noch in seiner späteren Schaffensperiode groß genug, um ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. List waren nur wenige Weggefährten aus den 1880–1890er erhalten geblieben, nachdem er sich 1903 mit der Deutschnationalen Bewegung unter Karl Hermann Wolf (1862–1941) zerstritten hatte (vgl. dazu Kap. III/2.2.1). Mit seinen zwischen 1906–1914 veröffentlichen acht Werken konnte er sich hingegen neue Leserkreise erschließen. Was seine Werke attraktiv machte, war einerseits die systematische Darstellung seiner Thesen, die es so in den 1890ern nicht gab, andererseits machte er seine Methodik zur Entschlüsselung vermeintlich verborgener Botschaften in historischen Quellen, Sagen, Märchen, Volksbräuchen und Ortsnamen transparent, damit seine Leser auf deren Grundlage eigene Studien verfassen konnten. Der Rückgriff auf verschiedene Ideen zeitgenössischer politischer und alternativreligiöser Strömungen machte List zugleich für ein breites Publikum, etwa aus der Deutschnationalen und/oder Völkischen Bewegung, der Theosophie oder auch der Lebensreformbewegung, anschlussfähig.
1.1 Ariosophie oder Armanismus?
Eine Schlüsselfigur in der Listrezeption stellt Adolf Lanz alias Jörg Lanz von Liebenfels (1874–1954) dar, der bereits 1907 beim Aufruf zur Gründung der GvLG als Ehrenmitglied geführt wurde. Lanz widmete sich, anders als sein enger Freund List, nicht der Religion der ‚heidnischen‘, sondern der christlichen ‚Arier‘. Seine Lehre baut zusammengefasst auf der Annahme auf, die ‚Menschenrassen‘ seien durch die Vermischung von Engeln mit Tiermenschen entstanden und die ‚Arier‘ müssten sich nun durch ‚Reinzucht‘ des verunreinigenden ‚Sodomswasser[s]‘5 entledigen, um wieder ‚Gottmenschen‘ werden zu können. Wie List glaubt Lanz, historische Quellen seien in einer Geheimsprache verfasst, sucht aber anders als dieser vornehmlich in der Bibel nach Belegen für seine Thesen. Seine Lehre nannte er anfänglich ‚Theozoologie‘, ab 1915 dann ‚Ariosophie‘ (= ‚arisches Weistum‘6). Was Lanz mit List verbindet, ist der Fokus auf ‚Arier‘, ‚Germanen‘ und ‚Deutsche‘ sowie der Versuch, diesen eine den anderen Völkern der Welt überlegene Kulturstufe nachzuweisen. Beide verwenden Begriffe aus der Theosophie und suchen in historischen Quellen nach versteckten Botschaften, die ihre Thesen stützen. Diesen Gemeinsamkeiten stehen jedoch so gravierende Unterschiede entgegen, dass die einander anerkennenden Bezüge in ihren Werken verwundern.7 Lanz’ Fokus auf das Christentum, aber auch seine radikalen Positionen hinsichtlich der ‚Rassenfrage‘ waren List schlichtweg fremd. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass beide Autoren von der gegenseitigen Rezeption profitierten, weil sie sich so neue Leser in der Anhängerschaft des jeweils anderen erschließen konnten. In eine weltanschauliche Konkurrenz traten die beiden schon deswegen nicht, weil sie nur selektiv auf den jeweils anderen Bezug nahmen. In Lanz sah List nur einen „Rassenforscher“8, List war hingegen für Lanz von Liebenfels ein „Idealist, Mystiker und Romantiker“9, seine Entdeckungen lediglich „populär volkstümlicher Art“10.
Auf List nahm Lanz in seinen späteren Werken immer wieder Bezug, vereinnahmte ihn aber auch posthum und machte ihn, unterstützt von seinen Anhängern, zu einem Vordenker seiner eigenen Bewegung. Herbert Reichstein (1892–1944) etwa, der 1925 bis 1929 gemeinsam mit Lanz die Schriftenreihe Ariosophische Bibliothek – Bücherei für ariogermanische Selbsterkenntnis verlegte, bezeichnete sich selbst als „Schüler der beiden größten Priester des germanischen Edelblutes: Jörg Lanz von Liebenfels und Guido von List“11, bezog sich aber nur dann auf List, wenn er dessen Thesen mit denen von Lanz übereinbringen konnte. Wie sehr die ‚Ariosophen‘ der 1920er Jahre List für ihre Sache instrumentalisieren wollten, zeigt auch das ebenfalls bei Reichstein erschienene Guido von List-Heft (1927) in der Zeitschrift für Menschenkenntnis und Schicksalsforschung. Drei Autoren, darunter Lanz von Liebenfels, wollten darin dem „große[n] ariosophische[n] Seher“12 List ein Denkmal setzen. Gerade der Artikel von Arthur Wolf-Wolfsberg (Lebensdaten unbekannt) zeigt aber, wie wenig der Autor mit Lists Werken vertraut war und wie sehr er zugleich versuchte, rassentheoretische Überlegungen, also die Grundlage der Ariosophie, im Sinne von Lanz in Lists Werke hineinzudeuten.13 Zugleich räumt er ein, dass das, wofür ihn seine Anhänger hielten, mit Lists Selbstverständnis nichts zu tun hatte: „[Z]um Ariosophen, Gelehrten und großen Propheten haben ihn erst seine Jünger und Schüler gemacht“14. Die unkritische Arbeit mit solchen Quellen führte dazu, dass bei der bisherigen Erforschung Lists „die Ideen der Anhänger […] oft mit seinen eigenen Ideen identifiziert“15 wurden.
Die Frage, wie ähnlich sich die Ideen Lists und Lanz’ tatsächlich waren, war für das Forschungsinteresse Goodrick-Clarkes unerheblich, denn es ging ihm um die (letztlich verneinte) Frage, ob der Nationalsozialismus auch in okkult- rassistischen Kreisen mitentwickelt worden war. Goodrick-Clarke operationalisierte den Ariosophiebegriff von einer emischen Selbstbezeichnung hin zu einem metasprachlichen Begriff für eine ganze Bewegung. Seine Definition dieses Begriffes war aber mehr als dürftig:
„Der Begriff ‚Ariosophie‘ bedeutet okkulte, die Arier betreffende Weisheit. Er wurde 1915 das erste Mal von Lanz von Liebenfels verwendet und in den zwanziger Jahren zur Bezeichnung für seine Lehre. List nannte seine Lehre ‚Armanismus‘, während Lanz vor dem Ersten Weltkrieg die Begriffe ‚Theozoologie‘ und ‚Ario-Christentum‘ gebrauchte.
In diesem Buch wird ‚Ariosophie‘ generell zur Beschreibung der arisch-rassisch-okkulten Theorien dieser beiden Männer und ihrer Anhänger verwendet.“16
Ganz richtig deutete Goodrick-Clarke an, dass der Ariosophiebegriff in Lists Schriften an keiner Stelle auftauchte. Das lag einerseits daran, dass List nach 1914 nur noch wenige Texte publizierte, also kaum Gelegenheit hatte, den Begriff zu übernehmen, andererseits dass er sich selbst eben nicht als Ariosoph verstand, weil der Begriff zu seinen Lebzeiten zu deutlich mit Lanz’ Theorien verbunden war. Die Wurzeln des Ariosophiebegriffes liegen also nicht in den Gemeinsamkeiten zwischen List und Lanz, sondern in der posthumen Listrezeption des Kreises um Lanz in den 1920er Jahren. Seine metasprachliche Anwendbarkeit auf List ist also fraglich. Dessen ungeachtet prägte Goodrick-Clarke mit seiner Definition die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit List bis heute maßgeblich, denn in der Sekundärliteratur sind die Begriffe ‚Guido List‘ und ‚Ariosophie‘ untrennbar verbunden.17
Der Begriff ‚Armanismus‘, welchen Goodrick-Clarke in seiner Ariosophiedefinition ebenfalls nennt, beschreibt hingegen treffend Lists Theorien ab 1906, in denen er eine elitäre Kaste innerhalb der ‚ario-germanischen‘ Gesellschaft beschreibt – die ‚Armanen‘. Seine Ideen wurzeln in der Annahme, dass alles, was seinerzeit über die Religion der Germanen bekannt war, nur eine exoterische Volksreligiosität (‚Wuotanismus‘) darstellte, in deren Mythen und Bräuchen aber ein esoterischer Kern, der Armanismus, verborgen sei. Der Armanismusbegriff bezeichnete also im Grunde genommen nur einen Teil der list’schen Lehre. Da sich List jedoch mit dem Wuotanismus kaum beschäftigt, bzw. nur dann, wenn er an ihm die ‚Exoterisierungsstrategien‘ der Armanenschaft verdeutlichen will, scheint der Begriff ‚Armanismus‘ als Überbegriff passend und wird daher auch in dieser Arbeit verwendet.
In die Verwendung des Ariosophiebegriffes ist noch eine weitere Bedeutung eingeschrieben, die hier zumindest angerissen werden soll, nämlich die analog zur Kategorisierung völkischer Religiosität vorgenommene Trennung in eine ‚christliche‘, durch Lanz vertretene, Ariosophie sowie eine ‚germanische‘, welche von List repräsentiert wird. Zwar ist es durchaus richtig, dass dem Christentum nicht Lists hauptsächliches Interesse galt, sein Versuch aber, eine vermeintlich ‚ursprüngliche‘ Lehre Jesu als mit dem Armanismus übereinstimmende Geheimlehre zu deklarieren, machte ihn auch für (völkisch-)christliche Leser anschlussfähig. Das gilt auch für seine Versuche, in der Bibel, Heiligenlegenden, christlicher Symbolik oder volksreligiösem Brauchtum armanische Lehren nachzuweisen.18 Seiner Argumentation folgend, war das Christentum nicht anders als der Wuotanismus nur die exoterische Hülle einer esoterischen Religion, die allen historischen und bestehenden Religionen zugrunde liegt – also eine „allgemeine Weltreligion“19. In logischer Konsequenz schlossen sich Christsein und Armanismus also nicht aus.
1.2 List und ‚der‘ Nationalsozialismus
Nachdem Goodrick-Clarke gezeigt hatte, dass die „Ariosophie […] mehr ein Symptom denn ein tatsächlich einflußnehmender Faktor in der Art und Weise [war], wie sie den Nationalsozialismus vorwegnahm“20, schwand das Interesse an einer neuen Untersuchung Lists zumindest in der Geschichtswissenschaft rapide. Goodrick-Clarke konnte zeigen, dass zwar vereinzelte Nationalsozialisten wie Karl Maria Wiligut (1866–1946), der im Auftrag Heinrich Himmlers (1900–1945) zur germanischen Vorgeschichte forschte, von List beeinflusst waren, dass es aber nicht zweifelsfrei belegbar sei, dass Hitler (1889–1945) von List überhaupt gehört hatte.21 Damit reagierte Goodrick-Clarke auf die Theorie, List sei ein zentraler Vordenker des Nationalsozialismus gewesen, wie sie bereits 1949 von dem Journalisten Joachim Besser (1913–1977) in seinem Buch Der Okkultismus stand Pate – Hitlers geistige Herkunft vorgelegt wurde.22 Ihm folgte 1961 Inge Kunz’ Dissertation Herrenmenschentum, Neugermanen und Okkultismus – Eine soziologische Bearbeitung der Schriften von Guido List. Kunz versuchte – entgegen dem Titel – einen tiefenpsychologischen Vergleich der Schriften Lists mit denen der führenden Nationalsozialisten, wie etwa Adolf Hitler oder Heinrich Himmler, zu ziehen. List sei durch die Ablehnung seiner Umwelt innerlich zerrissen gewesen und da „die Analogie zwischen dem Nationalsozialismus und List in diesem inneren Chaos, dieser kranken Vorstellungswelt besteht, wurden Zitate von Nationalsozialisten direkt neben diejenigen Lists gesetzt“23. Kunz verzichtete damit darauf, direkte Verbindungslinien zwischen List und Nationalsozialismus nachzuweisen und beschränkte sich darauf, Parallelen aufzuzeigen. Hitler und List attestierte sie schließlich eine „gleichgelagerte[.] psychische[.] Einstellung“24, während sie für Lists Ideen eine monokausale Erklärung suchte:
„Der Durchbruch des Oedipuskomplexes ist […] in sämtlichen Schriften Lists, seine philosophischen Spekulationen nicht ausgenommen, so determinierend, dass sie Schlechthin [sic!] unverständlich bleiben, ohne dessen bewusste Berücksichtigung bei der Untersuchung seiner Gedankenfolge.“25
Kunz war nicht eigenständig auf List gestoßen und schon gar nicht auf den vermeintlichen Zusammenhang zu Hitler, sondern verdankte die Idee dem Wiener Tiefenpsychologen Wilfried Daim (1923–2016), der sich bei seiner Arbeit an dem Buch Der Mann, der Hitler die Ideen gab (1958) auch mit List beschäftigt hatte.26 Daim hatte in seinem Buch zu zeigen versucht, dass Hitler während seiner Zeit in Wien Adolf Lanz getroffen und intensiv seine Schriftenreihe Ostara – Bücherei der Blonden studiert hatte. Ausgangspunkt für diese Thesen waren die Aussagen Lanz’ selbst, mit dem Daim wenige Jahre vor dessen Tod noch ein Interview führte.27 Der zu diesem Zeitpunkt 77-Jährige äußerte den Verdacht, ihm sei während der nationalsozialistischen Herrschaft nur deswegen ein Schreibverbot erteilt worden, weil Hitler seine eigentlichen Quellen verschleiern wollte.28 Da Wien noch von den Alliierten besetzt war und Daim Lanz, den er wegen seiner Ideen für psychisch krank hielt, keine Schwierigkeiten bereiten wollte, zögerte er die Publikation bis zu dessen Tod 1954 hinaus.29 Die Geschichte vom jungen Hitler, der Lanz von Liebenfels besucht hatte, um weitere Ostara-Hefte zu kaufen, zweifelte Daim jedoch nicht an, sondern suchte im Gegenteil akribisch nach weiteren Beweisen dafür.30 Bei seiner Beschäftigung mit der Bedeutung des Hakenkreuzes bei Lanz stieß er schließlich auf List. Da sich Daim nicht erklären konnte, warum Lanz das Hakenkreuz für den von ihm gegründeten Neutemplerorden (ONT) verwendete, griff er auf Lists entsprechende symbologische Deutungen zurück. Dabei kam ihm entgegen, dass List das Templerkreuz als zwei übereinandergelegte, gegenläufige Hakenkreuze gedeutet hatte, woraus Daim schloss, zwischen Lanz und List habe eine „sehr intensive Beziehung“31 bestanden. Einziges Indiz für diese These war jedoch nicht mehr, als dass sich beide Autoren zur gleichen Zeit für das gleiche Symbol interessierten.32 Mit Schlüssen wie diesen trug Daim maßgeblich dazu bei, einen Zusammenhang zwischen den beiden Autoren zu konstruieren, welcher auf Goodrick-Clarkes Erweiterung des Ariosophiebegriffes um die Thesen Lists eventuell eingewirkt hat.
Daim hielt List nicht nur für ‚den Mann, der Lanz von Liebenfels die Ideen gab‘, sondern er versuchte auch zu zeigen, dass Hitler Lists Schriften gelesen hatte. Seine Hauptquelle für diese These waren die Zeugnisse Elsa Schmidt-Falks (Lebensdaten unbekannt), die während der NS-Zeit im Gausippenamt in München gearbeitet hatte und behauptete, Hitler mehrfach persönlich getroffen und mit ihm über List und Lanz gesprochen zu haben.33 Hitler habe sie beauftragt, nach dem Vorbild von Lists Deutsch-Mythologischen Landschaftsbildern (1891) ‚Bayrisch-Mythologische Landschaftsbilder‘ zu verfassen, und sei mit den Schriften Lists bestens vertraut gewesen.34 Daim schenkte seiner Informantin uneingeschränkt Glauben, und Kunz tat es ihm in ihrer Dissertation nach.35 Obwohl es Goodrick-Clarke gelang, den Wahrheitsgehalt der Aussagen Schmidt-Falks überzeugend in Zweifel zu ziehen, halten sich die Behauptungen Schmidt-Falks sowie die damit verbundene Verknüpfung zwischen List und Hitler bis heute hartnäckig in Teilen der Forschungsliteratur.36
Das Festhalten an dieser Theorie führte zu manchen Fehldeutungen, wie etwa die Auseinandersetzung mit Lists Konzept des ‚Starken von Oben‘ zeigt, welches sich bis in die 1890er Jahre zurückverfolgen lässt.37 List bezog sich damit auf eine Strophe des Eddaliedes Völuspá, meinte aber „keine physische Persönlichkeit[…], sondern eine göttlich-geistige Kraftquelle […], die sich der Volkspsyche bemächtigen wird“38 oder auch (List widersprach sich oft) die wiedergeborenen Gefallenen des Ersten Weltkrieges.39 Noch ausgehend von der Idee einer Beeinflussung Hitlers durch List behaupten aber einige Autor:innen, List habe den ‚Starken von Oben‘ personal gedacht und somit „wesentliche Elemente des Führermythos vorgeprägt“40. Diese Ansicht vertrat z. B. Kunz: „Als Hitler an die Macht kam, konnte er bei seinen Zuhörern an bereits verankerte Vorstellungen appellieren und als erwarteter ‚Starker von Oben‘ seine Herrschaft antreten“41. Diese These ging auf die Behauptung Schmidt-Falks zurück, Hitler habe sich selbst für den ‚Starken von Oben‘ gehalten.42 Der Archäologe Manfred Kandler (*1941), der knapp 20 Jahre die Ausgrabungen in Carnuntum leitete – eine römische Ruine in der Nähe Wiens, über welche List 1888 einen Roman verfasst hatte – brachte den ‚Starken von Oben‘ mit Lists Schrift Der Unbesiegbare (1898) in Verbindung und behauptete, List habe ihm das Hakenkreuz zugeordnet. Das war schlichtweg falsch, passte aber zu Kandlers direkt folgender These, Hitler habe sich allein auf Grundlage von Lists Das Geheimnis der Runen (1908) für das Hakenkreuz als Zeichen seiner Bewegung entschieden.43 Auch andere Behauptungen hinsichtlich des vermeintlichen Einflusses Lists auf Hitler, etwa dass „List die doppelte Siegrune SS als Symbol eines neuen rassereinen Reiches“44 empfohlen habe, lassen sich nicht belegen.
1.3 Das Jahr 1902 – eine Zäsur im Gesamtwerk?
Einleitend wurde bereits auf Lists zeitweilige Erblindung sowie die damit scheinbar verbundene Zäsur in seinem Gesamtwerk hingewiesen. List berichtete von ihr erstmalig in einer Art Widmung an seinen Freund und Gönner Friedrich Wannieck (1838–1919) in der Erstauflage von Das Geheimnis der Runen (1907), welches ein Jahr zuvor, allerdings ohne den Zusatz über seine Entstehungsgeschichte, in der Monatsschrift Neue Metaphysische Rundschau erschienen war. List beschrieb die Genese seiner Entdeckung über die Bedeutung der Runen wie folgt:
„Als ich Ihnen […] anfangs November 1902 davon Mitteilung machte, dass ich während der Zeit, in welcher infolge von Staroperationen mein Auge durch mehrere Monate unter der Binde lag, an jeglicher Arbeit verhindert, um mich geistig zu beschäftigen das Geheimnis der Runen zu enträtseln gedachte und dabei – im freien Spiele der Gedanken! – auf bisher ganz ungeahnte Entstehungs- und Entwicklungsgesetze unseres arischen Volkes, seines Fühlens, Denkens, Sprechens und Schreibens kam, da waren Sie so gütig[,] mich brieflich zu diesen Findungen zu beglückwünschen.“45
In dem anonym veröffentlichten Heft Guido von List – Ein moderner Skalde (1908), das gewissermaßen den Auftakt zur später von der Guido von List-Gesellschaft veröffentlichten Guido-List-Bücherei bildete, schrieb der Autor mit Bezug auf die Erblindung: „Für Lists Schaffen beginnt ein neuer Abschnitt“46. Auch Johannes Balzli (1864–1939, Orthonym: Karl Brandler-Pracht), ein Anhänger Lists, der 1917 eine Listbiographie verfasste, griff dieses Ereignis unter der Zwischenüberschrift „Beginn einer neuen Schaffensepoche“ auf:
„Das Jahr 1902 hat ganz besondere Bedeutung im Werdegang des Meisters. In diesem Jahre war nämlich Guido v. List infolge Schichtstars […] für 11 Monate fast völlig erblindet. In dieser Zeit, da das physische Auge in Latenz getreten war, erfreute sich Guido v. List des Hellgesichtes und einer ungemein regen Tätigkeit des Gedächtnisses und der Intuition, und in diesen Monden enthüllte sich ihm Gewaltiges.“47
Schon Kunz hatte ihre Darstellung der list’schen Schriften in eine ‚Periode der dichterischen Werke‘ und eine ‚Periode der theoretischen Schriften‘ eingeteilt.48 Wie problematisch die These von einem Bruch in Lists Werk ist, zeigt bereits die Schwierigkeit, diesen genau zu datieren. Kunz hatte der ‚dichterischen Periode‘ die Schriften Lists von Die Burg der Markgrafen der Ostmark auf dem Leopoldsberge in Wien (1877) bis zu seinem ersten Roman im Jahr 1888 zugeordnet, obwohl Lists publizistische Tätigkeit bereits 1871 begann und – um in Kunz’ Terminologie zu bleiben – sowohl ‚theoretische‘ als auch ‚dichterische‘ Schriften umfasste. Einen Einschnitt bei Carnuntum (1888) zu machen, ist sinnvoll, weil der Roman List den Kontakt zu seinem späteren Mäzen Friedrich Wannieck vermittelte und ihn einem breiteren Publikum bekannt machte. Die eigentliche Zäsur datierte Kunz dann auf das Gründungsjahr der GvLG (1908), besprach jedoch das eigentlich ein Jahr zuvor publizierte Werk Das Geheimnis der Runen (1907) in diesem Kapitel. Auch wenn Kunz von allen im Folgenden besprochenen Autor:innen das späteste Jahr wählte, bezog auch sie sich dabei auf Lists Erblindungsnarrativ. Im Jahr 1902, so Kunz, müsse eine „innere Wandlung stattgefunden haben, denn von nun an widmete sich List ausschliesslich theoretischen ‚Forschungen‘ über die Kultur der Ario-Germanen“49.
So hart wie Kunz und nach ihr Goodrick-Clarke diesen Bruch beschrieben, ist er aber nicht gewesen. Seine ‚Erblindung‘, welche – so deutet es sein Bericht in Das Geheimnis der Runen (1907) an – allenfalls von einem Verband herrührte, führte nicht umgehend zu einer Abkehr von den ‚dichterischen Schriften‘. Im Gegenteil: List publizierte im Jahr 1902 etwa im Zweimonatsrhythmus Kurzgeschichten in deutschnationalen Zeitungen und Kalendern. Ein Jahr später folgten dann das Drama Das Goldstück (1903) sowie die Novellensammlung Alraunenmären (1903). Ignoriert man ein 1906 noch in der Neuen Metaphysischen Rundschau veröffentlichtes Gedicht, endete seine ‚dichterische Periode‘ also nicht schlagartig, sondern erst Ende des Jahres 1903. Goodrick-Clarke führte übrigens Lists Drama sowie die Novellensammlung durchaus in seiner Listbibliographie auf, erwähnte sie aber im Haupttext nicht, sodass die Lektüre ebenfalls den Eindruck hinterlässt, List habe sich nach seiner Operation umgehend esoterischen Schriften zugewandt.50 Balzli, der in seiner Listbiographie das Jahr 1902 als ein besonderes herausstellen wollte, änderte ebenfalls leicht die Chronologie, obwohl er mit den richtigen Jahreszahlen arbeitete: für die Jahre 1899–1903 verzeichnete er eine Konzentration auf dramatische Dichtungen, auch wenn er fälschlicherweise den Aufsatz Der Wiederaufbau von Carnuntum (1900) dazuzählte, um schließlich den zuvor zitierten Absatz über Lists Erblindung folgen zu lassen.51 Autoren wie Manfred Ach/Clemens Pentrop (1977) und Linus Hauser (2004) fügten der Erblindungserzählung noch ein mystifizierendes Detail hinzu, nämlich die Heilung durch einen Okkultisten, die wohl auf einen Lesefehler zurückgeht.52
Auch wenn die Datierung des Bruches in Lists Gesamtwerk variiert, haben sich mit Ausnahme von Kunz, also seit 60 Jahren alle Autor:innen ausschließlich auf eine dieser ‚Phasen‘ konzentriert – mit Ausnahme Petr Pytlíks immer auf jene nach 1902. Der Grund dafür liegt in der Rezeptionsgeschichte Lists, denn das waren die Werke, die nach Lists Tod bis heute am stärksten rezipiert werden, während die Trennung seines Werks den Eindruck vermittelt hatte, in ‚Phase I‘, also den ersten 54 Jahren seines Lebens, sei mit Ausnahme der Veröffentlichung von Romanen, Dichtungen und Dramen nichts Entscheidendes passiert. Darüber hinaus widmeten sich die meisten dieser Arbeiten eben nicht der Genese des Religionsentwurfes Lists, sondern im Gegenteil List als Progone anderer Autor:innen und Bewegungen, etwa des zeitgenössischen germanischen Neuheidentums, der Runenesoterik oder – wie bereits gezeigt wurde – der ‚Ariosophie‘ oder gar des Nationalsozialismus. Viele Autor:innen erwähnen seine frühen Schriften nicht einmal oder aber nur vereinzelt die späten der frühen Schriften, wie etwa Den Unbesiegbaren (1898), und steigen dann für die biographische Schilderung Lists direkt bei der Erblindung ein.53 Zwar lässt sich über das genaue Datum der Abkehr von den ‚dichterischen‘ Schriften streiten, dass diese stattfand, lässt sich jedoch nicht leugnen. Problematisch ist jedoch die Behauptung, poetische Werke seien der eigentliche Kern der ersten Phase gewesen sowie der daraus gezogene Schluss, man könne sie getrost ignorieren. Dieser Vorstellung stehen drei zentrale Argumente entgegen, welche die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit entscheidend beeinflussen.
Erstens publizierte List vor 1902 neben seinen historischen Romanen und Novellen, den Dramen und Weihespielen auch Werke mit historischer, kultureller und/oder politischer Zielsetzung, nämlich Die Burg der Markgrafen der Ostmark auf dem Leopoldsberge in Wien (1877), Deutsch-Mythologische Landschaftsbilder (1891), Literaria Sodalitas Danubiana (1893), Der Unbesiegbare – Ein Grundzug germanischer Weltanschauung (1898), Niederösterreichisches Winzerbüchlein (1898) und Der Wiederaufbau von Carnuntum (1900). Darüber hinaus erschienen in meist deutschnationalen Zeitungen, Zeitschriften und Jahrbüchern über 100 Artikel, in denen sich List mit Geschichte, Mythologie, Sagen- und Brauchtumsforschung beschäftigte, die bisher aber nie untersucht worden sind.54 Das Diagramm in Anhang 4.1, in welchem alle in der Bibliographie aufgeführten Texte berücksichtigt sind, veranschaulicht, wie produktiv List in Phase I gewesen ist und wie stark seine Publikationstätigkeit – zumindest in Bezug auf Artikel – in den Jahren nach 1902 abnahm.
Zweitens wird die Einteilung in ‚dichterisch‘ und ‚theoretisch‘ Lists Selbstverständnis nicht gerecht, wie eindrücklich das Vorwort zu seinem Roman Carnuntum (1888) beweist. Dichtung war in Lists Augen nicht das Gegenteil der Wissenschaft, sondern eine bessere Form derselben, weil sich mit Fantasie Lücken, etwa in historischen Quellen, schließen ließen, die allein mit wissenschaftlichen Methoden nicht überbrückbar seien. In einem historischen Roman müsse, so List, „jedes Wort wahr sein“55. Was List also in seinen Romanen und Erzählungen über die Religion und Lebensweise der Germanen schrieb, hielt er für die Wirklichkeit, wie die zahlreichen Fußnoten in seinen literarischen Texten sowie der Abgleich mit seinen zeitgenössischen Forschungsarbeiten zeigen. Auf die Entgrenzung zwischen poetischen und wissenschaftlichen Textsorten bei List wies auch 1927 der bereits zuvor zitierte Arthur Wolf-Wolfsberg hin, der seiner Listbibliographie nachfolgenden Passus voranstellte:
„Wenn wir das Schaffen dieses Geistesgiganten annähernd überblicken wollen, so müssen wir uns vor allem anderen drüber klar werden, was eigentlich bei Guido v. List Dichtung ist, was Wissenschaft. Dies ist aber insofern sehr schwierig, als der Meister selbst im Sinne des heutigen Sprachgebrauches gar nicht Wissenschaftler sein wollte, seine Findungen und Forschungen […] stets mit dem Dunste einer wohltuenden Poesie umgab und sich nie als etwas anderes fühlte, denn als Armane, Skalde, Dichter […]. Unter Beibehaltung der von seinen Anhängern durchgeführten Trennung: Hier Dichter! – Hier Forscher! will ich nun daran gehen, das Schaffen dieses großen Mannes aus seinen Werken zu beleuchten.“56
Die Lektüre der bisher vernachlässigten, nur scheinbar fiktionalen Texte, der zahlreichen Artikel und schließlich der als nicht-poetisch klassifizierten Werke zeigt schließlich drittens, dass List seine zentralen Thesen in Bezug auf den Armanismus nicht nach, sondern vor 1902 entwickelte. Bereits in Carnuntum (1888) gehört Religion inklusive einer Priesterschaft, die geheime Lehren (Esoterik) in anderer Form für das Volk aufbereitet (Exoterik), zu den zentralen Themen, während Runen ebenso thematisiert werden wie die für Lists Armanismus fundamentale Reinkarnationslehre. Sein Buch Deutsch-Mythologische Landschaftsbilder (1891) sowie der Artikel Von der deutschen Wuotanspriesterschaft (1893) nehmen schließlich ebenso viel seiner späteren Lehre vorweg wie die insbesondere in der Ostdeutschen Rundschau veröffentlichten Artikel der 1890er Jahre. Neben den zentralen Thesen, also der Trennung von Esoterik und Exoterik, dem Konzept ‚Entstehen, Werden, Vergehen zum Neuentstehen‘, der ‚Gottinnerlichkeit‘ sowie der Geheimsprache ‚Kala‘, finden sich in Lists Werken auch Kontinuitäten hinsichtlich der Interpretation einiger Eddalieder bis hin zur Wiederholung einzelner Passagen im Wortlaut über drei Jahrzehnte hinweg. Dem Aufzeigen dieser Kontinuitäten, aber auch der Brüche, ist diese Arbeit in erste Linie gewidmet.
So offensichtlich diese Parallelen zwischen Phase I und II sind, umso unbegreiflicher ist es, dass diese zuvor nicht gesehen wurden. Zwar hatte Kunz schon 1961 bemerkt, dass sich der „Dualismus von Armanismus und Wuotanismus […] durch Lists ganzes Werk zieht“57, es dauerte jedoch knapp 60 Jahre, bis diese Beobachtung untersucht wurde. Der Literaturwissenschaftler Petr Pytlík beschäftigte sich in seiner Dissertation Guido List – Poeta Vates der österreichischen Alldeutschen (2019) als bisher einziger Autor neben Kunz mit den literarischen Produktionen Lists vor 1902. Er stellte fest, dass es bei der Rezeption Lists wegen der Ausklammerung des Frühwerks zu Verzerrungen gekommen war.58 Seine literarischen Werke bezeichnete Pytlík als „wenig gelungene Versuche eines mittelmäßigen Dichters“59 und stellte ihre Literarizität in Frage. Ziel seiner Arbeit sei es stattdessen, List als einen besonderen Autorentypus zu charakterisieren, der von seinen Anhängern als Prophet verehrt wurde und seine Weltanschauung über poetische Erzählungen verbreitete.60 Zwar verwendete auch Pytlík kritiklos den Ariosophiebegriff und teilte Lists Werk in zwei ‚Entwicklungsphasen‘, nämlich die ‚literarische‘ und die ‚pseudowissenschaftliche‘ ein,61 zugleich wies er aber auf entscheidende Forschungslücken, etwa das Fehlen einer akkuraten biographischen Arbeit über List, hin.62 Darüber hinaus könne sein Werk, insbesondere hinsichtlich der behaupteten Gründungsfunktion in Bezug auf das germanische Neuheidentum, für Religionswissenschaftler:innen von Interesse sein.63 Pytlík bezog sich kaum auf die Werke nach 1902, obwohl auch er feststellte,
„dass die von List entworfene ‚urgermanische Religion‘, so wie er sie nach 1902 in seinen pseudowissenschaftlichen Werken definierte, schon in seinen ersten Werken enthalten ist und dass sich deren Prinzipien während der Zeit kaum verändert hatten.“64
Diese Verbindungslinien waren jedoch nicht Gegenstand seiner Analyse, sodass es bei wenigen Andeutungen blieb. Durch die Konzentration auf politische Diskursfelder, insbesondere Lists Frauenbild und seinen Antisemitismus, interessierte sich Pytlík darüber hinaus nicht für die „langweilige[n] Beschreibungen des Lebens und der Religion der alten Germanen“65 in Lists historischen Romanen, die stattdessen in dieser Arbeit im Vordergrund stehen. Positiv hervorzuheben sind die wichtigen Erkenntnisse, die Pytlík durch den Vergleich der literarischen Werke Lists hinsichtlich der Frage liefert, wie List sich selbst inszenierte und politische Positionen aus dem deutschnationalen Spektrum in seine Werke einflocht. Darüber hinaus recherchierte Pytlík intensiv zur Publikationstätigkeit des Deutschen Hauses in Brünn, in welchem List einige seiner Werke veröffentlichte und welches von seinem Mäzen Friedrich Wannieck begründet wurde.
Der entscheidendste Autor, der auf die Parallelen zwischen Phase I und II hinwies, war jedoch List selbst. Im Jahr 1912 sollte nämlich das erstmals 1891 erschienene Buch Deutsch-Mythologische Landschaftsbilder in zweiter Auflage erscheinen. List bezeichnete es selbst als sein „Lieblingsbuch“, denn es sei der „Grundkeim meines Empfindens, Suchens, Forschens, Findens, Erkennens“66. Auch Wolf-Wolfsberg, der aber offenbar nur die Zweitauflage kannte, wies auf die Bedeutung dieses Buchs hin und besprach es in seiner Bibliographie als die erste von Lists Forschungsarbeiten, der er dann direkt das erst 16 Jahre später verfasste Buch Das Geheimnis der Runen (1907) folgen ließ.67 Im Vorwort der Zweitauflage ließ die GvLG dann verlautbaren, List könne nur nach Lektüre dieses Werks verstanden werden. Es sei „die Pforte zu der Weltanschauung, die der Meister entdeckt und neu begründet“68 habe. List stand bei der Überarbeitung seines Werks für die Zweitauflage vor einem Problem, denn er musste bei der erneuten Lektüre erkennen, dass „zu allen meinen Forschungsergebnissen, die ich in der Guido-List-Bücherei niedergelegt hatte, dort schon der solide Grund gelegt war.“69 Das widersprach aber der Erzählung, die Befähigung zur ‚Erberinnerung‘, also der Rückgriff auf das Wissen früherer Inkarnationen, sei erst mit seiner zeitweiligen Erblindung geweckt worden. Das einleitende Zitat zu dieser Arbeit über die Vision des 14-jährigen List in den Katakomben des Stephansdoms entstammt daher nicht zufällig der Zweitauflage der Deutsch-Mythologischen Landschaftsbilder (1912). Wie gelungen diese Aktualisierung des eigenen Personenmythos war, zeigt sich auch daran, dass seine Anhänger die Geschichte begeistert aufgriffen und reproduzierten. Balzlis erster Satz seiner Listbiographie lautet „[s]chon im Knaben Guido erwachte das Erb-Erinnern“70 und Wolf-Wolfsberg stellte seiner Bibliographie das Gelübde über den Bau des Wuotanstempels als Motto voran.71
Um zu verstehen, wie List die Kontinuitäten in seinem Früh- und Spätwerk für die eigene Selbstinszenierung instrumentalisierte, lohnt sich ein Vergleich beider Auflagen, der in Kap. I/6 vertieft wird, hier aber bereits angerissen werden soll. List behauptete nämlich, er habe in der Zweitauflage nichts geändert, was schon deswegen skeptisch beurteilt werden sollte, weil das Buch 1912 nicht in einem, sondern in zwei Bänden erschien. Seine Korrekturen am 1891 bereits bestehenden Text waren schließlich gleichermaßen minimal, wie sie effektiv waren, denn er ersetzte bestimmte Begrifflichkeiten durch die Termini, die für seinen Entwurf des Armanismus ab 1906 kennzeichnend waren. Das verstärkte den sich ohnehin aufdrängenden Verdacht, er habe seine Thesen zehn Jahre früher als zuvor behauptet entwickelt. Die wohl wichtigste Änderung betrifft jedoch die Streichung einer Literaturangabe, die offenbarte, dass Lists wohl wichtigste ‚Entdeckung‘, die ‚Arische Ursprache‘ sowie die damit verbundene Geheimsprache ‚Kala‘, die für seine Arbeitsweise von fundamentaler Bedeutung war, nicht von ihm stammte. Stattdessen verdankte er sie dem Sprachforscher Heinrich Hermann Gustav Ferdinand Schliep (1834–1911), zwischen dessen Buch Licht! Was keiner geahnt! Ein Buch für alle Germanen (1888) und Lists Thesen es so viele – teils wörtliche – Parallelen gab, dass List ein Plagiat Schlieps unterstellt werden darf (vgl. Kap. III/3.1.3). Dass die Verbindung zwischen Schliep und List bisher nie auffiel, dürfte erneut der Tatsache geschuldet sein, dass sich bisherige Autor:innen auf die Werke nach 1902 konzentrierten.72 Wenn sie die Deutsch-Mythologischen Landschaftsbilder (1891/1912) in ihre Analyse miteinbezogen, dann immer die in ihrem Untersuchungszeitraum liegende Zweitauflage, in welcher der Verweis auf Schliep fehlt.
1.4 Der Armanismus – eine ‚germanisierte Theosophie‘?
Bei der Suche nach den Ursprüngen von Lists Lehre gelangte Goodrick-Clarke zu dem Schluss, diese sei eine „Germanisierung der Theosophie“73. Er behauptete, List habe ein „beträchtliches Wissen über theosophische Einzelheiten“74 besessen. Lists Verbindungen zur Theosophie scheinen offenkundig zu sein: Nicht nur waren einige der Mitglieder der GvLG selbst Theosophen – die Theosophische Gesellschaft Wien trat 1910 geschlossen bei –, es finden sich auch zentrale theosophische Konzepte in seinen Werken. Das gilt insbesondere für seine Ausführungen in Die Religion der Ario-Germanen in ihrer Esoterik und Exoterik (1910), in welchen er die ‚Natur-Ur-Gesetze‘, also den Kern des Armanismus darlegt, die zum Teil deutliche Parallelen zu theosophischen Konzepten und Begriffen aufweisen – bis hin zu einer vergleichsweise ausführlichen Auseinandersetzung mit Blavatskys (1831–1891) Berechnung kosmischer Zeitspannen.75 Gerade diese Passage, in welcher List „der Kürze wegen“76 sehr nah an seiner Quelle bleibt, kann aber entgegen der Einschätzung Goodrick-Clarkes auch als mangelnde Beschäftigung mit der Theosophie gedeutet werden, weil List sich nicht – wie andernorts – die Mühe gibt, die von Blavatsky verwendeten Sanskritbegriffe durch ‚germanische‘ Begriffe zu ersetzen und ihre Thesen in sein System einzufügen. Die Analyse seiner Thesen, etwa in Bezug auf Reinkarnation oder die Einheit von Mensch und Gottheit sowie der Vergleich mit ihren vermeintlich theosophischen Ursprüngen, lässt berechtigte Zweifel daran aufkommen, List habe die Theosophie wirklich durchdrungen (vgl. Kap. II/2).
Da sich ein Kontakt zur Theosophie in Phase I nicht nachweisen lässt, für den Armanismus zentrale Thesen, wie eben Lists Reinkarnationslehre, hier aber bereits vorhanden sind, liegt der Schluss nahe, dass die Wurzeln seiner Ideen andernorts zu suchen sind. Das bedeutet nicht, die offenkundigen Parallelen zwischen Armanismus und Theosophie zu negieren, wohl aber, ihren Stellenwert als originären Faktor in der Ausarbeitung seines Religionsentwurfes in Frage zu stellen. Im Gegenteil scheint List nach 1902 zunehmend festgestellt zu haben, wie sehr theosophische Konzepte mit seinen bereits in Phase I entwickelten Ideen konvergierten und sie entsprechend angepasst zu haben, auch wenn das unweigerlich zu Widersprüchen führte. Die Rezeption der Theosophie bot nach seinem Bruch mit der Deutschnationalen Bewegung (vgl. Kap. III/2.2.1) die Möglichkeit, für einen neuen Rezipientenkreis anschlussfähig zu werden. Als verbindendes Element schien die Beschäftigung mit den ‚Ariern‘ ausreichend zu sein. Die „theosophische Bewegung“, so hieß es 1906 in der Metaphysischen Rundschau, in der List sein Buch Das Geheimnis der Runen (1906) als Artikelserie erstveröffentlichte, „ist im letzten Sinne nichts anderes als das Wiedererwachen arischen Denkens und Lebens, und deshalb gehört List in unsere Reihen, denn er ist ein Erwecker des Ariertums“77. Angesichts der Tatsache, dass die GvLG Lists Lebensunterhalt finanzierte, ist die Frage berechtigt, inwieweit die Adaption der Theosophie aus ihrer Überzeugungskraft für List oder aus der Notwendigkeit einer Anpassung an eine neue Leserschaft resultierte. In jedem Fall – darauf wies auch bereits 2007 Helmut Zander hin – steht ein detaillierter Vergleich von Armanismus und Theosophie bislang noch aus.78
Neben den offenkundigen Anleihen aus theosophischen Lehren argumentiert Goodrick-Clarke auch mit Lists Rezeption der Werke Max Ferdinand Sebaldt von Werths (1859–1916). Goodrick-Clarke gelingt es jedoch nicht, schlüssig zu erklären, nach welchen Kriterien er diese Schriften der Theosophie zuordnet. Vielmehr scheint ihm jeder als Theosoph zu gelten, der mit Theosophen zusammenarbeitete. Sebaldt von Werth charakterisiert er schließlich als „Vorläufer der Ariosophie, insofern er rassische Lehren mit okkulten Gedanken“79 kombinierte. Zweifelsohne gehörte die Theosophie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu den prominentesten Strömungen okkultistischer Diskurse in Europa, weswegen aber nicht jede ‚okkulte‘ – Goodrick-Clarke bleibt eine Definition schuldig – Lehre auch zwingend theosophisch sein musste. Dass List indessen selbst ab 1893 den Theosophiebegriff verwendete, deutet nicht auf eine Rezeption der modernen Theosophie im Sinne Blavatskys hin, weil die entsprechenden Bezüge fehlen und List den Begriff stattdessen als Synonym zum Religionsbegriff verwendete. Wenn List etwa von den „theosophischen Anschauungen unserer Ahnen“80 schreibt, dann will er damit den Fokus seines Religionsentwurfes auf den ‚germanischen‘ Gottesbegriff lenken. Ausgerechnet mit seiner beginnenden Theosophierezeption in Phase II wird der derart verwendete Theosophiebegriff zunehmend von ‚Theogonie‘ abgelöst.81
Warum sich List überhaupt der Theosophie zuwandte, ist bisher ungeklärt. Goodrick-Clarke führte dieses Interesse einerseits auf deren zeitgenössische Popularität, andererseits auf den Einfluss von bestimmten Mitgliedern der GvLG zurück, die in seinem auch hier sehr weitgefassten Theosophieverständnis List mit der Theosophie vertraut machten.82 Der (auch von Pytlík) geäußerte Verdacht, Lists Mäzen Friedrich Wannieck habe hier eine prominente Rolle gespielt, geht auf einen Brief zurück, den dieser im Dezember 1914 an List schickte.83 Darin berichtet Wannieck von einer Séance, in welcher der verstorbene Theosoph Franz Hartmann (1838–1912) einige Zeilen über List übermittelte, die Wannieck seinem Brief beifügte. Darüber hinaus legt Wannieck dar, dass sein Sohn mit Hartmann befreundet gewesen sei und er selbst mit einer ehemaligen Weggefährtin Hartmanns in regem Austausch stehe.84 Goodrick-Clarkes mit einem Literaturnachweis zu diesem Brief versehene Behauptung, Wannieck habe „fest an die theosophischen Mahatmas Morya und Koot Hoomi“85 geglaubt, findet in der Quelle keinerlei Erwähnung. Der Brief klärt ebenso nicht, ab wann sich Wannieck für Hartmann interessierte. Das Ungewöhnliche an dem Brief sind schließlich weniger die ‚gechannelten‘ Botschaften über List, der sich hier als „göttlich reiner Mensch mit mächtigen Geistesgaben und ungeheurer Tatkraft“86 geschmeichelt fühlen darf, sondern die einleitende Frage Wanniecks: „Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Dr. Franz Hartmann, der Theosoph war, […] bekannt ist“87. Wannieck hätte eigentlich wissen müssen, dass Hartmann – wie er selbst – Gründungs- und Ehrenmitglied der GvLG war. Sind die Hintergründe des Briefes zwar unbekannt, so ist doch offenkundig, warum er sich unter den zahlreichen Lobeshymnen auf Lists Arbeit im Anhang seiner Biographie wiederfindet. Gerade für die Theosophen unter seinen Anhängern musste die Bestätigung seiner Thesen durch Franz Hartmann einen relevanten Legitimationsfaktor darstellen.
1.5 List als Ahnvater der Runenesoterik
Bereits zu Lists Lebzeiten gab es Autoren, die seine Thesen rezipierten und in ihre eigenen Theorien einfließen ließen. Das reichte von kurzen Erwähnungen list’scher Termini, z. B. des ‚Urfyrs‘ beim Schweizer Chemiker Johann Heinrich Ziegler (1857–1936), der wie List eine Einheit von Religion und Wissenschaft postulierte,88 hin zu Werken, deren Autoren angaben, diese ganz im Geiste Lists verfasst zu haben, wie etwa der Schriftsteller Ernst Ludwig Freiherr von Wolzogen (1855–1934) mit seinem Weihespiel Die Maibraut (1909) (vgl. Kap. I/4).89 Kein Werk von List wurde jedoch so stark rezipiert wie Das Geheimnis der Runen (1907), welches nicht nur in zahlreichen Auflagen bis heute publiziert, sondern auch ins Englische, Italienische, Russische und Spanische übersetzt wurde und anderen esoterischen Runenforschern als Vorlage diente.90
Philipp Stauff (1876–1923) etwa, nach Friedrich Oskar Wanniecks (1872–1912) Tod Vorsitzender der GvLG, glaubte Runen im Gebälk von Fachwerkhäusern zu erkennen, die er auf Grundlage der list’schen Deutungen interpretierte, Karl Theodor Weigel (1892–1953) führte seine Forschungen dann durch seine Arbeit beim SS-Ahnenerbe fort.91 In eine andere Richtung führten die Arbeiten Friedrich Bernhard Marbys (1882–1966) und Siegfried Adolf Kummers (1899–1977), die in den 1920er und 1930er Jahren Lists Ideen im Rahmen einer an Yoga angelehnten Runengymnastik einer praktischen Anwendung zuführten.92 Dass sich Lists Schriften auch nach seinem Tod in der Völkischen Bewegung sowie bei einigen Autoren in der Zeit des Nationalsozialismus einer gewissen Popularität erfreuten, vermag wenig zu überraschen. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Rezeption seiner Ideen bzw. explizit seines Runenbuches nach 1945 nicht abreißt. In seinen Büchern Runenmagie (1954) sowie Runenexerzitien für Jedermann (1958) griff Karl Spiesberger (1904–1992) auf Lists Runendeutungen nebst seiner Epigonen Marby, Kummer sowie Rudolf John Gorsleben (1883–1930) zurück, präsentierte deren Arbeiten seiner Leserschaft aber mit einer ausdrücklichen Distanzierung von völkischem Gedankengut und bildete somit also den Angelpunkt einer nicht- völkischen Listrezeption.93
List gilt, wie die schlaglichtartige Darstellung der Rezeptionsgeschichte seiner Runendeutungen zeigt, nicht grundlos als „Wegbereiter der esoterischen Runologie“94; die Werke seiner Epigonen sind entsprechend gut erforscht.95 Problematisch ist jedoch, dass in rezeptionsgeschichtlichen Arbeiten häufig nur diejenigen Teile der Quellen untersucht werden, die tatsächlich rezipiert wurden. Ansonsten wäre in 60 Jahren Listforschung früher aufgefallen, dass List sich nicht erstmals 1906, sondern bereits in Carnuntum (1888) mit einer 18-zeichigen Runenreihe auseinandersetzte.96 Darüber hinaus verstellt die bisherige auf die Listrezeption fokussierte Literatur den Blick darauf, welchen Stellenwert Das Geheimnis der Runen (1907) tatsächlich in Lists Gesamtwerk einnimmt. Denn zwar stellt es – die Konzentration auf Phase II vorausgesetzt – chronologisch das erste von Lists Werken dar, in welchem er seine Weltanschauung systematisch darstellt, was jedoch nicht bedeutet, dass es auch das wichtigste war. Das Thema ‚Runen‘ ist für List mit seinem Runenbuch abgeschlossen, es wird also über die 70 Seiten seines Erstlingswerkes hinaus nicht weiter ausgearbeitet. Eine Ausnahme mag Die Bilderschrift der Ario-Germanen (1910) bilden, aber auch hier stehen Runen nicht im Vordergrund, sondern werden lediglich als Unterkategorie des ausführlich besprochenen Themenkomplexes ‚Symbolik‘ besprochen. Die Auseinandersetzung mit Runen machte List also einem neuen Kreis von Anhängern bekannt, den Mittelpunkt seines Schaffens bildeten sie deswegen aber nicht.
Diese Kritik sollte jedoch nicht vergessen lassen, dass ein zentraler Faktor seiner Relevanz die Tatsache darstellt, dass List anders als andere, ähnliche Autoren aus dem Spektrum völkischer Religiosität seit Lebzeiten bis heute rezipiert wird. Eine Rezeptionsforschung jedoch, die sich so willkürlich an ihrem Ausgangsmaterial bedient wie die untersuchten Rezipienten selbst, kann die Frage, inwieweit die Rezipienten ihrer Quelle ‚gerecht‘ wurden, nur unzureichend beantworten. Darüber hinaus birgt sie die Gefahr, dass die Rezeption list’scher Ideen an den Stellen übersehen wird, an welchen die bereits bekannten Tradierungswege verlassen werden. Dem Fehlen einer „Gesamtdarstellung seiner Weltanschauung und der Entwicklung seiner Ideen“97, welches auch Pytlík kritisiert, soll vorliegende Arbeit entgegenwirken.
2. Forschungsvorhaben
2.1 Fragestellung und Methode
Primäres Ziel dieser Arbeit ist, die Entwicklung des list’schen Entwurfes germanischer Religiosität vor und nach 1902 zu analysieren, um anhand seiner zentralen Ideen die Vorstellung einer Zäsur zwischen Früh- und Spätwerk in Frage zu stellen. Mit der bisherigen Unterscheidung einer ‚dichterischen‘ und ‚theoretischen‘ Phase wird gebrochen, indem in dieser Arbeit bewusst mit den abstrakten Bezeichnungen ‚Phase I‘ (bis 1902) und ‚Phase II‘ (ab 1902) gearbeitet wird – nicht um die die Trennung zwischen beiden zu perpetuieren, sondern ihren Konstruktionscharakter hervorzuheben. Während Lists Werke aus Phase II bekannt und bereits Gegenstand bisheriger Forschungsarbeiten gewesen sind, steht in dieser Arbeit die Aufarbeitung und Kontextualisierung seiner Texte aus Phase I im Vordergrund. Trotz dieser Fokussierung soll es im Gegensatz zu bisherigen Arbeiten nicht um die monolithische Betrachtung einer Phase in Abgrenzung zu einer nicht thematisierten anderen gehen, sondern um das Aufzeigen von Kontinuitäten, Brüchen und Transformationen zentraler Ideen.
In der Arbeit wird ein werkbiographischer Ansatz verfolgt, methodische Grundlage ist also einerseits die dichte Lektüre der list’schen Schriften und andererseits die Verortung der darin genannten Thesen im zeitgenössischen Diskurs unter Berücksichtigung biographisch relevanter Ereignisse. Im Fokus steht also weder die bloße Deskription des list’schen Denkgebäudes, noch ein schlichter Vergleich zwischen Phase I und II. Im Gegenteil soll analysiert werden, warum List seine Thesen so und nicht anders entwickelte, auf welche Fragen und Probleme seiner Zeit er reagierte, für welche politischen Bewegungen er arbeitete und in welcher Weise sich die Entstehungskontexte früher Texte auch in seinem Spätwerk widerspiegeln. Während – mit Ausnahme Pytlíks – ein auf die posthume Rezeption fokussierter Ansatz bisherige Arbeiten zu List dominierte, soll diese in der Arbeit ausgeblendet werden und die zeitgenössische Reaktion auf seine Ideen nur dann eine Rolle spielen, wenn sie für deren Entwicklung relevant war.
2.2 Aufbau, Quellen und Einbettung in den Forschungsstand
Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert, die, obgleich aufeinander aufbauend, zugleich in sich geschlossene Abschnitte mit eigener Zielsetzung bilden. Teil I bietet eine Biographie Guido Lists und dient neben der Vertiefung des politischen und geistesgeschichtlichen Kontextes in Kap. III/1 als Grundlage dafür, List innerhalb der Deutschnationalen und Völkischen Bewegung zu verorten. Zugleich lassen sich einige seiner Thesen direkt auf biographisch relevante Ereignisse zurückführen. Obwohl es keinen Nachlass gibt, lässt sich Lists Leben, insbesondere bis 1902, bemerkenswert gut rekonstruieren. Damit ist Teil I nicht nur als bloße Vorarbeit angelegt, sondern soll auch für sich stehend einen Beitrag zur Biographie Lists leisten. Um Redundanzen zu vermeiden und Zusammenhänge besser verdeutlichen zu können, erfolgt die Darstellung gerafft und soll ein Gerüst bilden, auf welchem aufbauend etwa die Informationen zu Phase I in Kapitel III/2 (List als Weltanschauungsproduzent der Deutschnationalen Bewegung) vertieft werden können. Zugleich liegt ein Schwerpunkt auf Informationen, welche in der bisherigen Listforschung unbekannt oder strittig waren, weil der Fokus auf von Anhängern verfassten Biographien zu Fehleinschätzungen führte. Die Diskrepanzen zwischen Selbst- und Fremddarstellungen werden in diesem Teil immer wieder thematisiert, weil sie neben der Prüfung der biographischen Informationen selbst einen Einblick in Lists Präsentation nach außen gewähren.
Als Quellen zum Werdegang Lists stehen in erster Linie drei Biographien unterschiedlichen Umfangs zur Verfügung. Am bekanntesten ist zweifelsohne die zwei Jahre vor Lists Tod veröffentliche Schrift Guido v. List – Der Wiederentdecker Uralter Arischer Weisheit – Sein Leben und sein Schaffen (1917) des Astrologen Johannes Balzli, die als Einführungsband zu der Reihe Forschungsergebnisse der GvLG dienen sollte. Das 62-seitige Werk mit dem knapp 300-seitigen Anhang stellt sich jedoch bei genauerer Betrachtung als eine Paraphrasierung der autobiographischen Randnotizen heraus, die List selbst in seinen Werken, insbesondere in Deutsch-Mythologische Landschaftsbilder (1891/1912), einfließen ließ. Balzli komprimiert nochmals, was bereits bei List zu kurz dargestellt ist und mystifiziert das Übriggebliebene so sehr, dass es kaum glaubwürdig erscheint. Ignoriert man die einleitend im Wortlaut wiedergegebene Interpretation Lists hinsichtlich seines eigenen Namens und zieht von den 62 Seiten jene ab, die wegen der großformatigen Photographien kaum Text enthalten, bleibt vom titelgebenden ‚Leben und Schaffen‘ des ‚Meisters‘ kaum mehr als eine mit biographischen Details angereicherte, kommentierte Bibliographie. So wenig Balzli zu einem klareren Bild der list’schen Biographie beitragen kann, desto deutlicher ist das Zeugnis, welches er von der Art und Weise abgelegt hat, wie List sich der Öffentlichkeit präsentiert wissen wollte. In dieser Selbstinszenierung spielen biographische Details nur dann eine Rolle, wenn sie sich im Sinne einer teleologischen Darstellung verwerten lassen, dergemäß Lists divinatorische Begabung sich bereits seit seiner Kindheit andeutete, um dann 1902 während der Erholung von seiner Augenoperation zum vollen Ausbruch zu geraten.
Balzlis Text erinnert zum Teil wörtlich an das 1908 anonym veröffentlichte Heft Guido von List – Ein moderner Skalde. Auch dieses zeichnet sich nicht durch seinen Informationsgehalt aus, bietet aber im Anhang Briefe einiger Unterstützer des Aufrufs zur Gründung der GvLG. Interessant ist außerdem der Ausblick auf die geplanten Bände der Guido-List-Bücherei, die so nie umgesetzt wurden (vgl. Kap. I/4). Die dritte Quelle, die sich als ‚Biographie‘ kategorisieren lässt, ist die ‚ariomantische Studie‘, die Adolf Lanz 1927 für das Guido von List-Heft der Zeitschrift für Menschenkenntnis und Schicksalsforschung anfertigte.98 Ihr besonderer Wert liegt darin, dass hier ein enger Weggefährte Lists zu Wort kommt, der sich nicht nur kritisch mit List und noch kritischer mit der GvLG auseinandersetzt, sondern auch Teile seiner Biographie aufgreift, die List in seinen Eigendarstellungen verschwiegen hatte, welche sich aber durch andere Quellen bestätigen lassen.
Die ausschließliche Verwertung dieser drei Biographien führt zwangsläufig zu einer einseitigen Darstellung, weil eine objektive Schilderung weder im Interesse des Autoren von Guido von List – Ein moderner Skalde (1908), noch in jenem von Balzli und Lanz lag. Von unschätzbarem Wert sind daher die Informationen, die sich über die ANNO-Datenbank (Austrian Newspapers Online) der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) sowie andere Archive abrufen lassen, denn sie ermöglichen die Überprüfung der Aussagen, die List und seine Biographen über seine Vergangenheit machen. Im ANNO-Projekt werden im Auftrag der Österreichischen Nationalbibliothek Zeitungen und Zeitschriften ab dem 16. Jahrhundert digitalisiert und mit der Möglichkeit zur Volltextsuche online gestellt. Der Name Lists in unterschiedlichen Schreibweisen (Guido List; List, Guido; Guido v. List; Guido von List) ergibt momentan – die Digitalisierung ist noch nicht abgeschlossen – rund 1200 Treffer. Neben den knapp 100, teils bisher unbekannten Artikeln, welche List in diversen Zeitungen veröffentlichte, bieten die Fundstellen einen Einblick in die zeitgenössische Rezeption seiner Texte, seine Aktivität in Vereinen, Ankündigungen seiner Vorträge und Verweise auf weitere Aufsätze in Jahrbüchern und Kalendern, welche dann über die ÖNB oder andere Archive und Bibliotheken beschafft werden konnten.
Gleichwohl sich die ‚Anhängerbiographien‘ mit diesem zusätzlichen Quellenmaterial kritisch untersuchen lassen, sind letztere im Hinblick auf ihre Glaubwürdigkeit nicht weniger problematisch. Nicht nur fehlt in den meisten Fällen ein Verfasser, sondern die unterschiedlichen Zeitungen sind zugleich auch Sprachrohre bestimmter politischer und/oder religiöser Gruppen. Die Berichterstattung über ein Ereignis unterscheidet sich also mitunter stark, je nachdem ob die Zeitung deutschnational, christlichsozial, liberal oder katholisch- monarchistisch ausgerichtet war. Um sich ein Gesamtbild zu verschaffen, wurden in solch strittigen Fällen möglichst viele der verfügbaren Quellen berücksichtigt und auf Unterschiede in der Berichterstattung explizit hingewiesen.99
Die Quellenlage wird schlechter, sobald die GvLG gegründet wird. Lists Vortragstätigkeit außerhalb des Vereins geht ebenso zurück wie die Publikation von Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften. Zwar bieten die Anhänge seiner im Verlag der GvLG herausgegebenen Werke zahlreiche Briefe, GvLG-Mitgliederlisten, Texte von Anhängern sowie allgemeine Informationen zum Verein, fraglich ist jedoch, ob die Quellen zur GvLG zugleich auch Quellen zu List sind. Die Zuspitzung der Forschungsfrage auf den Ursprung seiner Ideen in Phase I macht eine Beschäftigung mit Lists Verhältnis zur GvLG sowie die wechselseitige Beeinflussung ihrer Mitglieder nicht erforderlich und muss daher anderen Forschungsarbeiten überlassen werden.
Teil II widmet sich einer systematisierten Darstellung von Lists in Phase II entstandenen Werken. Weil das jene Werke sind, die nach Lists Tod rezipiert wurden und daher bereits im Fokus bisheriger Forschungsarbeiten standen, erfolgt ihre Darstellung bewusst vor der Aufarbeitung seiner Texte vor 1902. Diese umgedrehte Chronologie folgt in erster Linie einem der Forschungsfrage nach den Wurzeln im Frühwerk geschuldeten Pragmatismus. In vielen Fällen sind nämlich die in Phase I entwickelten Ideen nicht vollständig deckungsgleich mit jenen in Phase II, sondern letztere bauen lediglich auf diesen auf. Diese zum Teil komplexen Transformationen lassen sich deutlich leichter verständlich machen, wenn das ‚Endprodukt‘ in Phase II bereits bekannt ist. Hinzu kommt die Vielschichtigkeit seiner religiösen Weltanschauung in Phase II, die, wenn auch auf wenigen Grundannahmen fußend, in Lists Ausarbeitung eine solche Komplexität entfaltet, dass sie nur dann nachvollziehbar dargestellt werden kann, wenn sie komprimiert und nicht zergliedert präsentiert wird.
Neben dem Ziel, ein Fundament für die Analyse der Thesen und ihrer Transformationen aus Phase I zu legen, soll in Teil II auch der Versuch unternommen werden, erstmals eine möglichst adäquate Zusammenfassung von Lists Spätwerken zu bieten. Während rezeptionsgeschichtlich angelegte Forschungen naturgemäß auf jene Thesen fokussieren, die auch rezipiert wurden, soll Lists Weltanschauung hier in einer thematischen Gewichtung dargestellt werden, die Lists Intentionen am ehesten entspricht. Thesen, die List explizit betont oder häufig wiederholt, wird also eine besondere Aufmerksamkeit eingeräumt. Nichtsdestoweniger wirft der Anspruch, eine ‚authentische‘ Wiedergabe von Lists Schriften zu bieten, methodologische Probleme auf. Eine Systematisierung seiner Ideen kann nie mehr als Interpretation sein, weil List eine solche selbst nicht vorlegte. Die Einschätzung von Kunz in Bezug auf Lists Die Bilderschrift der Ario-Germanen (1910) kann in mehr oder minder starker Ausprägung auf all seine Werke der Phase II verallgemeinert werden:
„Es ist ein zusammenhangloses Aneinanderreihen von Behauptungen, von denen manche zutreffen, aber in sinnwidrige Kombinationen gebracht werden, und vielen, die absurd sind. Fernöstliche, ägyptische, jüdische, griechische, gnostische, christliche, germanische Namen, Symbole und Theorien werden zusammengemixt und als ario-germanisches Weistum herausgegeben. Die Fülle des Materials kann wirklich gigantisch genannt werden, die Phantasie des Interpreten nicht minder. Eine Übersicht über das Ganze ist wegen der Systemlosigkeit fast unmöglich. Man sieht sich einem Heer von Details gegenübergestellt, welche gleich wichtig und gleich nebensächlich scheinen.“100
Lists Werke sind in der Tat verworren und undurchsichtig. Die gemessen an der Länge einiger seiner Werke vergleichsweise wenigen Informationen über den Armanismus und die ario-germanische Vorzeit verlieren sich in komplexen Argumentationen, warum diese oder jene Quelle seine Thesen bestätigt. Insbesondere seine etymologischen Nachweise sind charakteristisch für seine Arbeit und füllen die Seiten seiner Werke. Weil es nicht Ziel dieser Arbeit sein kann, eine Eindeutigkeit dort zu schaffen, wo List diese vermissen ließ, wird auch auf Widersprüche hingewiesen, welche sich nicht nur zwischen seinen Werken, sondern oft auch innerhalb weniger Seiten auftun. Bei einigen seiner Werke, insbesondere Die Bilderschrift der Ario-Germanen (1910), Die Ursprache der Ario-Germanen (1914) und in Teilen auch Die Namen der Völkerstämme Germaniens und deren Deutung (1909), erscheint es indessen kaum glaubwürdig, dass seine Anhänger die Bücher tatsächlich von vorne bis hinten durchlasen. Vielmehr sind sie von den einleitenden Thesen abgesehen wie Nachschlagewerke aufgebaut, deren einzelne Unterkapitel – wenn es überhaupt welche gibt – nicht logisch aufeinander aufbauen. Wenn Lanz schreibt, List habe seine Bücher wie ein spiritistisches Medium einfach heruntergeschrieben,101 dann reproduziert das nicht nur das List-Bild des intuitiv arbeitenden Autodidakten, sondern scheint mit Blick auf seine Texte durchaus nicht unwahrscheinlich.
Anders als bei der detaillierten Analyse seines Frühwerkes in Teil III geht es in Teil II nicht um den Kontext seiner Thesen, sondern um die Darstellung seiner Ideen allein auf Grundlage der Spätwerke. Dabei liegt der Fokus nicht allein auf einer rein deskriptiven Zusammenfassung, sondern vielfach auch auf der Analyse von Argumentationsstruktur und methodischer Vorgehensweise Lists, weil nur diese zu einem Verständnis seiner Thesen beiträgt. Nur in Einzelfällen, etwa bei Lists Rezeption der spätmittelalterlichen Veme, wird auf Hintergrundinformationen eingegangen, um seine Arbeitsweise transparent zu machen. Die kontextfreie Betrachtung der Werke aus Phase II soll nicht implizieren, dass für diese seine Ideen aus Phase I allein ausschlaggebend gewesen wären. Im Gegenteil ist auf seine Theosophierezeption bisher mehrfach zu Recht hingewiesen worden. Ziel dieser Arbeit ist es jedoch primär, auf zentrale Kontinuitäten der bisher unbeachteten oder marginalisierten Texte hinzuweisen. Um der Bedeutung der Theosophie, insbesondere ihrer für List relevanten Terminologie gerecht zu werden, wird in Kapitel II/2 (Die Natur-Ur-Gesetze) in Fußnoten auf den theosophischen Ursprung mancher Begrifflichkeiten ebenso hingewiesen, wie auf zentrale Unterschiede zwischen Lists Ideen und jener der Theosophie aufmerksam gemacht wird.
In der Hinführung wurde die Trennung von Phase I und II ebenso wie ihre Datierung bereits problematisiert. Der Forschungsthese dieser Arbeit würde es widersprechen, eine eigene Entscheidung hinsichtlich eines geeigneten Wendejahres zu treffen oder Lists Werk gar in gänzlich neue Phasen einzuteilen, die letztlich den eigentlich kritisierten harten Bruch zwischen verschiedenen Schaffensperioden reproduzieren. Zugleich setzt aber der gewählte Aufbau, dem insbesondere in Teil II die Frage eingeschrieben ist, welche Texte zu Phase II gezählt wurden, die Entscheidung für eine Jahreszahl oder ein Datum voraus. Naheliegend ist das bei List und in den Anhängerbiographien wiederholt genannte ‚Erblindungsjahr‘ 1902. Während einige seiner frühen Artikel – sofern sie aufgefunden werden konnten –, in denen List die Werke der später im Verlag der GvLG erschienenen Bücher vorbereitete, auch in Teil II berücksichtigt wurden, stellt seine 1903 erschienene Kurzgeschichtensammlung Alraunenmären ein scheinbares Problem dar, weil es inhaltlich schlichtweg mit den theoretisch angelegten Spätwerken schwer vergleichbar ist. Trotz seines Erscheinens nach 1902 sind jedoch viele der in Alraunenmären (1903) enthaltenen Erzählungen in den 1890ern erstpubliziert worden, sodass es inhaltlich entgegen seines Erscheinungsjahres Phase I zugeordnet werden muss. Ebenso wie Teil I (Biographie) ist auch Teil II (Werk), wenn auch für sich ein wichtiger Beitrag zur Listforschung, mit Blick auf die Forschungsfrage nicht der Hauptteil dieser Arbeit, sondern das Fundament zu ihrer Beantwortung.
In Teil III sollen die Fäden der anderen Teile sukzessive zu einer Werkbiographie zusammengeführt werden. Die Grundlage der Analyse der Entstehungskontexte seiner Texte aus Phase I bildet Kapitel III/1 (Politischer und geistesgeschichtlicher Kontext), in welchem – ausgehend von der Idee einer ‚Deutschen Nation‘ im frühen 19. Jahrhundert – über die sprachrechtlichen Konflikte in Österreich (Kap. III/1.1) und die Entwicklung des Antisemitismus in der zweiten Jahrhunderthälfte (Kap. III/1.2) der Bogen zur Deutschnationalen Bewegung unter Georg von Schönerer (1842–1921) (Kap. III/1.3) gespannt wird. Das Kapitel fasst die für Österreich spezifischen Entwicklungen eines ‚deutschen‘ Nationalgefühls zusammen, für welches der Protest gegen die Sprachpolitik der österreichischen Regierung im Vielvölkerstaat ebenso entscheidend war wie der aufkommende Antisemitismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die radikal-deutschnationale Bewegung unter Schönerer bildet in Phase I die ideologische Heimat Lists. Über einschlägige Publikationsorgane sowie verschiedene – teils selbst gegründete – Vereine trat List in persönlichen Kontakt zu den zentralen Akteuren der Bewegung. Viele seiner Schriften und Thesen aus dieser Zeit lassen sich nur vor dem Hintergrund der politischen und kulturellen Ziele dieser Bewegung verstehen und finden sich in weiterentwickelter Form in seinen Werken ab 1902 wieder. In Kapitel III/1.4 soll zudem den Entwicklungen im religiösen Feld um 1900 mit besonderem Schwerpunkt auf Alternativreligiosität und völkischer Religionsbildung Rechnung getragen werden.
Der überwiegende Teil der in Kapitel III/1 verwendeten Informationen stammt aus dem Buch Hitlers Vätergeneration (2005) des Historikers Michael Wladika, der auf der Grundlage von Andrew G. Whitesides Studie The Socialism of Fools (1975) ein detailreiches Standardwerk zur Deutschnationalen Bewegung vorlegt. Ein vertiefendes Verständnis des Sprachkonflikts in Österreich (Kap. III/1.1.2) ist einzelnen Studien unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen, etwa Christoph Freiherr Marschall von Biebersteins Buch Freiheit in der Unfreiheit (1993) zur polnischen Nationalbewegung in Galizien sowie den Artikeln Johannes Feichtingers Polyglottes Habsburg (2020) oder Tamara Scheers Die k.u.k. Regimentssprachen (2014) zu verdanken. Obwohl der tschechisch-deutsche Sprachenstreit in der Literatur gut aufgearbeitet ist, wird die Wirkmächtigkeit der Gleichsetzung von (Umgangs-)Sprache und Nationalität zusätzlich anhand des Werks Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet in den europäischen Staaten (1870) des seinerzeit renommierten Statistikers Georg Friedrich Richard Böckh (1824–1907) gezeigt, dessen Theorien von Sprach- als Landesgrenzen wegweisend für die gängigen Methoden der Nationalitäten- und Bevölkerungsstatistik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war. Auf Böckhs Methode basieren auch die im Zehnjahresrhythmus durchgeführten Volkszählungen der K. K. statistischen Central-Commission, die es ermöglichen, den österreichischen Sprachkonflikt auch anhand von Zahlen zu illustrieren. Als Quelle ist die Statistik nicht unfehlbar, sie zeigt aber, wie die Sprachverteilung Ende des 19. Jahrhunderts wahrgenommen wurde.102
Nicht zuletzt das achtbändige Handbuch des Antisemitismus (2009–2015) zeigt, dass für die Darstellung der Verflechtungen der Deutschnationalen mit der antisemitischen Bewegung ausreichend Literatur zur Verfügung steht. Für eine pointierte Darstellung, bei welcher antisemitische Organisationsformen gegenüber antisemitischen Diskursen in den Hintergrund treten, hat es sich als fruchtbar erwiesen, zentrale antisemitische Stereotype und Argumentationsschemata anhand von drei, auch in der Literatur immer wieder genannten Werken aufzuarbeiten. Sowohl Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum (1878) des reichsdeutschen103 Publizisten Wilhelm Marr (1819–1904), die Schrift Die Judenfrage als Racen-, Sitten- und Culturfrage (1881) des Nationalökonomen Eugen Dühring (1833–1921) sowie Wilhelm Marrs (1819–1904) Das Gesetz des Nomadenthums und die heutige Judenherrschaft (1887) waren in der Deutschnationalen Bewegung äußerst populär. Alle drei Autoren reproduzieren ihrerzeit gängige antisemitische Stereotype, die sich auch in Lists Texten nachweisen lassen.
Kapitel III/1.3.2 (Die Synthese von Deutschnationalismus und Antisemitismus) schließt an die in Kapitel III/1.2 (Die Entwicklung des österreichischen Antisemitismus) herausgearbeiteten Stereotype an, legt den Fokus jedoch auf antisemitische Vereine und Aktionsformen im Umfeld von Schönerer. Die Auseinandersetzung mit den Christlichsozialen unter Karl Lueger (1844–1910) – übrigens Mitglied der GvLG – in Kapitel III/1.3.3 ist für die Erläuterung des deutschnationalen Feldes relevant, weil in ihr die wichtigste antisemitische Konkurrenzideologie zum Deutschnationalismus unter Schönerer zu sehen ist. Mit Kapitel III/1.3.6 (Deutschnationalismus und Völkische Bewegung) soll nicht nur das große Kapitel III/1 über den historischen Kontext abgeschlossen, sondern auch zu Kapitel III/2 (List als Weltanschauungsproduzent der Deutschnationalen Bewegung) übergeleitet werden. Über die Völkische Bewegung sowie die hier fokussierte völkische Religiosität liegen bereits zahlreiche Arbeiten vor, von welchen in erster Linie die interdisziplinären Sammelbände Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 1871–1918 (1996), Antisemitismus, Paganismus, Völkische Religion (2004) und Völkisch und national (2009) zu nennen sind. Nicht zuletzt haben die in diversen Sammelbänden erschienenen Artikel des Historikers Uwe Puschner maßgeblich dazu beigetragen, die zentralen diskursiven Eckpunkte der völkischen Ideologie abzustecken. Nicht zuletzt war für das Kapitel zum alternativreligiösen Feld um 1900 (Kap. III/1.4) der rezente Sammelband Die Geburt der Moderne aus dem Geist der Religion? Religion, Weltanschauung und Moderne in Wien um 1900 (2020) von Astrid Schweighofer und Rudolf Leeb unerlässlich.
Kapitel III/2 (List als Weltanschauungsproduzent der Deutschnationalen Bewegung) ist als Vertiefung des Biographiekapitels zu verstehen, indem Lists Kontakte zur Deutschnationalen Bewegung aufgezeigt und in den zuvor aufgearbeiteten historischen Kontext (Kap. III/1) eingebettet werden. Eingeleitet wird das Kapitel durch die Auseinandersetzung mit Lists Erstlingsroman Carnuntum (1888). Weniger geht es hier um den Inhalt des Romans, der an anderen Stellen aufgegriffen wird, sondern vielmehr um seinen Entstehungskontext sowie die für List wegweisende Konstruktion des ‚Dichtergelehrten‘ im Vorwort des Romans (Kap. III/2.1.1). Innerhalb dieses Kapitels wird erarbeitet, aus welchen Gründen in dieser Arbeit seine vermeintlich rein ‚literarischen‘ Werke mit den ‚theoretischen‘ Schriften als ebenbürtige Quellen zur Rekonstruktion seiner religiösen Weltanschauung behandelt werden. Während Kapitel III/2.2 (Lists Verortung im deutschnationalen Netzwerk) den Schwerpunkt auf Lists Aktivität in deutschnationalen Vereinen sowie seine Arbeit für die Ostdeutsche Rundschau legt, geht es in Kapitel III/2.3 (Politische Implikationen in Lists Werken) sowie Kapitel III/2.3.3 (Lists Rolle in der Los-von-Rom-Bewegung) stärker um die in seinen Texten transportierten Ideen, ihren Ursprung sowie ihre Anschlussfähigkeit an die zentralen Positionen deutschnationaler Akteure. Für die Analyse seiner institutionellen Einbindung in die Deutschnationale Bewegung hat sich erneut die ANNO-Datenbank der ÖNB als gewinnbringend erwiesen und vielfach – etwa in Bezug auf den Verein Iduna – weitere Recherchen erst angeregt.
Mit den Unterkapiteln III/2.3.1 (Zum Antisemitismus bei List), III/2.3.2 (Entwurf einer germanischen Topographie – Lists Beitrag zum Sprachenstreit) sowie III/2.3.3 (Lists Rolle in der Los-von-Rom-Bewegung) werden die zentralen politischen Schauplätze des Deutschnationalismus – Antisemitismus, Sprachkonflikt und Antiklerikalismus – aufgegriffen und Lists Positionierung zu diesen Themen dargestellt und kontextualisiert. Gerade die hier behandelten Vorstellungen und Topoi sind mit Blick auf seine Werke in Phase II wegweisend. Aus diesem Grund werden in den Kapiteln die in Phase I relevanten Ideen nicht nur wiedergegeben und analysiert, sondern auch mit jenen in Phase II in Verbindung gesetzt. Dadurch soll gezeigt werden, dass der Ursprung von Lists zentralen Thesen nicht nach dem, sondern im politischen Kontext vor 1902 gesucht werden muss. Es geht hier nicht nur um das Auflisten von Kontinuitäten, sondern die Untersuchung, welche Ideen sich auf welche Weise in Phase II widerspiegeln, wie sie sich entwickelten und welche Thesen List nicht mehr aufgriff. Lists Publikationen im Rahmen der Los-von-Rom-Bewegung markieren nicht nur chronologisch den Abschluss von Phase I, sondern leiten ausgehend von dieser deutschnationalen Dekonversionsbewegung direkt zu der Fokussierung auf seine religiöse Weltanschauung in Kapitel III/3 (Historische und mythologische Arbeiten) über.
Die vorchristliche Religion der germanischen Stämme ist bereits mit Carnuntum (1888) in den Fokus von Lists Schaffen getreten. Mit Deutsch-Mythologische Landschaftsbilder (1891) sowie den zahlreichen Artikeln, wie er sie etwa in der Ostdeutschen Rundschau in den 1890ern publizierte, werden sie neben ihrer literarischen Verarbeitung zum Mittelpunkt seiner forschenden Tätigkeit. Vieles von dem, was er ab 1904 in Büchern niederlegte und was gemeinhin als Lists Weltanschauung angenommen wird, ist in seinen Arbeiten zehn Jahre zuvor bereits angelegt. Kapitel III/3 (Historische und mythologische Arbeiten) verfolgt in erster Linie zwei Ziele: erstens die systematische Aufarbeitung seiner zentralen Thesen aus Phase I sowie ihre Verortung in zeitgenössischen Diskursen, zweitens die Darstellung ihrer Entwicklung im Verhältnis zu jenen aus Phase II. Um den Zusammenhang zwischen den Ideen beider Phasen nachvollziehbar aufzuarbeiten, ist das Ziel wie schon in Kap. III/2 (List als Weltanschauungsproduzent der Deutschnationalen Bewegung) nicht eine streng voneinander abgegrenzte Betrachtung, sondern eine detaillierte Zusammenschau beider Phasen.
Eine für die Anlage vorliegender Arbeit widrige Kontinuität zwischen Phase I und II stellt Lists weitestgehender Verzicht auf die Angabe von Quellen dar. Was aus heutiger Perspektive jedoch für Lists Thesen über vorchristliche Religiosität charakteristisch erscheint, verliert durch Kontextualisierung im seinerzeitigen Diskurs seine Schärfe. Ein Vergleich seiner Ideen mit zeitgenössischen Autoren zeigt, dass List wenig selbst entwickelte, jedoch durch die Kombination verschiedener bereits bestehender Thesen zu neuen Schlüssen kam. Möglich, dass einige seiner Progonen unbekannt bleiben, jedoch können neben der Verortung bestimmter Ideen in den übergeordneten Diskurs zu vorchristlicher Religiosität einige seiner Thesen auf konkrete Autoren zurückgeführt werden, die er nachweislich rezipierte oder zumindest zweifelsohne kennen musste. Einleitend zu Kapitel III/3 (Historische und mythologische Arbeiten) soll daher zunächst neben einem Überblick über die Rezeption der Edda als Quelle ‚germanischer‘ Mythologie (Kap. III/3.1.2) Jacob Grimms (1785–1863) wegweisendes Werk Deutsche Mythologie (1835) (Kap. III/3.1.1) vorgestellt werden. Grimm prägte Theorien wie etwa die Kontinuität vorchristlicher Religiosität in Volksbrauch und Aberglauben und war noch Ende des 19. Jahrhunderts derart populär, dass davon ausgegangen werden muss, dass List ihn rezipierte. Kapitel III/3.1.3 widmet sich schließlich dem bereits in der Hinführung thematisierten Werk Licht! Was keiner geahnt! Ein Buch für alle Germanen (1888) des Sprachforschers Heinrich Hermann Gustav Ferdinand Schliep, dessen Thesen List zum Teil wortwörtlich übernahm und welches seinen Entwurf der Arischen Ursprache maßgeblich prägte.
Die Kapitel III/3.2 („All ihr geeint in Allvater dem Einen“) und III/3.3 (Die Vorläufer der Armanenschaft) greifen Punkte auf, welche für Phase II zentral sind, nämlich die Einheit von Gott und Mensch sowie die eine Trennung zwischen esoterischer Geheim- und exoterischer Volksreligion forcierende germanische Priesterschaft. In Kapitel III/3.4 (Naturmythologie als Wurzel der Hochheiligen Drei) wird gezeigt, dass Lists Konzept der Dreiheit ‚Entstehen-Werden-Vergehen zum Neuentstehen‘ die große Kontinuität in seinen Werken darstellt, mit welcher er auch seine Reinkarnationslehre begründet. Die Analyse seiner Werke aus Phase I zeigt, dass List die durch die Dreiheit vermittelte Zyklizität zeitgenössischen naturmythologischen Diskursen entlehnt und ausgehend vom Jahreslauf auf den Menschen sowie die Entwicklung des Kosmos ausweitet. Obwohl der naturmythologische Ansatz in Phase II in den Hintergrund rückt, bleiben die aus diesem gezogenen Schlüsse die gleichen, während sich die Grundidee der Naturmythologie, also die Deutung von Mythen als poetisierte Naturvorgänge, in Lists Beschreibung der kosmischen ‚Natur-Ur-Gesetze‘ in Phase II widerspiegelt. In Kapitel III/3.5 (Lists Freimaurerrezeption) wird ein Thema in den Blick genommen, das zeigt, welchen Einfluss biographische Entwicklungen mitunter auf Lists Vorstellungswelt hatten. Selbst Mitte der 1870er Jahre Freimaurer geworden und später ausgetreten, greift List die Freimaurerei zwischen 1884–1914, also über einen Zeitraum von 30 Jahren, immer wieder in seinen Werken auf. Aus einer anfänglich positiven Rezeption wird in Phase II der Versuch, die moderne Freimaurerei als ehemals armanischen Geheimorden zu vereinnahmen.
Einen nicht minder relevanten Teil stellt die Listbibliographie am Schluss der Arbeit dar. Sie enthält auch jene Texte, die beim Verfassen dieser Arbeit nicht berücksichtigt wurden. Das schließt jene Artikel ein, von denen nur fragmentarische bibliographische Nachweise vorliegen, z. B. jene aus der vom Verein St. Michael veröffentlichten Bibliographie (1906), in welcher nur Titel mit Jahreszahlen angegeben sind.104 Titel, welche in den Bibliographien von Goodrick-Clarke und Pytlík aufgeführt sind, aber nicht eigenständig gefunden wurden, werden gekennzeichnet.
In formaler Hinsicht muss darauf hingewiesen werden, dass in dieser Arbeit nicht gegendert, also ausschließlich das generische Maskulinum verwendet wird. Hintergrund dieser Entscheidung ist es nicht, die Rolle von Frauen in der Geschichte zu marginalisieren, sondern die historische Wirklichkeit, wie sie sich in den Quellen widerspiegelt, möglichst adäquat darzustellen. Das bedeutet nicht, dass Frauen nicht aktiv an der Deutschnationalen oder Völkischen Bewegung partizipierten, etwa durch den Deutschen Frauen- und Mädchenbund ‚Freya‘, bei dessen Gründungsversammlung am 20.12.1894 List eine Rede hielt (vgl. Kap. III/2.2.2.4).105 Problematisch ist jedoch, dass die Beteiligung von Frauen in den meisten Quellen dieser Zeit entweder nicht explizit genannt wird oder aber ihre Rolle unklar bleibt. Wenn z. B. in der zeitgenössischen Presse von einer Demonstration gegen die Inhaftierung Georg von Schönerers im Jahr 1888 berichtet wird, dann ist dort von Burschenschaftern und Turnern die Rede, also ausschließlich männlich besetzten Organisationen, die sich historisch kontextualisieren lassen. Unmöglich ist hingegen eine politische Verortung, wenn neben diesen „viele Frauen und Mädchen“106 erwähnt werden.
Während Gendern einer möglichst genauen Abbildung der Wirklichkeit zuträglich ist, kann es in Bezug auf einen historischen Gegenstand, insbesondere wenn dieser in einer Zeit liegt, in denen Frauen in vielen sozialen und politischen Bereichen nicht oder nur in Einzelfällen repräsentiert waren, wirklichkeitsverfälschend sein. So lässt sich auf Grundlage der Mitgliederdaten der GvLG Lists Leserschaft nicht grundlos als ‚Anhanger:innen‘ bezeichnen. In dieser Formulierung spiegelt sich dann jedoch nicht wider, dass der weibliche Mitgliederanteil 7,8 % (1910) nicht überschreitet. Die Marginalisierung von Akteurinnen, der mit dem Gendern entgegengewirkt werden soll, verschleiert in diesem Fall also ihre deutliche Unterrepräsentanz, die eben den üblichen Geschlechterverteilungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts ebenso entspricht wie den konservativen Rollenbildern in der Völkischen und Deutschnationalen Bewegung. Ein ähnliches Problem ergibt sich bei der Erläuterung des list’schen Religionsentwurfes: Zur ario-germanischen Priesterschaft, den Armanen, zählt List auch Armaninnen (in Phase I: ‚Heilsräthinnen‘). Das bedeutet aber nicht, dass er Armaninnen bei seinen Ausführungen zur Armanenschaft immer mitdenkt. Im Gegenteil werden diese – wenn überhaupt – stets gesondert thematisiert, sodass von ‚Arman:innen‘ zu schreiben bedeuten würde, List egalitärer zu lesen, als er tatsächlich gewesen ist.
Details
- Seiten
- 576
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631907818
- ISBN (ePUB)
- 9783631907825
- ISBN (Hardcover)
- 9783631907771
- DOI
- 10.3726/b21420
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (August)
- Schlagworte
- Guido List Germanenideologie Neuheidentum Völkische Bewegung Antisemitismus
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 576 S., 9 farb. Abb., 16 s/w Abb., 3 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG