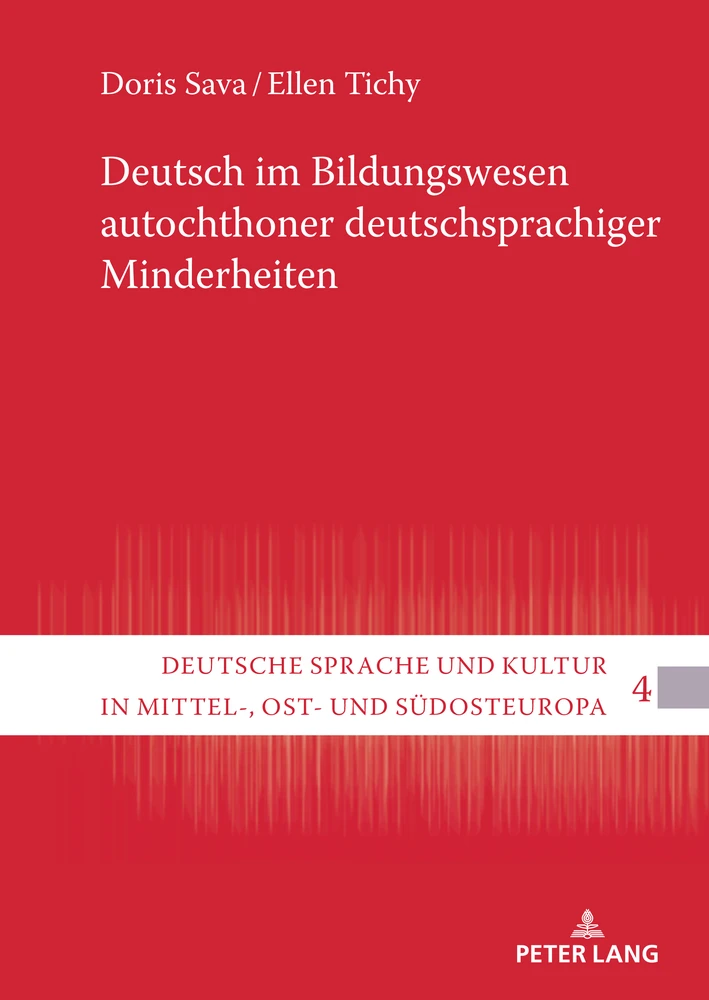Deutsch im Bildungswesen autochthoner deutschsprachiger Minderheiten
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Title
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Vorwort
- Teil I: Autochthone deutsche Minderheiten in Rumänien, Polen und Ungarn. Historische Hintergründe und aktueller Status
- 1. Einleitung: Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
- 2. Autochthone deutsche Minderheiten in Rumänien, Polen und Ungarn
- 2.1 Rumänien
- 2.2 Polen
- 2.3 Ungarn
- 3. Deutsch in Bildungskontexten und Bildungssprache Deutsch
- 3.1 Muttersprachlicher Unterricht für autochthone deutsche Minderheiten aus zeitgeschichtlicher Perspektive
- 3.3.1 Rumänien
- 3.3.2 Polen
- 3.3.3 Ungarn
- 3.2 Muttersprachlicher Unterricht an ausgewählten Schulen in Rumänien, Polen und Ungarn
- 3.3 Bildungssprache Deutsch in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
- 4. Deutsche Auslandsschulen in Regionen mit autochthonen deutschen Minderheiten
- Teil II: Bildungssprachliche Kompetenzen als Grundlage für erfolgreiches Lernen
- 5. Bildungssprache als Schlüsselkompetenz für den Bildungserfolg
- 5.1 Bildungssprache – Unterrichtssprache – Schulsprache
- 5.2 Besonderheiten der Bildungssprache als Funktionsdomäne von Sprache
- 5.3 Prinzipien der durchgängigen Sprachbildung
- Teil III: Deutsch in Bildungsräumen: Rumänien als Sonderfall
- 6. Deutsch als Mutter- und Bildungssprache im Kontext historischer Mehrsprachigkeit
- 7. Förderung bildungssprachlicher Fähigkeiten im gymnasialen DaM-Unterricht an rumänischen Schulen
- 7.1 Entwicklungsbereiche des Sprachhandelns im Rahmencurriculum für das Fach Deutsch als Muttersprache auf der Gymnasialstufe (7. Klasse)
- 7.2 „Das Zeug, das im Schulbuch steht, verstehen sie nicht“. Prinzipien des sprachaufmerksamen Handelns im Unterricht
- 7.3 Bildungssprachliches Inventar im Lehrbuch Deutsch als Muttersprache für die 7. Klasse (2022)
- 7.3.1 Ausbildung bildungssprachlicher Kompetenzen im Fach Deutsch als Muttersprache. Operatoren als Fallbeispiel
- 7.3.2 „Merke dir: Meide die Extreme: nicht zu kurz und nicht zu lang!“ Verständlichkeit, Lesbarkeit und Sprachrichtigkeit? Zur sprachlichen Gestaltung bildungsgerechten Sprachgebrauchs im Lehrbuch Deutsch als Muttersprache für die 7. Klasse (2022)
- 8. Mehrsprachigkeit als Potenzial für die Aneignung bildungssprachlicher Fähigkeiten
- 8.1 Sprachübergreifende Vermittlung des gebundenen Sprachgebrauchs. Kollokationen als Fallbeispiel
- 8.2 Erwerbsstrategien fester Wortverbindungen. Übungen und Aufgaben zu Kollokationen
- 8.3 Kollokationen als Übersetzungsproblem
- 8.4 Schlussbemerkungen
- 9. Bildungssprache Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit an rumänischen Schulen. Ein Fazit
- Teil IV: Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit in Rumänien
- 10. Sprachverlust als Herausforderung für den deutschsprachigen Unterricht
- 11. Bemühungen um den Erhalt und die Pflege des Deutschen
- 12. Perspektiven von Deutsch in Rumänien
- Abschließende Bemerkungen
- Literaturverzeichnis
- Reihenübersicht
Vorwort
Wachsende Ansprüche an die Verstehens- und Ausdrucksfähigkeiten und auch die aktuelle ethnisch-sprachliche Vielfalt im Klassenraum lassen erkennen, dass die Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen kontinuierlich und auf allen Bildungsstufen erfolgen muss, um die Teilhabe an relevanten Bereichen öffentlicher Kommunikation sichern zu können. Deutsch in mehrsprachigen Bildungskontexten und die Bildungssprache Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa – mit Rumänien als Sonderfall – sind die zwei Kernthemen, denen der vorliegende Band gewidmet ist.
Das Buch geht vom Status des Deutschen als historische Regional- und Minderheitensprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa aus und beleuchtet das Profil von Deutsch in Bildungskontexten aus historischer und aktueller Sicht.1
Konzeptionell war eine Gliederung des Bandes notwendig, um die Stellung der Unterrichtssprache Deutsch im Bildungswesen autochthoner deutschsprachiger Minderheiten und der Bildungssprache Deutsch im Kontext historisch bedingter Mehrsprachigkeit in ausgewählten Regionen mit deutschem Minderheitenanteil – Siebenbürgen, Schlesien und Baranya – erfassen zu können. Somit liegt der Fokus auf den Deutschen Auslands- und DSD-Schulen als Kernzentren deutscher Sprache und Kultur in den drei wichtigen Zielländern deutscher Kultur- und Bildungspolitik: Rumänien, Polen und Ungarn. Eingehender dargestellt wird die Lage der deutschen Sprache im rumänischen Bildungswesen, speziell in der Zentralregion Siebenbürgen und im hier gelegenen kulturellen Zentrum der deutschen Minderheit Hermannstadt (rum. Sibiu).
Teil I Autochthone deutsche Minderheiten in Rumänien, Polen und Ungarn. Historische Hintergründe und aktueller Status geht von den Bestimmungen der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen (1992) aus, die zusammen mit dem Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten die Sprachen, die von Angehörigen autochthoner Minderheiten gesprochen werden, schützt und fördert2 (Kap. 1), gefolgt von einem kurzen historischen Umriss zu den autochthonen deutschen Minderheiten in Rumänien, Polen und Ungarn (Kap. 2) folgt. Aus zeitgeschichtlicher Sicht verdeutlicht Kap. 3 am Beispiel ausgewählter Schulen die reiche Tradition des muttersprachlichen Deutschunterrichts für autochthone deutsche Minderheiten in diesen Ländern und somit auch die Situation von Deutsch in Bildungskontexten. Ausgehend von der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik als wichtiges Anliegen der Außenpolitik Deutschlands, stellt Kap. 4 vor, was Deutsche Auslandsschulen in Regionen mit autochthonen deutschen Minderheiten auszeichnet.
Teil II Bildungssprachliche Kompetenzen als Grundlage für erfolgreiches Lernen geht von der Rolle der Bildungssprache als Schlüsselkompetenz (Kap. 5) aus. Daher werden im Kapitel Merkmale und das Forschungspotenzial der Bildungssprache als Funktionsdomäne von Sprache vorgestellt, wobei auch die Prinzipien der durchgängigen Sprachbildung berücksichtigt werden.
Teil III Deutsch in Bildungsräumen: Rumänien als Sonderfall nimmt Deutsch als Mutter- und Bildungssprache im Kontext historischer Mehrsprachigkeit (Kap. 6) in den Blick. Vom historischen Status des Deutschen in Rumänien und in der multiethnischen und multikulturellen Zentralregion Siebenbürgen ausgehend, wo ein dichtes deutschsprachiges Schulnetz vorhanden ist, wird zunächst die gegenwärtige Situation von Deutsch erfasst, um auf die Notwendigkeit der Förderung von Deutsch in Bildungskontexten und der Bildungssprache Deutsch im traditionsreichen muttersprachlichen Schulwesen hinzuweisen. Es handelt sich hierbei um traditionsreiche Schulen in Hermannstadt (rum. Sibiu), Mediasch (rum. Mediaș), Kronstadt (rum. Brașov), Schäßburg (rum. Sighișoara), Temeswar (rum. Timișoara) sowie in der Landeshauptstadt Bukarest (rum. București), in denen der Unterricht größtenteils oder gänzlich in deutscher Sprache erfolgt, falls genügend Lehrkräfte vorhanden sind.
Gehörten vor 1989 die Schülerinnen und Schüler vorwiegend der deutschen Minderheit an, so sind es nach dem starken Rückgang der Rumäniendeutschen fast ausschließlich rumänische Kinder und Jugendliche bzw. aus Mischehen stammende, die diese Schulen besuchen. Die deutschsprachigen Schulen sind von der rumänischen Mehrheitsbevölkerung begehrt, da gute Sprachkenntnisse und die hohe pädagogische Qualität die beruflichen Chancen der Schulabgänger erhöhen.
Die Vermittlung bildungssprachlicher Fähigkeiten im Grundfach Deutsch bei sprachlich heterogenen Klassen – angesichts der Mehrsprachigkeitssituation und des kontinuierlichen Rückgangs an Sprachkenntnissen bei den Schülerinnen und Schülern dieser Einrichtungen – stellt die Lehrkräfte vor vielfältige Herausforderungen.
Da Deutsch den Abiturientinnen und Abiturienten landesweit und im Ausland bessere Berufschancen sichert und bei den ausländischen Unternehmen die Nachfrage nach Arbeitskräften mit Deutschkenntnissen anhaltend hoch ist, ist die Nachfrage nach einem DSD-Diplom sehr groß. Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD) ist in Rumänien das verbreitetste deutsche Sprachzertifikat an Schulen.3 Die DSD-I-Prüfung ist als Sprachzertifikat anerkannt und Bestandteil des rumänischen Bakkalaureats (dt. Abitur). Die DSD-II-Prüfung gilt als sprachlicher Nachweis für das Studium an einer deutschen Hochschule und ist damit besonders begehrt für Absolventinnen und Absolventen, die in Deutschland studieren oder arbeiten wollen.4
Im Mittelpunkt stehen folglich bildungssprachliche Kompetenzen, die im Unterrichtsfach Deutsch als Muttersprache5 an DSD-Schulen landesweit ausgebildet werden (müssen). Dabei wird die Konzeption des Lehrbuchs für Deutsch als Muttersprache (2022), das aktuell an den „deutschen Schulen“ (staatliche Schulen mit Deutsch als Unterrichtssprache) in Rumänien in der 7. Klasse eingesetzt wird, exemplarisch untersucht. Es wird darüber hinaus auch danach gefragt, welches (Sprach-)Wissen vorausgesetzt und vermittelt wird, um bildungssprachlich kompetent agieren zu können.
Daher zeigt Teil III nicht nur das Profil des bildungssprachförderlichen Unterrichts aus der Sicht des Übungs- und Aufgabenangebots auf, sondern auch, wie bildungssprachliche Fähigkeiten im gymnasialen DaM-Unterricht an rumänischen Schulen gefördert werden. Kapitel 7 geht deshalb von den Bereichen des Sprachhandelns aus, die im Rahmencurriculum für das Fach Deutsch als Muttersprache auf der Gymnasialstufe (7. Klasse) vorgesehen sind. Die Lehrbuchanalyse legt den Fokus auf das bildungssprachliche Inventar (Operatoren), um – ausgehend von den Anforderungsbereichen für dem DaM- Unterricht – die Notwendigkeit der Förderung des sprachaufmerksamen Handelns im Unterricht zu betonen. Ein weiteres Kapitel (Kap. 8) berücksichtigt die für die Zentralregion Rumäniens, Siebenbürgen gewachsene historische Mehrsprachigkeit als Potenzial für die Aneignung bildungssprachlicher Fähigkeiten.
Am Beispiel der Erscheinung Kollokation als Form des gebundenen Sprachgebrauchs werden Leitprinzipien der unterrichtlichen Einbindung und der sprachübergreifenden Vermittlung eingebracht und die Relevanz formelhafter Prägungen für die Interaktionsdurchführung und Textkonstitution bzw. den Stellenwert von Kollokationen im bildungssprachlichen Inventar auch aus interlingualer Perspektive aufgezeigt. Da die sprachübliche Kombinatorik einzelner Wörter aufgrund von Kombinationspräferenzen und -restriktionen aus der Sicht der handelnden Kompetenzentwicklung bedeutsam ist und die Beherrschung konventionalisierter Wortverbindungen unterschiedlichen Typs als Bedingung für eine einwandfreie interkulturelle Kommunikation gilt, werden die Ausführungen exemplarisch auf ein EU-Projekt eingehen, an dem die Sprachen Deutsch und Rumänisch beteiligt waren. Ein Schlusskapitel (Kap. 9) zur Bildungssprache Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit an rumänischen Schulen rundet diesen Buchteil ab.
Teil IV Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit in Rumänien berücksichtigt die aktuelle Sprachsituation an schulischen Einrichtungen in Rumänien und verdeutlicht die Konsequenzen des Sprachverlustes für den deutschsprachigen Unterricht (Kap. 10) sowie einige Bemühungen um den Erhalt und die Pflege des Deutschen in Rumänien (Kap. 11). Deshalb werden aus der Sicht des Domänenverlustes künftige Perspektiven von Deutsch in Rumänien aufgezeigt (Kap. 12).
Der Schlussteil resümiert die wichtigsten Erkenntnisse zur Situation von Deutsch in ausgewählten Regionen mit autochthonen deutschen Minderheiten, speziell in Hermannstadt/Siebenbürgen (Rumänien).
Der Band belegt über die Besonderheiten nationaler Bildungssysteme, Beschulungsmodelle in Regionen mit autochthonen deutschen Minderheiten, Regelungen und Unterstützungsmaßnahmen zur Stärkung von Deutsch hinaus, wie sich aktuell die Situation von Deutsch in einigen MO- und SO- Ländern beschreiben lässt, welche die Prinzipien des bildungssprachförderlichen Deutschunterrichts bei der bildungsgerechten Sprachgestaltung im DaM-Unterricht allgemein und im Kontext von Mehrsprachigkeit zu beachten sind, und wie eine erfolgreiche Aneignung bildungssprachlicher Fähigkeiten erreicht werden kann.
In den Regionen, in denen die „Minderheitenschulen“ angesiedelt sind, liegt der Anteil der Schülerinnen und Schüler aus autochthonen deutschen Minderheitenfamilien schätzungsweise unter 5 %. Schülerinnen und Schülern, die Deutsch als Erst- und Familiensprache haben, sind gegenwärtig die Ausnahme an Deutschen Auslandsschulen und DSD-Schulen. Daher sind diese Einrichtungen eher als Begegnungsschulen zu betrachten, die bei Lehrkräften und Schülerschaft Fach- und Sprachkompetenz gleichermaßen voraussetzen und daher besondere Anforderungen stellen.
Wenn auch in den Nationalitätenschulen der hier beispielhaft genannten Regionen mit autochthonen deutschen Minderheiten nur noch selten Angehörige der deutschen Minderheit, deren Erst- und Familiensprache Deutsch ist, vorzufinden sind, gehören diese Schulen zu den erfolgreichsten. Der Besuch einer „deutschen Schule“ – in der Regel einer DSD-Schule – ist ein favorisierter Bildungsweg, nicht nur, weil dies der Wahrung des kulturellen und sprachlichen Erbes dient, sondern auch unabhängig von der Zugehörigkeit zur deutschen Minderheit eine erfolgreiche schulische und berufliche Karriere verspricht. Das macht die „deutschen Schulen“ begehrenswert auch für die Mehrheitsgesellschaft.
Anders als im innerdeutschen Raum erfährt die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler die Aneignung der deutschen Sprache nicht über die Alltagssprache. Bereits von früher Kindheit an im Kindergarten und in der Grundschule werden die Kinder auf ihre schulische Karriere und auf den Umgang mit dem bildungssprachlichen Inventar vorbereitet. Dennoch ist der (Fach-)Unterricht an DSD-Schulen und die Aneignung bildungssprachlicher Kompetenzen eine besondere Herausforderung für Lehrkräfte und Schülerschaft.
1 In der rumänischen Verfassung wird Rumänien als „Nationalstaat“ definiert. Auf dem Gebiet Rumäniens leben mehrere historische Volksgruppen, zu denen die Ungarn, Roma, Ukrainer und Deutsche gehören sowie die Tartaren, Bulgaren, Juden, Serben, Armenier und Griechen. Die rumänische Verfassung sichert ethnischen Minderheiten explizit den Schutz ihrer Identität, Kultur und Sprache zu, garantiert zudem deren politische Vertretung im Parlament. Nach den Parlamentswahlen 2020 sind insgesamt 18 Parteien mit Minderheitenstatus im Parlament vertreten.
2 Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen; https://www.coe.int/de/web/european-charter-regional-or-minority-languages [Stand: 14.06.2024].
Details
- Pages
- 278
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631914045
- ISBN (ePUB)
- 9783631914052
- ISBN (Hardcover)
- 9783631914038
- DOI
- 10.3726/b21507
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (February)
- Keywords
- Deutsche Auslands- und DSD-Schulen autochthone Minderheiten mehrsprachige Bildungskontexte Bildungssprache Deutsch bildungssprachliche Kompetenzen Ungarn Polen Rumänien Sprachförderung Deutsch Bildungswesen Kollokationen aus interlingualer Perspektive Operatoren Lehrbuchanalyse Sprachbildung im Fach DaM
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 278 S., 5 S/W Abb., 12 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG