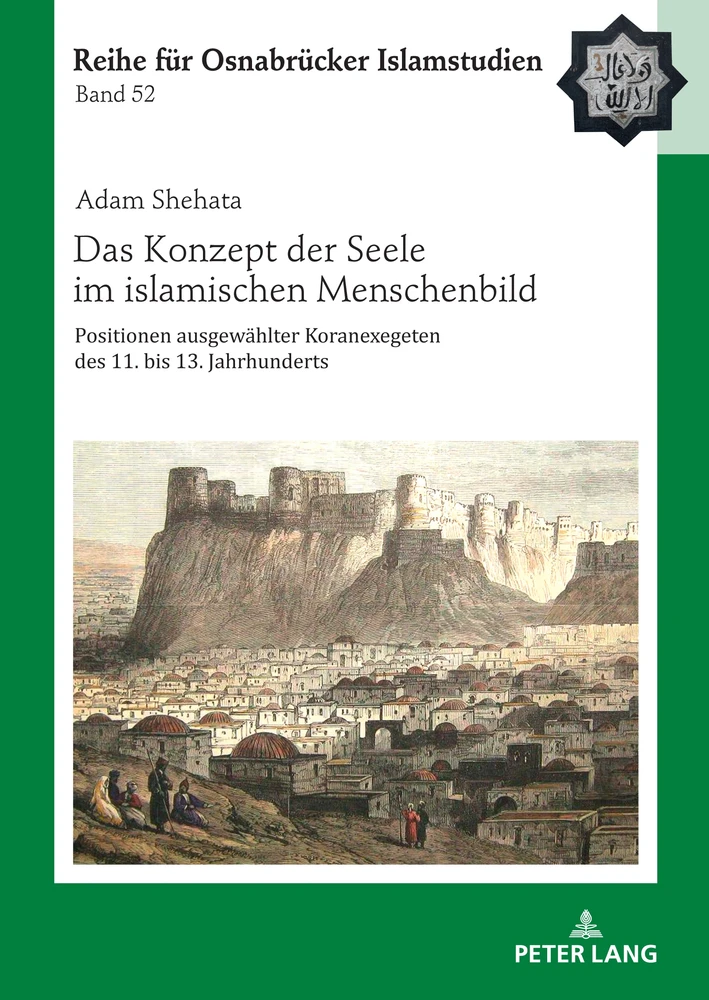Das Konzept der Seele im islamischen Menschenbild
Positionen ausgewählter Koranexegeten des 11. bis 13. Jahrhunderts
Summary
In diesem Buch wird das Verständnis muslimischer Gelehrter von nafs und rūḥ sowie dessen Bedeutung für ein islamisches Menschenbild beleuchtet. Der Autor untersucht, wie in den Disziplinen islamischer Philosophie, kalām und Koranexegese bis ins 11. Jahrhundert über die Seele diskutiert wurde, wobei er auch Einflüsse griechischer Philosophie aufzeigt. Sodann werden die tafsīr-Werke von al-Māwardī, Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī und al-Bayḍāwī systematisch auf ihre Aussagen zu Themen wie Schöpfung, Lebenskraft, Persönlichkeit, Natur und Wesen der Seele, ihrem Verhältnis zum Körper sowie ihrer Position zwischen diesseitigem und jenseitigem Leben analysiert.
Damit wird ein entscheidender Abschnitt islamischer Ideengeschichte zu Seelenkonzept, Menschenbild und Menschenwürde aufgearbeitet.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Hinweise zum Text
- Einleitung
- Kapitel I: Theologische und linguistische Grundlagen
- 1.1 Sprachliche Definition von nafs und rūḥ
- 1.1.1 Nafs
- 1.1.2 Rūḥ
- 1.1.3 Qalb
- 1.2 Theologische Quelltexte: Nafs und rūḥ in Koran und Hadith
- Kapitel II: Die islamisch-theologische Diskussion über nafs und rūḥ bis ins 11. Jahrhundert
- 2.1 Das Aufkommen der muʿtazilitischen Theologie und erster außermuslimischer Einflüsse
- 2.1.1 Die ersten Muʿtaziliten
- 2.1.2 Die Zeit großer muʿtazilitischer Theologen: Muʿammar, Abū l-Huḏayl und an-Naẓẓām
- 2.2 Die Graeco-Arabica-Übersetzungsbewegung und ihre Bedeutung: Ein Überblick
- 2.2.1 Die Übersetzungsbewegung
- 2.2.2 Die Rezeption griechisch-philosophischer Seelentheorien bei muslimischen Philosophen bis Ibn Sīnā
- 2.3 Die Schule der Ašʿariyya
- 2.3.1 Einführung
- 2.3.2 Der Mensch
- 2.3.3 Leben und Tod
- 2.3.4 Eine Einheit oder eine Vielzahl von Teilen?
- 2.3.5 Nafs und rūḥ bei den frühen Ašʿariten
- 2.4 Die Māturīdiyya
- 2.4.1 Die Entstehung der Māturīdiyya: Ein grober Überblick
- 2.4.2 Al-Māturīdī über nafs und rūḥ
- 2.5 Tafsīr-Werke des 8. bis 10. Jahrhunderts
- 2.5.1 Von Muqātil b. Sulaymān bis Abū l-Layṯ as-Samarqandī
- 2.5.2 Das Taʾwīlāt ahl as-sunna von al-Māturīdī
- 2.5.3 Das kontrastreiche Ergebnis
- Kapitel III: Kurzbiographien von al-Māwardī, ar-Rāzī und al-Bayḍāwī
- 3.1 Al-Māwardī (364/972–450/1058)
- 3.1.1 Eckdaten seiner intellektuellen Biographie
- 3.1.2 Der historische Kontext
- 3.1.3 Sein Exegesewerk an-Nukat wa-l-ʿuyūn
- 3.2 Ar-Rāzī (544/1150–606/1210)
- 3.2.1 Der historische Kontext und Eckdaten seiner intellektuellen Biographie
- 3.2.2 Sein Exegesewerk Mafātīḥ al-ġayb oder at-Tafsīr al-kabīr
- 3.3 Al-Bayḍāwī (gest. zw. 685/1286 und 716/1316)
- 3.3.1 Eckdaten seiner intellektuellen Biographie
- 3.3.2 Der historische Kontext
- 3.3.3 Sein Exegesewerk Anwār at-tanzīl wa-asrār at-taʾwīl
- Kapitel IV: Übersetzung des Kommentars von ar-Rāzī zu Vers 17:85
- 4.1 Abschnitt I: Die Streitfrage, die der Vers behandelt
- 4.2 Abschnitt II: Fragwürdige, alternative Deutungen des Wortes rūḥ in diesem Vers
- 4.3 Abschnitt III: Widerlegung der Materialität des menschlichen Wesens, Teil 1
- 4.4 Abschnitt IV: Widerlegung der Materialität des menschlichen Wesens, Teil 2
- 4.5 Abschnitt V: Rationale Argumente für Existenz und Immaterialität der nafs
- 4.6 Abschnitt VI: Belege für die Immaterialität der nafs/rūḥ aus der Offenbarung
- 4.7 Abschnitt VII: Die Bestätigung der Existenz und Immaterialität der nafs/rūḥ durch den Vers 17:85
- Kapitel V: Konzepte und Ansichten der Exegeten des 11. bis 13. Jahrhunderts zu nafs und rūḥ
- 5.1 Einführende Bemerkungen zu nafs und rūḥ in den ausgewählten Exegesewerken
- 5.1.1 Semantische Felder der Begriffe nafs und rūḥ
- 5.1.2 Ungewisse und missverständliche Deutungen des Wortes nafs
- 5.1.3 Zur Deutung der Begriffe nafs und rūḥ als Synonyme
- 5.1.4 Zur Auswahl der in dieser Arbeit untersuchten Verse und Kommentarstellen
- 5.2 Die Schöpfung der nafs bzw. rūḥ und ihr Verbleib nach dem Tod
- 5.2.1 Schöpfung und Ursprung
- 5.2.2 Der Verbleib von nafs bzw. rūḥ nach dem Tod des Körpers
- 5.3 Über das Wesen von nafs und rūḥ
- 5.3.1 Die rūḥ und die Lebenskraft
- 5.3.2 Ist die nafs bzw. rūḥ der Mensch?
- 5.3.3 Nafs und rūḥ zwischen Materialität und Immaterialität
- 5.4 Über Wachsein, Schlaf und Tod
- 5.5 Spezifika von nafs und rūḥ
- 5.5.1 Die nafs bzw. rūḥ als denkendes, entscheidendes, glaubendes und handelndes Element
- 5.5.2 Die nafs bzw. rūḥ als Sitz der Neigungen und Emotionen
- 5.5.3 Die nafs bzw. rūḥ als verantwortliches und belohntes oder bestraftes Element
- 5.5.4 Über Ziele, Stufen und Stadien bei ar-Rāzī
- 5.6 Die nafs bzw. rūḥ und ihre Relation zum Körper
- 5.6.1 Themenbezogene Diskussionen in den drei Werken
- 5.6.2 Zum Dualismus
- 5.7 Zur Bedeutung der Konzepte von nafs und rūḥ für das Menschenbild
- 5.7.1 Theoretische Grundlagen
- 5.7.2 Nafs, rūḥ und das Menschenbild bei den drei Exegeten
- Kapitel VI: Schlussbetrachtungen
- 6.1 Die Ergebnisse im Zusammenhang
- 6.2 Muslimisches Selbstverständnis im Lichte von nafs und rūḥ
- 6.3 Die Lesung der unterschiedlichen Meinungen im Kontext von Pluralität und Pluralismus
- 6.3.1 Die forschungsbezogene Ausgangslage
- 6.3.2 Koranexegese und Pluralismus
- 6.4 Ausblick
- Literaturverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Behandelte Tafsīr-Werke des 8. bis 10. Jahrhunderts
Tabelle 3: Der Begriff rūḥ in ausgewählten Versen
Tabelle 4: Interpretationsvarianten des Begriffs rūḥ
Tabelle 5: Positionen der drei Exegeten im Überblick, Teil 1
Tabelle 6: Positionen der drei Exegeten im Überblick, Teil 2
Tabelle 7: Positionen der drei Exegeten im Überblick, Teil 3
Tabelle 8: Positionen der drei Exegeten im Überblick, Teil 4
Tabelle 9: Positionen der drei Exegeten im Überblick, Teil 5
Einleitung
Zum Thema der Arbeit
Seit jeher beschäftigt die Seele den Menschen. In vielen Religionen und Kulturen wurde versucht eine Antwort auf die Frage danach zu finden, ob es sie gibt, was sie ist und was sie für den Menschen bedeutet. Auch muslimische Gelehrte suchten nach Antworten auf diese Fragen und wandten sich dazu an den Koran. Und so wurde die vorliegende Dissertation zu Beginn als Auseinandersetzung mit dem Verständnis der Seele bei Koranexegeten des 11. bis 13. Jahrhunderts gedacht. Schon sehr bald stellte sich die Erkenntnis ein, dass die Verwendung des Seelenbegriffs in mehrerlei Hinsicht irreführend wäre und daher die vordergründige Verwendung der arabischen Begriffe nafs und rūḥ vorzuziehen ist.1
Folgerichtig wird in dieser Arbeit den Fragen nachgegangen, welche Konzepte für nafs und rūḥ sich bei ausgewählten Koranexegeten finden lassen und welche Bedeutung diese Konzepte für ihr jeweiliges Menschenbild haben. Untersucht wird, wie sie allgemein mit den Begriffen nafs und rūḥ umgehen, wie ihre Vorstellungen von der Schöpfung der nafs bzw. rūḥ sind, welche Wesensart (māhiyya) und welche Wesenscharakteristika nafs und rūḥ zugeschrieben werden und wie ihre Rolle in der diesseitigen anders als in der jenseitigen Welt konzipiert wird. Auch die Beziehung von nafs bzw. rūḥ zum Körper ist von Relevanz. Hier treten etwa Fragen nach der Idee der Lebenskraft oder den Zuständen von Schlaf und Wachsein auf.
Auf kosmologische und philosophische Fragestellungen wird dabei in einem Ausmaß eingegangen, das der Beschäftigung der untersuchten Werke damit gerecht wird. Ferner untersucht die Arbeit die Bedeutung der einzelnen Vorstellungen von nafs und rūḥ für das Verständnis der Gelehrten vom Menschen. Eine solche Untersuchung verspricht die Betrachtung des muslimischen Menschenbilds aus neuen Blickwinkeln zu ermöglichen. Dabei wird der Fokus auf sunnitische Gelehrte des 11. bis 13. Jahrhunderts und ihre koranexegetischen Aussagen gelegt. Islamische Theologie durchlebte in dieser Zeitspanne dynamische Entwicklungen und wurde für lange Zeit geprägt. Die Tafsīr-Werke der Gelehrten al-Māwardī (gest. 450/1058), ar-Rāzī (gest. 606/1210) und al-Bayḍāwī (gest. 716/1316) sind wichtige Textzeugnisse dafür und stehen daher im Zentrum der Auseinandersetzung. Wenn davon ein besonderer Mehrwert erkennbar ist, werden diese Texte bei einzelnen Fragestellungen durch ausgewählte Werke von Autoren desselben Zeitraums ergänzt, die sich spezifisch mit dem Thema beschäftigen und Koranverse bei ihrer Argumentation verstärkt berücksichtigen.
Ein Charakteristikum des in der vorliegenden Dissertation ausgewählten Zeitraums ist der Zusammenhang zwischen philosophischen Werken der Antike und der Koranexegese. Zahlreiche in der Antike entstandene philosophische Werke waren zu dieser Zeit bereits in die arabische Sprache übersetzt und anschließend diskutiert worden. Die darin festgehaltenen Gedanken hatten so Eingang in die muslimische Gedankenwelt gefunden. Setzten sich muslimische Gelehrte von da an mit nafs und rūḥ auseinander, inkludierten sie dabei in vielen Fällen hellenistisches Gedankengut zur Seele. Dabei sahen sie sich der Herausforderung gegenüber, aufgenommene Ideen dem islamischen Gottesbild und der Schöpfungsvorstellung anzupassen. Dies einerseits um ihren eigenen religiösen Überzeugungen nicht zu widersprechen und andererseits, um nicht auf harsche Ablehnung zu stoßen oder gar dem Vorwurf des Abfalls vom Glauben ausgesetzt zu werden.2 So werden in dieser Arbeit auch die Umgangsformen der Gelehrten mit dieser Problematik analysiert.
Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist ihr Blick auf eine Metaebene, die bei der Beschäftigung mit nafs und rūḥ erkennbar wird. Dabei geht es um eine islamisch-theologisch argumentierte Haltung des einzelnen Menschen gegenüber allen anderen Menschen und gegenüber dem Leben insgesamt. Denn mit der Frage nach nafs und rūḥ gehen auch die Fragen einher, wer und was der Mensch ist und wie er seine Position in dieser Welt versteht. Abrundend wird in dieser Arbeit die Bedeutung der methodischen Zugänge der Koranexegeten und ihrer Umgangsformen mit unterschiedlichen Meinungen für eine pluralistische Haltung untersucht.
Spirituelle Themen haben in Religionen eine zentrale Funktion. Nach Ansicht des Autors machen es die mit dem Islam in engerem oder weiterem Zusammenhang stehenden Ereignisse der vergangenen 25 Jahre notwendig, spirituelle Themenfelder aufzugreifen und den Diskurs dazu sowohl im wissenschaftlichen als auch im gesellschaftlichen Raum beständig neu zu beleben. Damit soll zu einem Verständnis des Islams beigetragen werden, das gesellschaftliche Herausforderungen konstruktiv begegnet. Die Wissenschaft kann und muss hier einen wichtigen Beitrag leisten. Diesem Gedanken verpflichtet sich diese Arbeit.
Forschungsfrage und Forschungsziel
Nafs und rūḥ spielen für die islamisch-theologische Betrachtung des Menschen eine zentrale Rolle. Daher lässt es überraschend anmuten, dass die Diskussion über ihre Rolle, ihr Wesen und ihre Eigenschaften erst in einer fortgeschrittenen Phase islamischer Gelehrsamkeit intensiviert wurde. Ein bedeutender Teil der zugehörigen Debatte fand in den Werken der Koranexegese Niederschlag. In diesem Licht entstand die wie folgt formulierte Forschungsfrage: Welche Konzepte von nafs und rūḥ lassen sich bei Koranexegeten des 11. bis 13. Jahrhunderts ausmachen?
Dabei sollen auch die folgenden Unterfragen beantwortet werden: Welche Bedeutung haben diese Konzepte der einzelnen Autoren für ihre jeweilige Vorstellung vom Menschen? Welche Entwicklungsschritte der Konzeption von nafs und rūḥ lassen sich über die ausgewählte Phase der drei Jahrhunderte erkennen? Welche Einflüsse auf die untersuchten Meinungen lassen sich belegen und welche Auswirkungen hatten sie auf die Positionen der Gelehrten?
Die Dissertation strebt an, einen Ausschnitt der Diskussion sunnitischer Gelehrter zu nafs bzw. rūḥ und dem damit zusammenhängenden Menschenbild zu analysieren und zugänglich zu machen. Dass die Positionen sunnitischer Gelehrter dazu noch nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht worden sind – und sich somit ein offenes Feld auftut –, wird sich in der unten folgenden Darstellung des Forschungsstandes zeigen.
Um das gesetzte Ziel zu erreichen, wird eine Analyse ausgewählter Quellen durchgeführt. Das auf die Korankommentare gelegte Augenmerk soll dabei einer Begrenzung der Untersuchung auf möglichst nahe Auseinandersetzungen mit der primären Quelle muslimischen Denkens dienen.
Relevanz des Themas und Motivation
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Verständnis muslimischer Theologen vom Menschen und seiner Position sowohl in der diesseitigen als auch der jenseitigen Welt. Daraus gewinnt sie auch ihre wissenschaftliche Relevanz und gesellschaftliche Aktualität. Verspricht doch die gewonnene Kenntnis tieferen Einblick in die Betrachtung des Lebens und seiner Wertigkeit in der muslimischen Debatte des 11. bis 13. Jahrhunderts und darüber hinaus zu bieten. Denn die ausgewählten Exegesewerke dieser Epoche waren auch von großer Bedeutung für Gelehrte, die danach kommen sollten (vgl. Rippin 2000, 86 f.).
Da die Positionen von Koranexegeten zu einigen zentralen theologischen Themen in der westlichen, akademischen Welt noch nicht hinlänglich analysiert sind, war die Motivation groß, die Dissertation diesem Thema zu widmen.
Die Untersuchung diverser Einflüsse auf Gelehrte der islamischen Theologie ist ideengeschichtlich aufschlussreich. Unter anderem aus diesem Grund wird der Fokus auf das 11. bis 13. Jahrhundert gelegt, in welchen das Wirken externer Gedankeneinflüsse (griechische, verschiedene aus dem asiatischen Raum stammende, philosophische, etc.) bereits deutlich an Beispielen festzumachen ist. Die Gewichtung ist aber auch deshalb in diese Zeitphase gesetzt, da sie besonders prägend für die weitere Diskussion der muslimischen Gelehrten zu diesem Thema war. Genannt seien hier zentrale Akteure, wie al-Māwardī, az-Zamaḫšarī, ar-Rāġib al-Iṣfahānī, al-Ġazālī, Ibn al-Ǧawzī, ar-Rāzī, an-Nasafī, al-Bayḍāwī und Ibn al-Qayyim.
Darüber hinaus lassen sich für die Notwendigkeit einer weiteren systematischen Erschließung der Teilbereiche islamischer Theologie, gerade im deutschsprachigen Raum, wohl zahlreiche Gründe anführen. So macht das zahlenmäßige Wachstum muslimischer Bürger:innen in deutschsprachigen Ländern eine Kenntnis ihres kulturellen und religiösen Erbes unabdingbar, um konstruktives Zusammenleben zu fördern. Auch liegt es in der Hoffnung des Autors, dass weitere Auseinandersetzungen im innermuslimischen Diskurs zu spirituellen Themen eine positive gesellschaftliche Wirkung nicht verfehlen. Vielmehr noch, ein Mangel in der Abdeckung spiritueller Bedürfnisse und der Diskussion darüber kann sich in einer falsch verstandenen Religion und sozialen Problemen ausdrücken.
Aktueller Forschungsstand
Es lassen sich im europäischen Wissenschaftsfeld der Islamwissenschaften zahlreiche Arbeiten und Artikel finden, die sich mit den Themen nafs, rūḥ, Geist und Seele auseinandersetzen. Erstaunlich viele davon beschäftigen sich mit Standpunkten aus einer spezifisch sufitischen oder philosophischen Perspektive.3 Im Gegensatz dazu untersucht die vorliegende Arbeit klassisch sunnitische Positionen von Koranexegeten, um damit ein Meinungsspektrum zu behandeln, das quantitativ eine große Breitenwirkung hat.
Es werden hier von den zahlreichen Untersuchungen ausgewählte Arbeiten dargestellt, die mit dem gegebenen Themenfeld eng verwoben sind. Ihre Betrachtung erfolgt in sechs Kategorien. In der ersten Kategorie werden Forschungen dargestellt, die das Thema Seele aufgreifen, sich aber nicht auf Exegeten, sondern auf Gelehrte anderer Disziplinen, beziehen. Sodann sollen Arbeiten betrachtet werden, die für die Betrachtung des Seelenkonzepts primär auf den Korantext selbst blicken. Weiterhin Forschungen, die sich mit Exegeten beschäftigen, sich aber auf den Begriff rūḥ fokussieren und damit primär die Idee ‚Geist‘ behandeln. Danach geht es um Forschungen, die das Thema Seele bei Exegeten aufgreifen. Anschließend werden aktuelle, in arabischer Sprache verfasste Forschungen zum Thema angesprochen, um zuletzt Arbeiten zu betrachten, die das Menschenbild in Koran und Tafsīr thematisieren.
1. Forschungen, die das Thema Seele aufgreifen, sich aber nicht auf Exegeten beziehen
Genannt sei hier der 1943 in der Zeitschrift The Muslim World erschienene Artikel von Edwin Elliot Calverley. Er schrieb einen Beitrag unter dem Titel Doctrines of the Soul (nafs and rūḥ) in Islam (Calverley 1943). Darin stellt er die Ansicht mehrerer sunnitischer Gelehrter dar, bezieht sich dabei aber beinahe ausschließlich auf Aussagen, die nicht Werken der Koranexegese entstammen. Die von ihm untersuchten Gelehrten sind aber insofern für dieses Projekt relevant, da manche von ihnen in einer Zeit zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert gelebt haben. Jener Zeit also, die hier untersucht werden soll. Als Beispiel kann aš-Šahrastānī (gest. 548/1153) genannt werden.
Das Untersuchungsfeld der vorliegenden Arbeit von Korankommentaren des 11. bis 13. Jahrhunderts wird durch diesen Artikel nicht behandelt. Im Sinne der Arbeit kann aber auf relevante Anhaltspunkte darin zurückgegriffen werden.
2. Arbeiten, die sich mit der Idee der Seele im Koran beschäftigen
In diese Kategorie fallen Arbeiten, die Antworten auf verschiedene Fragestellungen zur Seele im Koran selbst suchen. Sie kommen dabei nicht umhin, selektiv Aussagen von Exegeten in ihre Betrachtungen einzubeziehen, aber Gesamtvorstellungen einzelner Exegeten oder die historische Entwicklung der exegetischen Auseinandersetzung zu eruieren, gehört nicht zu den für diese Arbeiten gesetzten Forschungszielen. Dazu gehören beispielsweise: The ‚Body versus Soul‘ Concept and the Quran von Hasanuddin Ahmad (Ahmad 1998) und The Qur’ānic Story of Joseph as a ‚History‘ of the Human Soul von Mohammed Rustom (Rustom 2015).
Details
- Pages
- 308
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631929421
- ISBN (ePUB)
- 9783631929438
- ISBN (Hardcover)
- 9783631929407
- DOI
- 10.3726/b22529
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (January)
- Keywords
- Menschenwürde Seelenkonzept kalām falsafa Tafsir Koranexegese Islamische Theologie Jenseits al-Bayḍāwī ar-Rāzī al-Māwardī Leib-Seele-Dualismus Menschenbild Razi rūḥ nafs Seele Eschatologie Ideengeschichte
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 308 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG