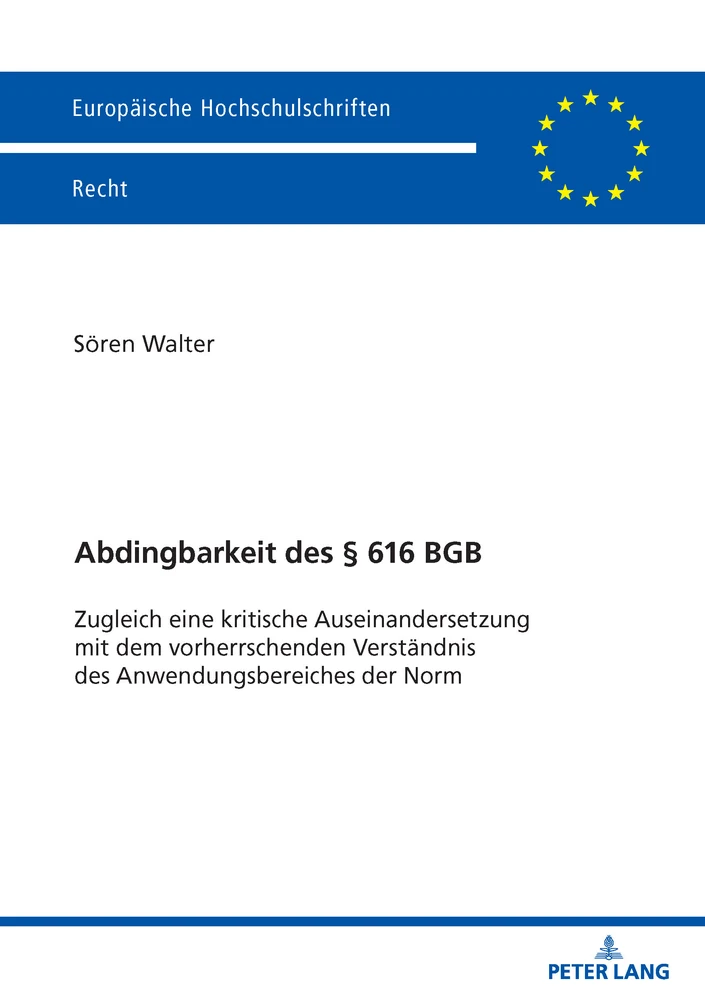Abdingbarkeit des § 616 BGB
Zugleich eine kritische Auseinandersetzung mit dem vorherrschenden Verständnis des Anwendungsbereiches der Norm
Summary
Die vorliegende Arbeit beleuchtet die Möglichkeit der Abdingbarkeit in Arbeits- und Dienstverträgen für „normale" Arbeitnehmer, geringfügige Beschäftigte, GmbH-Geschäftsführer sowie freie Mitarbeiter. Dabei werden mögliche Vertragsgestaltungen sowohl an Beschränkungen durch das Sozial(versicherungs-)recht als auch durch das AGB-Recht gemessen.
Als Ergebnis der Untersuchung unterbreitet der Autor konkrete Klauselvorschläge. Damit ist die Arbeit vor allem für die Praxis eine Unterstützung bei der Vertragsgestaltung.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titelseite
- Copyright-Seite
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Abkürzungsverzeichnis
- A) Einleitung
- I) Fragestellung
- II) Thesen
- 1) Thesen zum Anwendungsbereich und zur Auslegung des § 616 BGB
- 2) Thesen zur Abdingbarkeit des § 616 BGB
- III) Vorgehen
- 1) Betrachtung des Verhältnisses des § 616 BGB zu § 275 BGB
- 2) Anwendungsbereich und Auslegung des § 616 BGB
- 3) Abdingbarkeit des § 616 BGB
- B) Verhältnis der Hauptleistungspflichten im Dienst- und Arbeitsvertrag
- I) Auswirkung des § 616 BGB auf Haupt- und Gegenleistungspflicht
- 1) Regelungsgehalt bis zur Schuldrechtsreform 2002
- 2) Regelungsgehalt nach der Schuldrechtsreform 2002
- a) Fortbestehen der Doppelfunktion
- b) Leistungsbefreiung allein aus § 275 BGB
- c) Stellungnahme
- 3) Zwischenergebnis
- II) Fälle der Unmöglichkeit nach § 275 BGB
- 1) Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 1 BGB
- a) Unmöglichkeit bei festgelegten Arbeitszeiten
- b) Unmöglichkeit bei flexiblen Arbeitszeiten
- aa) Unmöglichkeit bei flexiblen Arbeitszeiten unter Anwendbarkeit des ArbZG
- bb) Unmöglichkeit bei flexiblen Arbeitszeiten bei fehlender Anwendbarkeit des ArbZG
- cc) Unmöglichkeit bei flexiblen Arbeitszeiten mit beschränkten Minusstunden
- dd) Zwischenergebnis
- 2) Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 3 BGB
- a) Berücksichtigbare Interessen auf der Seite des Dienstberechtigten
- aa) Berücksichtigung des Fortbestehens der Vergütungspflicht
- bb) Alleinige Berücksichtigung des Leistungsinteresses
- cc) Zwischenergebnis
- b) Berücksichtigbare Interessen auf Seiten des Dienstverpflichteten
- aa) Keine Berücksichtigung des Vertretenmüssens
- bb) Berücksichtigung des Vertretenmüssens
- cc) Stellungnahme
- dd) Zwischenergebnis
- c) Interessenabwägung
- aa) Bisher vertretene Lösungen
- (1) Restriktive Anwendung des § 275 Abs. 3 BGB
- (2) Weitreichende Anwendung des § 275 Abs. 3 BGB
- (3) Stellungnahme
- (4) Einschränkung einer weitreichenden Anwendung des § 275 Abs. 3 BGB
- bb) Lösungsansatz in Anlehnung an das Urlaubsrecht
- (1) Übertragung der Grundsätze des Urlaubsrechts
- (2) Berücksichtigung der Wertungen des Privatrechts
- (3) Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls
- (4) Berücksichtigung des Vertretenmüssens
- (5) Mögliche Kritik
- (a) Rechtsprechung zu § 106 GewO
- (b) Gesetzlicher Freistellungsanspruch
- (c) Praktische Erwägungen
- cc) Ergebnis
- 3) Schicksal der Gegenleistungspflicht
- 4) Zwischenergebnis
- III) Dogmatische Einordnung und Klassifikation des § 616 BGB
- 1) § 616 BGB: Eigenständige Anspruchsgrundlage oder Aufrechterhaltung des Vergütungsanspruchs
- 2) § 616 BGB als Gefahrtragungsregel
- 3) § 616 BGB als Ausnahmevorschrift
- 4) Zwischenergebnis
- C) Entstehung und Anwendungsbereich des § 616 BGB
- I) Motive und Normzweck des § 616 BGB
- 1) Kommission
- 2) Rechtsprechung
- 3) Literatur
- a) Fürsorgepflicht
- b) Grundsatz „minima non curat praetor“
- c) Grundrechtsorientiertes Verständnis
- 4) Stellungnahme
- a) Arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht
- aa) Grundgedanke
- bb) Kritik
- b) „minima non curat praetor“
- c) Grundrechtsorientiertes Verständnis
- d) Gesamtwürdigung und eigener Ansatz
- 5) Zwischenergebnis
- II) Anwendungsbereich und Tatbestand des § 616 BGB
- 1) Verhinderung
- 2) „in seiner Person liegende[r] Grund“
- a) Allgemeine Grundsätze
- aa) Negativabgrenzung
- bb) Grenze zwischen subjektivem und objektivem Leistungshindernis
- (1) Exkurs: Maßnahmen in der COVID-19-Pandemie
- (a) Pandemiemaßnahmen als objektives Leistungshindernis
- (b) Pandemiemaßnahmen als subjektives Leistungshindernis
- (c) Stellungnahme und Fazit
- (2) Zwischenergebnis
- cc) Verhinderungsgründe durch persönliche Nähebeziehung
- dd) Verhinderung durch öffentliche und anderweitige Pflichten
- ee) Private Lebensführung
- ff) Verhinderung wegen des Glaubens bzw. Gewissens
- gg) Zwischenergebnis
- b) Spezialgesetzliche Regelungen
- aa) Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
- (1) Gesetzgeberische Motive
- (2) Entwicklung der Entgeltfortzahlung im deutschen Recht
- (a) § 616 Abs. 2, 3 BGB a. F.
- (aa) Gründe für die Schaffung des § 616 Abs. 2, 3 BGB a. F.
- (bb) Reichweite des Entgeltfortzahlungsanspruchs
- (b) § 63 HGB und § 133c GewO
- (c) Lohnfortzahlungsgesetz
- (d) Zwischenergebnis
- (3) Persönlicher Anwendungsbereich des § 3 EFZG
- (4) Sachlicher Anwendungsbereich des § 3 EFZG
- (a) Krankheit
- (b) Arbeitsunfähigkeit
- (aa) Arbeitsunfähigkeit als bloße Arbeitsverhinderung
- (bb) Zwischenergebnis
- (cc) Anwendbarkeit des § 616 BGB bei untertägiger krankheitsbedingter Verhinderung
- (i) Ablehnung einer Teilarbeitsunfähigkeit
- (ii) Auswirkung des Direktionsrechts
- (iii) Befürwortung einer (qualitativen) Teilarbeitsunfähigkeit
- (iv) Zwischenergebnis
- (v) Quantitative Teilarbeitsunfähigkeit auf Grund der krankheitsbedingten Wahrnehmung von Arztterminen
- (vi) Zwischenergebnis
- (c) Zwischenergebnis zum Anwendungsbereich des § 3 EFZG
- (5) Verhältnis zu und Einfluss auf § 616 BGB
- (a) Kollision der Regelungen
- (aa) Anwendbarkeit des § 616 BGB während der Wartezeit des § 3 EFZG
- (bb) Weitere Kollisionen
- (b) Anwendungsbereichsbeschränkung des § 616 BGB durch § 3 EFZG
- bb) § 2 PflegeZG
- (1) Rechtslage vor Einführung
- (2) Anwendungsbereich und Voraussetzungen
- (a) Persönlicher Anwendungsbereich
- (b) Voraussetzungen
- (aa) Nahe Angehörige
- (bb) „Akut aufgetretene Pflegesituation“
- (c) Anspruchsinhalt
- (aa) Freistellung
- (bb) Vergütungsfortzahlung
- (i) Allgemeine Grundsätze
- (ii) Abhängigkeit der Vergütungsfortzahlung vom Begriff des „nahen Angehörigen“
- (3) Zwischenergebnis
- cc) § 45 SGB V
- (1) Rechtslage vor Einführung der Norm
- (2) Grundsätzliche Systematik
- (a) Berechtigte
- (b) Krankheit des Kindes
- (3) Anspruchsinhalt
- (a) Freistellungsanspruch
- (b) Anspruch auf Kinderkrankengeld
- (4) Zwischenergebnis
- (5) Verhältnis zu § 275 Abs. 3 BGB
- (a) Normverhältnis
- (b) Übertragung der Wertungen
- (6) Zwischenergebnis
- c) Vermeidbarkeit
- aa) Berücksichtigung allein im Rahmen des § 275 Abs. 3 BGB
- bb) Vermeidbarkeit als Unterfall des Verschuldens im Rahmen des § 616 BGB
- cc) Vermeidbarkeit als Ausschluss des Leistungshindernisses im Sinne des § 616 BGB
- dd) Zwischenergebnis
- d) Zwischenergebnis
- 3) „Verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“
- a) Überschreiten der „verhältnismäßig nicht erheblichen Zeit“
- aa) Fortbestehen des Anspruchs
- bb) Rückwirkender Entfall des Anspruchs
- cc) Stellungnahme
- dd) Exkurs: Rückwirkender Entfall bei Krankheit von nicht § 3 EFZG unterfallenden Beschäftigten
- b) Bestimmung der „verhältnismäßig nicht erheblichen Zeit“
- aa) Betrachtungsweisen
- (1) Belastungsorientierte Betrachtung
- (2) Ereignisorientierte Betrachtung
- (3) Gemischte Betrachtung
- bb) Spezialgesetzliche Regelungen
- (1) Entgeltfortzahlung bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit
- (a) § 616 Abs. 2 BGB a. F.
- (b) § 63 HGB und § 133c GewO
- (aa) Fortsetzungserkrankungen
- (bb) Einheit des Verhinderungsfalls
- (c) Zwischenergebnis
- (d) Wirtschaftliche Erwägungen im ArbKrankhG
- (aa) Beschränkungen hinsichtlich der Anspruchsentstehung
- (bb) Behandlung von Fortsetzungs- und sich überschneidenden Erkrankungen
- (cc) Zwischenergebnis
- (e) Änderungen mit dem LohnFG
- (f) Entgeltfortzahlung nach § 3 EFZG
- (aa) Dauer der Entgeltfortzahlung
- (bb) Entlastung des Arbeitgebers
- (cc) Kein Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Leistung und Gegenleistung
- (dd) Wartezeit als Instrument der Verhältnismäßigkeit von Leistung und Gegenleistung
- (ee) Zwischenergebnis
- (g) Zwischenergebnis zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit
- (aa) Finanzpolitischer und sozialpolitischer Hintergrund
- (bb) Verhältnis von Leistung und Gegenleistung
- (2) § 2 PflegeZG
- (a) Dauer der Freistellung nach § 2 PflegeZG
- (b) Dauer der Fortzahlung nach § 616 BGB
- (3) § 45 SGB V
- (a) Dauer der Leistungsbefreiung nach § 45 SGB V
- (b) Einfluss auf die Vergütungsfortzahlung
- (aa) Ablehnende Ansichten
- (bb) Befürwortende Ansichten
- (cc) Stellungnahme
- (i) Nicht-Regelung als Indiz für die Übertragbarkeit
- (ii) Familienpolitische Erwägungen als Leitlinie für Wandel des Betreuungsbedarfs
- (iii) Schutz des Subsidiaritätsgrundsatzes
- (iv) Orientierung auch ohne Rechtsgrundlage möglich
- (v) Ausufernder Anspruch
- (vi) Fazit
- cc) Stellungnahme zum Verständnis der „verhältnismäßig nicht erheblichen Zeit“
- (1) Stellungnahme zur belastungsorientierten Betrachtung
- (2) Stellungnahme zur ereignisorientierten Betrachtung
- (3) Stellungnahme zur gemischten Betrachtung
- (4) Stellungnahme zur generellen Beschränkung auf wenige Tage
- (5) Eigener Ansatz
- (a) Herleitung
- (b) Mögliche Kritik und Vorteile
- (aa) Kritik: Bewusste Trennung des § 616 BGB von spezialgesetzlichen Regelungen
- (bb) Kritik: Unterschiedliche Motive bei § 3 EFZG und § 616 BGB
- (cc) Vorteil: Erwartbarkeit und Kalkulierbarkeit des Risikos sowie Rechtssicherheit
- (dd) Vorteil: Entsprechen der Regelungspraxis im Kollektivarbeitsrecht
- (ee) Zwischenergebnis
- dd) Exkurs: Sonderfall COVID-19-Pandemie
- ee) Zwischenergebnis
- 4) Verschulden
- III) Bedeutung des Anwendungsbereiches für die Abdingbarkeit des § 616 BGB
- D) Abdingbarkeit des § 616 BGB
- I) Grundsätzliche Abdingbarkeit des § 616 BGB
- 1) Meinungsstand bezüglich der grundsätzlichen Abdingbarkeit
- 2) Abdingbarkeit spezialgesetzlicher Regeln
- a) Abdingbarkeit der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
- b) Abdingbarkeit des § 2 PflegeZG
- c) Abdingbarkeit der Fortzahlung nach § 45 Abs. 1 SGB V
- d) Zwischenergebnis
- 3) Konkretisierung oder Abbedingung
- 4) Abbedingung durch arbeitszeitrechtliche Regelungen
- 5) Vertraglich vereinbarte Subsidiarität
- II) Beschränkungen der Abdingbarkeit bei subsidiären Vergütungsfortzahlungsregelungen und -ersatzregelungen
- 1) Abbedingung als Vertrag zu Lasten Dritter
- 2) Abbedingung als Rechtsmissbrauch bzw. Verstoß gegen § 138 Abs. 1 BGB
- 3) Beschränkungen durch das Sozialrecht
- a) Subsidiaritätsprinzip
- b) § 46 Abs. 2 SGB I
- 4) „venire contra factum proprium“ auf Grund des Ausschlusses der primären Fortzahlungspflicht des Dienstberechtigten
- 5) Zwischenergebnis
- III) Beschränkungen der Abdingbarkeit durch das AGB-Recht
- 1) Anwendbarkeit des AGB-Rechts
- a) Ausschluss der Kontrolle vertraglicher Hauptleistungspflichten
- aa) Preis- oder Preisnebenabreden im Sinne der AGB-Kontrolle
- bb) Einordnung des § 616 BGB
- cc) Zwischenergebnis
- b) Tarifverträge
- c) Arbeitsverträge
- aa) Wesensmerkmale eines Arbeitsvertrages
- bb) Anwendbarkeit der AGB-Kontrolle auf Arbeitsverträge
- cc) Kontrollmaßstab
- (1) Arbeitnehmer als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB
- (2) Berücksichtigung der Besonderheiten des Arbeitsrechts
- (a) Berücksichtigung tatsächlicher Umstände
- (b) Bisherige Rechtsprechung als im Arbeitsrecht geltende Besonderheit
- (c) Zwischenergebnis
- d) Dienstverträge
- aa) Wesensmerkmale von Dienstverträgen und Anwendbarkeit des § 616 BGB
- (1) Freie Mitarbeiter
- (2) Geschäftsführeranstellungsverträge
- (a) Geschäftsführer als Dienstverpflichteter
- (b) Geschäftsführer als Arbeitnehmer
- (c) Geschäftsführer als arbeitnehmerähnliche Person
- (d) Stellungnahme
- (e) Zwischenergebnis
- bb) Kontrollmaßstab
- (1) Anwendbarkeit der §§ 305 ff. BGB
- (a) Freier Mitarbeiter als Unternehmer im Sinne des § 14 BGB
- (b) Geschäftsführer als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB
- (2) Anwendbarkeit des § 310 Abs. 4 S. 2 BGB
- 2) Inhaltskontrolle
- a) Überraschende Klausel – § 305c Abs. 1 BGB
- aa) Grundsatz
- bb) Überraschende Klausel auf Grund des Inhalts
- cc) Überraschende Klausel auf Grund der Stelle der Regelung im Arbeits- und Dienstvertrag
- dd) Zwischenergebnis
- b) Transparenzgebot – § 307 Abs. 1 S. 2 BGB
- aa) Grundsatz des Transparenzgebotes
- (1) Grundsätze im allgemeinen Zivilrecht
- (2) Anwendung der Grundsätze im Arbeitsrecht
- bb) Beurteilungsmaßstäbe
- (1) Maßstab bei Verbraucherverträgen
- (2) Zwischenergebnis
- (3) Maßstab bei Verträgen zwischen Unternehmern
- cc) Unklarheiten hinsichtlich des Umfangs der Abbedingung
- dd) Einschränkung des Anwendungsbereichs des § 616 BGB
- (1) Arbeitsverträge
- (a) Pauschale Abbedingung
- (aa) Inhaltliche Intransparenz durch das Verhältnis zu § 44a Abs. 3 SGB XI und § 45 Abs. 1 SGB V
- (i) Intransparenz auf Grund der Abgrenzung zu § 44a Abs. 3 SGB XI und § 45 Abs. 1 SGB V
- (ii) Intransparenz auf Grund der Nichterkennbarkeit wirtschaftlicher Nachteile
- (iii) Intransparenz auf Grund der Hinderung der Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte
- (iv) Zwischenergebnis
- (bb) Inhaltliche Intransparenz durch das Verhältnis zu § 3 EFZG
- (cc) Intransparenz durch Verweisung
- (i) Eine Verweisung genügt den Transparenzanforderungen
- (ii) Eine Verweisung ist intransparent
- (iii) Stellungnahme
- (iv) Zwischenergebnis
- (dd) Zwischenergebnis
- (b) Abbedingung bei subsidiären Vergütungsfortzahlungsregelungen und -ersatzregelungen
- (aa) Generalklauselartiger Ausschluss
- (i) Grenzen des Bestimmtheitsgebotes
- (ii) Bewertung im vorliegenden Fall
- (iii) Zwischenergebnis
- (bb) Konkreter Ausschluss
- (c) Zwischenergebnis
- (d) Definition des Anwendungsbereichs durch Beispiele
- (aa) Abschließende Aufzählung der anspruchsbegründenden Fälle
- (bb) Exemplarische Aufzählung der anspruchsbegründenden Fälle
- (2) Dienstverträge
- (a) Inhaltliche Intransparenz durch das Verhältnis zu anderen Normen
- (aa) Geschäftsführer
- (i) Verhältnis zu § 44a Abs. 3 SGB XI und § 45 Abs. 1 SGB V
- (ii) Verhältnis zu § 3 EFZG
- (bb) Freie Mitarbeiter
- (b) Inhaltliche Intransparenz durch Verweisung
- (aa) Geschäftsführer
- (bb) Freie Mitarbeiter
- (c) Abbedingung bei subsidiären Vergütungsfortzahlungsregelungen und -ersatzregelungen
- (3) Zwischenergebnis
- ee) Bestimmungen hinsichtlich der Dauer der „verhältnismäßig nicht erheblichen Zeit“
- (1) Arbeitsverträge
- (a) Konkretisierung für bestimmte Anwendungsfälle
- (aa) Abschließende Aufzählung der Anwendungsfälle
- (bb) Beispielhafte Aufzählung der Anwendungsfälle
- (b) Bestimmung der Verhältnismäßigkeit anhand der Betriebszugehörigkeit
- (2) Dienstverträge
- (a) Geschäftsführer
- (b) Freie Mitarbeiter
- (3) Zwischenergebnis
- ff) Zwischenergebnis
- c) Unangemessene Benachteiligung – § 307 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BGB
- aa) Grundsätze der unangemessenen Benachteiligung
- (1) Unangemessene Benachteiligung nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB
- (a) Grundsätze
- (aa) Ermittlung eines wesentlichen Grundgedankens
- (bb) Unvereinbarkeit – Interessenabwägung
- (b) Wesentlicher Grundgedanke des § 616 BGB
- (aa) Meinungsstand
- (i) § 616 BGB enthält einen wesentlichen Grundgedanken
- (ii) § 616 BGB enthält keinen wesentlichen Grundgedanken
- (iii) Streit über das Verständnis der Rechtsprechung des BAG
- (bb) Stellungnahme
- (i) Keine Positionierung des BAG erkennbar
- (ii) Differenzierte Betrachtung des Vorliegens eines wesentlichen Grundgedankens
- (2) Unangemessene Benachteiligung nach § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB
- (a) Normzweck des § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB
- (b) Anwendbarkeit im Fall der Abbedingung des § 616 BGB
- (3) Unangemessene Benachteiligung nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB
- (a) Bestehen eines Nachteils
- (b) Unangemessenheit
- (aa) Grundsatz der Interessenabwägung
- (bb) Bestimmung der Interessen
- (cc) Vornahme der Interessenabwägung
- (i) Bewertungsmaßstab
- (ii) Kriterien
- (iii) Berücksichtigung einer Kompensation
- (dd) Zwischenergebnis
- bb) Einschränkung des Anwendungsbereichs des § 616 BGB
- (1) Arbeitsverträge
- (a) Vollständige Abbedingung
- (aa) Vorliegen einer Benachteiligung
- (bb) Kein wesentlicher Grundgedanke, auch für nicht gesetzlich versicherte Beschäftigte
- (cc) Interessenabwägung nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB
- (i) Interessen des Arbeitgebers
- (ii) Interessen des Arbeitnehmers
- (iii) Abwägung
- (iv) Zwischenergebnis
- (dd) Kompensation der vollständigen Abbedingung durch Mehrurlaub
- (i) Ermittlung der Gleichwertigkeit bei nicht konkretisierbarem Nachteil
- (ii) Keine Benachteiligung wider Treu und Glauben
- (iii) Zwischenergebnis
- (b) Vollständige Abbedingung bei geringfügiger Beschäftigung
- (aa) AGB-rechtliche Zulässigkeit
- (bb) Exkurs: Benachteiligung nach § 4 Abs. 1 TzBfG
- (cc) Zwischenergebnis
- (c) Abbedingung beim Bestehen subsidiärer Vergütungsfortzahlungsregelungen und -ersatzregelungen
- (aa) Vorliegen einer Benachteiligung
- (bb) Interessenabwägung
- (d) Konkretisierung von Verhinderungsgründen
- (aa) Beiderseitige Interessen
- (bb) Abwägung
- (e) Zwischenergebnis
- (2) Dienstverträge
- (a) Geschäftsführeranstellungsverträge
- (aa) Vorliegen einer Benachteiligung
- (bb) Verstoß gegen den wesentlichen Grundgedanken
- (i) Bestehen eines wesentlichen Grundgedankens
- (ii) Keine Rechtfertigung
- (iii) Zwischenergebnis
- (cc) Unangemessene Benachteiligung im Sinne des § 307 Abs. 1 S. 1 BGB
- (dd) Zwischenergebnis
- (b) Freie Mitarbeiter
- (aa) Vorliegen einer Benachteiligung
- (bb) Kein Verstoß gegen den wesentlichen Grundgedanken
- (i) Bestehen eines wesentlichen Grundgedankens
- (ii) Rechtfertigung
- (cc) Keine unangemessene Benachteiligung im Sinne des § 307 Abs. 1 S. 1 BGB
- (dd) Zwischenergebnis
- (3) Zwischenergebnis
- cc) Bestimmungen hinsichtlich der Dauer der „verhältnismäßig nicht erheblichen Zeit“
- (1) Arbeitsverträge
- (a) Festlegung bestimmter Zeiten als „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“
- (aa) Vorliegen einer Benachteiligung
- (bb) Interessenabwägung
- (cc) Zwischenergebnis
- (b) Orientierung der „verhältnismäßig nicht erheblichen Zeit“ an der bisherigen Beschäftigungsdauer
- (c) Beschränkung der Vergütungsfortzahlung auf eine bestimmte Anzahl an Tagen
- (2) Dienstverträge
- (a) Bestehen eines Nachteils
- (b) Interessenabwägung
- (3) Zwischenergebnis
- dd) Zwischenergebnis zur unangemessenen Benachteiligung
- d) Zwischenergebnis zur Inhaltskontrolle
- E) Ergebnis
- I) Anwendungsbereich des § 616 BGB
- II) Abdingbarkeit des § 616 BGB
- 1) Grundsätze
- 2) Klauselvorschläge
- Literaturverzeichnis
- Back Cover
Abkürzungsverzeichnis
A) Einleitung
§ 616 des BGB war über lange Zeit eine wenig beachtete Norm im Dienstvertragsrecht. Vielfach wird ihre Anwendung in Tarif- und Individualverträgen – mehr oder weniger unreflektiert – eingeschränkt oder ausgeschlossen. Erst mit der COVID-19-Pandemie ist die Norm durch die Frage der Vergütungsfortzahlung während der Quarantäne wieder stärker in das Bewusstsein der Vertragsparteien, des Gesetzgebers, der Behörden und der Rechtsprechung gerückt.1
Das BGB enthält bereits seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1900 § 616 BGB in seiner heutigen Fassung. Zwar änderte sich im Laufe der Zeit der Wortlaut, indem im Jahr 1930 mit einem zweiten Absatz eine Regelung zur Vergütungsfortzahlung für Angestellte bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit ergänzt wurde. Mit dem Inkrafttreten des Entgeltfortzahlungsgesetzes im Jahr 1994 entfiel diese Regelung – mitsamt den zwischenzeitlich erfolgten Präzisierungen und Ergänzungen – jedoch wieder und § 616 BGB fand zu seiner ursprünglichen Fassung zurück. Diese Entwicklung, die Regelung eines Tatbestandes, der grundsätzlich § 616 BGB unterfallen könnte, in eine spezialgesetzliche Regelung zu überführen, ist ein Symbolbild für die Mannigfaltigkeit der Anwendungsfälle, die § 616 BGB unterfallen. So wurden seit Inkrafttreten des § 616 BGB mehrere spezialgesetzliche Regelungen über die Freistellung des Beschäftigten von seiner Leistungsverpflichtung mit (subsidiärer) Fortzahlung oder Ersatz der Vergütung geschaffen. Daher ergibt sich die Frage, welchen Anwendungsbereich § 616 BGB noch hat und wie dessen unbestimmte Rechtsbegriffe – unter Berücksichtigung der sonstigen rechtlichen Entwicklung – auszufüllen sind.
I) Fragestellung
Diese Arbeit untersucht zum einen, welcher Anwendungsbereich § 616 BGB aktuell zukommt, zum anderen, wie die Tatbestandsmerkmale der Norm auszulegen sind sowie insbesondere in welchem Umfang die Dienst- und Arbeitsvertragsparteien die Anwendung des § 616 BGB ausschließen können.
II) Thesen
Zur Erörterung der dargestellten Fragestellung werden die nachfolgenden Thesen aufgestellt, deren Zutreffen im Rahmen dieser Arbeit untersucht wird.
1) Thesen zum Anwendungsbereich und zur Auslegung des § 616 BGB
- Anders als zum Teil vor der Schuldrechtsreform 2002 angenommen wurde, folgt aus § 616 BGB nicht die Freistellung von der Dienstleistungspflicht, sondern allein die Vergütungsfortzahlung. Insofern führt eine Abbedingung des § 616 BGB allein zum Ausschluss des Anspruchs auf Vergütungsfortzahlung und nicht auch zur Beschränkung der Freistellung. Die Freistellung ist im Rahmen des § 275 Abs. 3 BGB ohnehin weitreichend und in Anlehnung an die Maßstäbe des Urlaubsrechts zu gewähren.2
- Der Anwendungsbereich des § 616 BGB wird – insbesondere bei Arbeitnehmern – gegenüber der Rechtslage bei Einführung des BGB durch spezialgesetzliche Normen beschränkt, die Vergütungsfortzahlung in Verhinderungsfällen gewähren. § 616 BGB wird angewandt, wenn ein Konflikt zwischen der Dienstleistungspflicht sowie sozialen oder gesetzlichen Pflichten des Dienstverpflichteten besteht und aus der Nichtbefolgung der sozialen oder gesetzlichen Pflichten objektiv ein erheblicher Nachteil für den Dienstverpflichteten resultieren würde. Hieraus ergibt sich weiterhin ein großer, kaum überblickbarer Anwendungsbereich.3
- Die krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung als der frühere Hauptanwendungsfall für Arbeitnehmer wurde durch § 3 EFZG aus dem Anwendungsbereich des § 616 BGB ausgenommen. Dies bedeutet aber nicht, dass jede krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung § 3 EFZG unterfällt. Zumindest für krankheitsbedingte, untertägige Arbeitsverhinderung – wie die Wahrnehmung von Arztterminen – bleibt § 616 BGB anwendbar.4
- Die Verhältnismäßigkeit der Zeit der Verhinderung ist von der Dauer des bisherigen Bestehens des Dienstvertrages unabhängig. Sie bestimmt sich allein im Verhältnis zur üblichen Verhinderungsdauer bei gleichgelagerten Verhinderungsgründen.5 Dementsprechend stellt auch eine zweiwöchige Quarantäne im Fall des Verdachts der Infektion mit SARS-CoV-2 eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit dar.6
2) Thesen zur Abdingbarkeit des § 616 BGB
- Auf Grund des Zusammenspiels mit besonderen Freistellungs- und Vergütungsfortzahlungs- bzw. Vergütungsersatzregelungen sind bei der Abbedingung im Rahmen von Arbeitsverträgen hohe Anforderungen an die Transparenz zu stellen. Dem Arbeitnehmer ist insbesondere der Grenzbereich zwischen § 3 EFZG und § 616 BGB zu verdeutlichen.7
- Durch sozialrechtliche Regelungen werden der Großteil der wesentlichen Anwendungsfälle des § 616 BGB – zumindest subsidiär8 – abgesichert. Hierdurch verliert § 616 BGB für den Arbeitsvertrag seinen wesentlichen Grundgedanken.9 Gleichwohl ist eine vollständige Abbedingung des § 616 BGB gegenüber einem Arbeitnehmer grundsätzlich nicht möglich.10
- Die vollständige Abbedingung des § 616 BGB stellt gegenüber einem Arbeitnehmer hingegen keine unangemessene Benachteiligung dar, wenn die Abbedingung durch die Gewährung eines vertraglichen Mehrurlaubes kompensiert wird.11
- Während die vollständige Abbedingung des § 616 BGB im Rahmen eines regulären Arbeitsverhältnisses nicht möglich ist, stellt dies im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV keine unangemessene Benachteiligung dar.12 Unwirksam ist jedoch eine Klausel, die zur Abbedingung bloß auf § 616 BGB verweist.13
- Die Abbedingung des § 616 BGB für Verhinderungsfälle, in denen subsidiäre Vergütungsfortzahlungsansprüche und Vergütungsersatzansprüche bestehen, ist weder intransparent,14 noch unangemessen benachteiligend15 und auch im Übrigen nicht unwirksam.16
- Bei Geschäftsführeranstellungsverträgen mangelt es an einer subsidiären Absicherung, sodass § 616 BGB eine gesteigerte Bedeutung zukommt. Mithin ist insbesondere im Bereich der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit eine Abbedingung und eine Beschränkung der Vergütungsfortzahlung auf weniger als sechs Wochen nicht möglich. Im Übrigen ist eine Abbedingung außerhalb des Kernbereichs wie bei Arbeitnehmern möglich.17
- Bei Dienstverträgen mit freien Mitarbeitern, die nicht auf Grund ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit als arbeitnehmerähnlich zu bewerten sind, ist eine vollständige Abbedingung des § 616 BGB – auch für den Krankheitsfall – möglich.18
- Auf Grund der Bestimmung der „verhältnismäßig nicht erheblichen Zeit“ anhand der üblichen Verhinderungsdauer für den konkreten Verhinderungsgrund ist eine Verkürzung der „verhältnismäßig nicht erheblichen Zeit“ durch AGB nicht möglich.19
III) Vorgehen
Zum Zweck der Nachvollziehbarkeit wird zunächst das Vorgehen bei der Bearbeitung dargestellt.
1) Betrachtung des Verhältnisses des § 616 BGB zu § 275 BGB
§ 616 BGB setzt für seine grundsätzliche Anwendbarkeit voraus, dass der Dienstverpflichtete an der Dienstleistung verhindert war. Der Tatbestand ist zumindest dahingehend unbestimmt, wonach sich die Verhinderung richtet. Mangels anderweitiger Regelung wurde früher teilweise vertreten, dass auch der Entfall der Leistungspflicht aus § 616 BGB folgen müsse.20 Dementsprechend wird auch noch nach der Schuldrechtsreform 200221 vertreten, dass § 616 BGB zumindest lex specialis gegenüber § 275 Abs. 3 BGB darstellt.22 Dies würde jedoch bedeuten, dass bei einer Abbedingung des § 616 BGB auch die Möglichkeit zur Leistungsverweigerung bei einer Unzumutbarkeit der Leistungserbringung beschränkt würde. Um die Auswirkungen der Abbedingung des § 616 BGB absehen zu können, ist demensprechend zunächst die Wirkung des § 616 BGB hinsichtlich des Entfalls der Leistungspflicht und das Verhältnis der Norm zu § 275 Abs. 3 BGB zu bestimmen.
Folgt die Dienstverhinderung, die § 616 BGB voraussetzt, aus § 275 BGB, bestimmt § 275 BGB mittelbar auch den Anwendungsbereich des § 616 BGB. Somit bedarf es zunächst einer Betrachtung, in welchen Fällen im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 1 BGB und § 275 Abs. 3 BGB eintritt. Der gesetzliche Regelfall kann jedoch auch durch eine vertragliche Regelung modifiziert werden. Ein Beispiel für eine solche Regelung, die typischerweise in Dienst- und Arbeitsverträgen vereinbart wird, ist die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Dementsprechend ist zu betrachten, wie derartige Vereinbarungen auf die Unmöglichkeit der Leistungspflicht und damit mittelbar auf die Anwendung des § 616 BGB Einfluss nehmen.
Regelt § 616 BGB lediglich die Gegenleistungsgefahr, stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Leistungspflicht entfällt. Zudem ist fraglich, welches Interesse auf Seiten des Leistungsberechtigten in die Abwägung einfließt. Wäre auch das finanzielle Interesse des Dienstberechtigten zu berücksichtigen, ergäben sich bei der Abbedingung des § 616 BGB Wechselwirkungen mit der Reichweite des § 275 Abs. 3 BGB, indem die Interessenabwägung fortan möglicherweise stärker zu Gunsten des Dienstverpflichteten ausfallen würde. Insofern müssen die auf beiden Seiten abzuwägenden Interessen ermittelt und Maßstäbe für die Abwägung erarbeitet werden. Nur hierdurch lässt sich bestimmen, in welchen Fällen § 616 BGB eingreift.
Des Weiteren ist zu verdeutlichen, wie § 616 BGB innerhalb der Systematik des Allgemeinen Schuldrechts des BGB wirkt. Denn hieraus werden zum Teil vermeintlich allgemeingültige Aussagen abgeleitet, die den Anwendungsbereich des § 616 BGB beschränken sollen. Ein Beispiel ist die Folgerung, dass es sich um eine Ausnahmevorschrift handele, die dementsprechend restriktiv anzuwenden sei.
2) Anwendungsbereich und Auslegung des § 616 BGB
Damit eine historische Argumentation bei der Auslegung des § 616 BGB möglich ist, wird die Entwicklung der Norm anhand der Motive, die zur Schaffung der Norm geführt haben, betrachtet. Diese Betrachtung lässt Rückschlüsse darauf zu, ob die Berücksichtigung wirtschaftlicher Erwägungen mit dem Grundgedanken der Norm vereinbar ist oder stattdessen eine soziale Komponente im Fokus steht. Diese Erwägung ist vor allem bei der Auslegung der „Verhältnismäßigkeit“ bei der Dauer der Verhinderung zu berücksichtigen. Auch könnte sich aus dem Bestehen einer „arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht“ eine besondere Rücksichtnahmepflicht hinsichtlich der Abbedingung der Norm ergeben, sodass es einer kritischen Auseinandersetzung mit dieser Theorie bedarf. Zudem stellt sich die Frage, ob § 616 BGB an eine Nebenleistungspflicht – ggf. aus § 241 Abs. 2 BGB – anknüpft oder selbst eine Hauptleistungspflicht begründet bzw. begründen sollte. In letztem Fall wäre die Abbedingung des § 616 BGB als Preisbestandteil einer AGB-Kontrolle entzogen. Hingegen könnte die Intensität einer Nebenpflicht mit Blick auf eine unangemessene Benachteiligung Einfluss auf die Abdingbarkeit haben. Daher ist relevant, ob sich aus § 616 BGB eine konkretisierte Nebenpflicht ergibt.
Im Hinblick auf die Abdingbarkeit muss der Anwendungsbereich des § 616 BGB betrachtet werden. Denn oftmals wird in Verträgen – in Anlehnung an Tarifverträge – § 616 BGB nicht vollständig abbedungen, sondern es werden lediglich die Anwendungsfälle und die Verhinderungsdauer beschränkt. Um den Umfang der Abbedingung solcher sowie § 616 BGB vollständig abbedingender Klauseln bestimmen zu können, muss die Wirkung des § 616 BGB festgelegt werden. Da der Anwendungsbereich zum Teil noch strittig ist, wird damit auch ein Beitrag zur allgemeinen Literatur zu § 616 BGB geschaffen.
Einen maßgeblichen Einfluss auf den heutigen Anwendungsbereich des § 616 BGB hat das Verhältnis der Norm zu spezialgesetzlichen Regelungen zur Arbeitsverhinderung mit Vergütungsfortzahlung. Im Bereich des persönlichen Leistungshindernisses hatte die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit traditionell große Relevanz. Diese wurde durch die Einführung des EFZG abgemildert. Allerdings bleibt unklar, ob es noch Fälle der krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung gibt, die weiterhin § 616 BGB unterfallen. Dabei ist insbesondere an krankheitsbedingte, untertägige Arztbesuche zu denken. Unterfallen diese nicht dem EFZG, würde die Vergütungsfortzahlung in diesen Fällen durch die Abbedingung des § 616 BGB ebenfalls ausgeschlossen. Dies könnte insbesondere mit Blick auf das Transparenzgebot sowie auf das Verbot unangemessener Benachteiligung problematisch sein. Um diese Fälle aber entweder dem EFZG oder § 616 BGB zuordnen zu können, muss herausgearbeitet werden, was eine „Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit“ ist und ob eine Teilarbeitsunfähigkeit, die bei untertägigen Verhinderungen eintritt, anzuerkennen ist. Aus den Regelungen zur Entgeltfortzahlung im Laufe der Zeit ist auch zu erkennen, was für den Gesetzgeber eine angemessene Dauer der Entgeltfortzahlung darstellt und inwieweit der Schutz der wirtschaftlichen Interessen des Dienstberechtigten zu berücksichtigen ist. Deshalb bietet es sich an dieser Stelle an, die historische Entwicklung der Entgeltfortzahlung darzustellen.
§ 3 EFZG und § 616 BGB treten zudem an mehreren Stellen in Konflikt zueinander. Ein Beispiel ist die Wartezeit nach § 3 Abs. 3 EFZG, innerhalb der § 616 BGB ersatzweise Anwendung finden könnte. Insofern stellt sich die Frage, ob § 3 EFZG eine Sperrwirkung entwickelt.
§ 44a Abs. 3 SGB XI i.V.m. § 2 PflegeZG enthält bereits im sachlichen Anwendungsbereich die interessante Fragestellung, inwieweit sich der Anwendungsbereich mit § 616 BGB überschneidet. Des Weiteren ist fraglich, ob § 2 PflegeZG mehrmals anzuwenden ist. Davon ist abhängig, in welchem Verhältnis sie zu § 275 Abs. 3 BGB und § 616 BGB steht.
Ähnliches gilt für § 45 SGB V, der eine Freistellung und die Zahlung von Krankengeld bei Krankheit des eigenen Kindes vorsieht. Auch diese Norm könnte als Auslegungshilfe für § 275 Abs. 3 BGB und § 616 BGB herangezogen werden, was das BAG früher auch bereits in Erwägung gezogen hat.23 Um das Verhältnis zu den beiden Normen im BGB zu klären, bedarf es einer Betrachtung der Tatbestandsvoraussetzungen. Dies ist insbesondere auf Grund der kurzen Dauer der Freistellung relevant, sodass § 275 Abs. 3 BGB für länger andauernde Krankheiten des Kindes ausgeschlossen, jedenfalls aber der Anspruch aus § 616 BGB auf diesen Zeitraum beschränkt sein könnte.
Ein wesentlicher ungeklärter Aspekt bei der Anwendung des § 616 BGB ist, wie das Tatbestandsmerkmal „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ auszulegen ist. Dabei ist insbesondere unklar, zu welcher Bezugsgröße die Verhinderungsdauer „verhältnismäßig“ sein muss. Eine Vielzahl von (Tarif-)Verträgen legt maximale Fortzahlungsdauern für bestimmte Verhinderungen fest. Fraglich ist, ob dies ein Abweichen vom gesetzlichen Leitbild darstellt. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn sich die Verhältnismäßigkeit an der Dauer des Bestehens des Dienstvertrages orientierte. Ein Indiz hierfür kann die Ausgestaltung in den zuvor genannten spezialgesetzlichen Regelungen – § 3 EFZG, § 2 PflegeZG und § 45 SGB V – sein. Hieran schließt sich auch die Handhabung von Wiederholungsfällen der Verhinderung an. Insofern könnten in Anlehnung an § 3 EFZG beschränkende Regelungen in Erwägung gezogen werden. Auch bei diesen stellt sich die Frage, ob sie eine Abweichung vom gesetzlichen Leitbild darstellten.
§ 616 BGB hat durch die COVID-19-Pandemie an allgemeiner Relevanz gewonnen. Insofern bietet es sich an, vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit erarbeiteten Ergebnisse zum Anwendungsbereich des § 616 BGB dessen Anwendung im Rahmen der COVID-19-Pandemie zu reflektieren. Von besonderer Relevanz ist dabei die Frage, ob die – regelmäßig vierzehntägige – Quarantäne noch eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit darstellt. Da der Staat subsidiär für den Vergütungsausfall eintritt, stellt die Abbedingung des § 616 BGB im Fall einer durch COVID-19 bedingten Quarantäne ein optimales Beispiel für die Frage dar, ob die Abbedingung einen Vertrag zu Lasten Dritter darstellt.
Details
- Pages
- 484
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631932636
- ISBN (ePUB)
- 9783631932643
- ISBN (Softcover)
- 9783631932452
- DOI
- 10.3726/b22637
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (May)
- Keywords
- Arbeitsrecht Anstellungsvertrag Freie Mitarbeit Geschäftsführer AGB-Kontrolle Lohn ohne Arbeit geringfügige Beschäftigung Dienstvertragsgestaltung Arbeitsvertragsgestaltung
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 484 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG