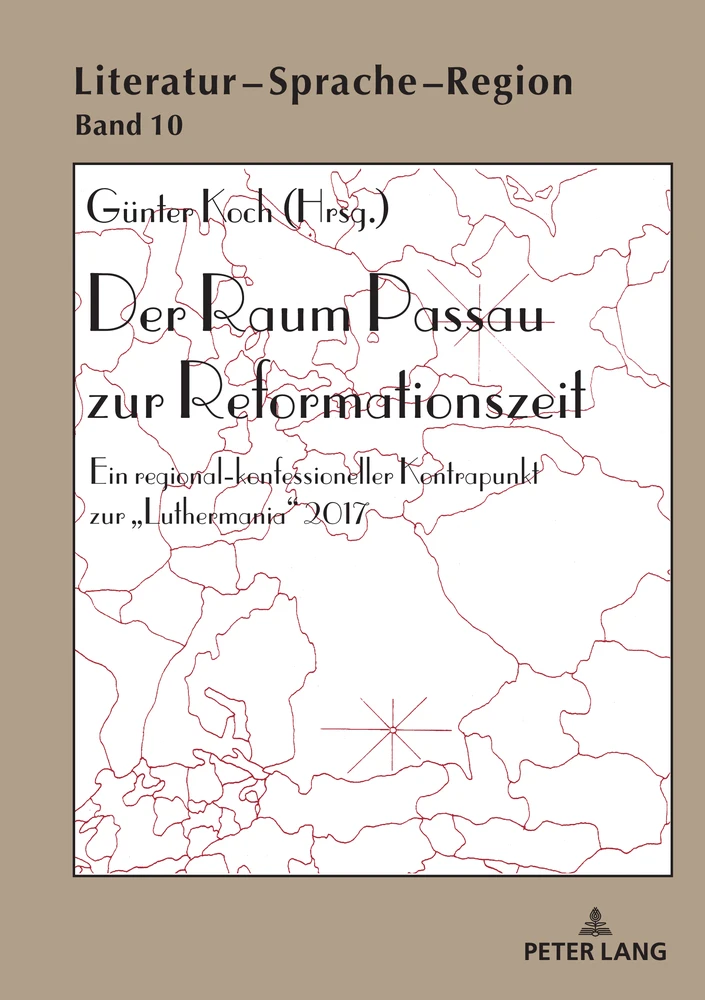Der Raum Passau zur Reformationszeit
Ein regional-konfessioneller Kontrapunkt zur «Luthermania» 2017
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Zum Geleit
- Der „Madonnenstreit“ als Erbe der Jesuiten in Passau
- Der Ausbund – das christliche Gesangbuch der Wiedertäufer von der Veste Oberhaus
- „Luthermania“ und die Werbung
- Leonhard Kaiser, Passau und die Reformationszeit: Das Jahr 1527 aus der Sicht eines Jugendbuches von 2005
- Rechtgläubigkeit oder Ruhe und Ordnung? Zu den Maximen fürstbischöflicher Herrschaft im Passau der späten Reformationszeit
- Astrologie und Reformation. Die Debatte über die Sintflutprognose auf 1524 in Bayern und Österreich
- Passauer Vertrag und Augsburger Religionsfriede. Perspektiven auf das Verhältnis von Kirche und Staat
- Die Finanzen Papst Leos X. und die Ablassurkunden
- Sophonias Paminger – Schulmeister und Poet auf Wanderschaft
- Leonhard Paminger – ein lutherischer Komponist? Spurensuche in Leben und Werk des Passauer Musikers und Pädagogen
- Leonhard Paminger – 1567 – 50 Jahre Reformation. Ein theologisches Testament als Summa der Abendmahlslehre
- Georg Rörer, Martin Luthers niederbayerischer Obercorrector und sein möglicher Einfluss auf die Sprachgestalt der Wittenberger Bibeldrucke
- Lehensbriefe zur Zeit der Reformation – Textsorte und Graphematik im süddeutschen Sprachraum
- Schmähende konfessionelle Fremdbezeichnungen. Remotivation und Bedeutungsgenerierung
- Luther als kritischer Sprachschöpfer
- Graf Joachim von Ortenburg – Kirchengeschichtliches Lernen im regionalen Kontext
- Bildersturm in Ortenburg? Kirchenräume, Kunst und Konfessionen in einer ehemaligen Reichsgrafschaft
Vorwort
Dieser Sammelband ist im Kontext der Feierlichkeiten zum ‚Reformationsjahr‘ 2017 zu verorten, in dem sich der Thesenanschlag Luthers an der Tür der Wittenberger Schlosskirche zum 500.Mal jährte. Die Idee zu einer Tagung entstand am Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft (Prof.Dr.Rüdiger Harnisch), unter Mitwirkung von IKON (Institut für Kulturraumforschung Ostbaierns und der Nachbarregionen, Universität Passau) und dem Verein für Ostbairische Heimatforschung (Passau). Das mit dem Titel dieses Bandes gleichnamige Symposium fand vom 17.–18. November 2017 statt, in Verbindung von Universität Passau und Stadt Passau, denn die Vorträge fanden auf der Veste Oberhaus statt, in Kooperation mit dem Oberhausmuseum (Dr. Stefanie Buchhold). In diesem historischen Ambiente wurde Geschichte geradezu greifbar, eine Museumsführung (Adolf Hofstetter, M.A.) rundete diesen Rahmen ab. Für die Ausstattung des Vortragsraumes mit Reproduktionen historischer Dokumente sorgte die Lehrstuhlmitarbeiterin Christina Böhmländer, sie organisierte zudem das Catering und die musikalische Abendgestaltung mit der Folkband Sechs-Achtel unter Leitung von Prof.Dr.Tomas Sauer, die auf historischen Instrumenten Lieder aus verschiedenen Epochen darbieten konnte. Zudem organisierten Dr.Irmhild Heckmann, Prof.Dr.Egon Johannes Greipl und Dr.Markus Eberhardt eine ökumenische Abendandacht in der Kirche St.Nikola: Für den von Pfarrerin Sonja Sibbor-Heißmann gehaltenen Gottesdienst konnte die Gesangsgruppe STIMMWERCK gewonnen werden, die Lieder von Leonhard Paminger authentisch aufführte – damit wurde auch der Musiker geehrt, dessen Todestag sich 2017 zum 450. Mal jährte.
Finanziell und organisatorisch möglich wurde diese Tagung mithilfe der Unterstützung der Bayerischen Volksstiftung, der Sparkasse Passau, der Stiftung der Passauer Neuen Presse – Dr.Hans Kapfinger-Stiftung, der Stadt Passau, dem Dekanat der Philosophischen Fakultät der Universität Passau, dem Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V., der Evangelischen Studierendengemeinde Passau sowie der Katholischen Studentengemeinde Passau.
Dank gilt allen Vortragenden, die sich aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven in dieses Symposium eingebracht haben, insbesondere den beiden Gastrednern David J.Burn (University of Leuven) und Grantley McDonald (Universität Wien) mit ihren Beiträgen aus dem Paminger-Projekt. Die meisten Vorträge konnten für diesen Sammelband ausgearbeitet werden.
Es haben viele weitere Personen mitgewirkt: Für die Organisation von Seite des Lehrstuhls ergeht Dank an Ramona Krompaß (†) und Diana Roth, von Seite des Oberhausmuseums an Eva Sattlegger, M.A. und Eva Zwirner. Für die Ankündigung und Presseberichterstattung in der Passauer Neuen Presse sei Dr. Edith Rabenstein gedankt.
Der Druck dieses Bandes wurde finanziell von der Dr.Hans-Karl Fischer Stiftung gefördert. Für die Aufnahme in die Reihe Literatur – Sprache – Region sei den Reihenmitherausgebern gedankt, und nicht zuletzt Michael Rücker für seine unermüdliche Betreuung der Drucklegung vonseiten des Peter Lang- Verlags.
Passau, im Sommer 2023 Der Herausgeber
Günter Koch
Zum Geleit
1. ‚Luthermania‘ und ‚Kontrapunkt‘
Zugegeben: Die Wahl des Untertitels für die Tagung und gleichermaßen für die daraus hervorgegangene, nun vorliegende Sammelschrift lässt auf den ersten Blick Aversionen gegen die Person Martin Luther vermuten, ist doch von einem „Kontrapunkt“ die Rede (dazu später), aber v.a. wirkt doch das Suffix {-mania} pejorativ, indem es dem Lexem, dem es angeheftet ist, eine Bedeutung zuweist, die eine übertriebene, in hohem Maße überzeichnete Wertschätzung und damit zugleich auch einen ungebührlichen Aktionismus unterstellt.
Tatsächlich war Martin Luther die zentrale Person, an der 2017 – zur 500-jährigen Feier des Thesenanschlags von 1517 – der Kulturbetrieb des ganzen Landes maßgeblich ausgerichtet war: Eine gewisse Omnipräsenz war vorhanden, die nicht nur religiösen und kulturbeflissenen Bürgerinnen und Bürgern bewusst wurde, denn die Streuung auf Alltagsgegenstände trug wesentlich dazu bei, dass allen die Reformation als eines der bedeutsamsten Ereignisse der Geschichte erkennbar wurde – eine Sonderbriefmarke der Deutschen Post bewegt sich dabei im Rahmen des durchaus Üblichen, aber die Herausgabe einer exklusiven, ikonischen Spielfigur aus dem Hause Playmobil®, nur um das wohl bekannteste Beispiel eines ‚Merchandising-Artikels‘ aus dem Luther-Jahr zu nennen, lässt doch aufhorchen.1 Also doch Übertreibung, ein nicht gerechtfertigter ‚Hype‘ um ein Ereignis, den Thesenanschlag, dem fachwissenschaftlich sogar die gemeinhin zugedachte Relevanz für die Reformation abgesprochen werden kann? Keineswegs. Der Thesenanschlag ist nämlich in erster Linie symbolisch zu verstehen.2 Außerdem war vor 500 Jahren das alltägliche Leben religiös bestimmt, ein Umbruch wirkte daher unmittelbar und massiv auf die Lebensverhältnisse aller Menschen ein – durch die kulturelle Durchdringung der Gesellschaft 500 Jahre später wird erfahrbar, welche Bedeutung der Reformation und damit auch der Person Martin Luther, „dessen Name bis heute synonym ist mit der Reformation“3, zukommt, auch wenn sich im 21.Jahrhundert immer mehr Menschen dem Glauben entfremden. Wenn hier von ‚Luthermania‘ die Rede ist, soll also mitnichten am Sockel Luthers gerüttelt werden.
Nachdenklich dagegen stimmen damit einhergehende Mystifizierungen, wie sie im Ausstellungskatalog LUTHERMANIA. Ansichten einer Kultfigur4 dargestellt werden: Die Abschnitte Luther, der Heilige/Luther, der Teufel/Luther, die Marke und Luther, der Deutsche zeigen einseitige Perspektivierungen auf, die bei oberflächlicher Betrachtung zu Stereotypisierungen führen. So kann eine Kommerzialisierung mit verschiedenen ‚Merchandising‘-Artikeln Aversionen schüren, indem der Kirche, argumentativ ausgehend von der zu entrichtenden Kirchensteuer, schlichtweg rein wirtschaftliche Motive unterstellt werden. Damit einhergehend würde dann alles, was auch nur ansatzweise mit dem ‚Luther-Jubiläum‘ in Zusammenhang gebracht werden könnte, einer ‚Luthermania‘ zugeschrieben, die dann als eindeutig negativ zu werten ist.
Sich gegen diese Art einer ‚Luthermania‘ zu wenden, gegen eine einschichtige, oberflächliche Sichtweise, durch die historische Persönlichkeit und mediale Figur in Schieflage geraten und ein eminent wichtiges historisches Ereignis verunklart wird, ist eine Intention dieses Bandes, eine andere ist, einen kleinen Beitrag zur Dezentralisierung der Forschung zu leisten, die sich, von der Euphorie des Jubiläums getragen, intensiv Martin Luther widmete – deshalb also auch ein „Kontrapunkt“. Dabei ist es durchaus nicht so, dass im ‚Reformationsjahr 2017‘ der gesamte Kulturbetrieb ausschließlich auf Martin Luther ausgerichtet gewesen wäre und damit einer ausgesprochenen ‚Luthermania‘, sei es in positiver oder negativer Lesart, Vorschub geleistet worden wäre – über das ganze Land waren Veranstaltungen gestreut, die zwar die Reformation thematisierten, aber eben nicht nur Luther zum Inhalt hatten, sondern Regionalgeschichte mit lokalen historischen Persönlichkeiten ins Gedächtnis riefen. Daran knüpfte die Passauer Tagung an, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass auch im katholischen Süden, selbst in Passau mit seinem die Altstadt dominierenden Dom, die Reformation bedeutsam war und mit Namen zu verbinden ist, die meist nur aus Straßenbenennungen, wie etwa die Leonhard Paminger-Straße, bekannt sind, aber sonst keine Assoziationen bewirken.
Veranstaltet wurde die Tagung von der Universität Passau sowie von der Stadt Passau, und das machte sich auch durch die Wahl zweier Örtlichkeiten bemerkbar: Der wissenschaftliche Teil des Symposiums fand auf der Veste Oberhaus statt, der Stätte, an der eine Gruppe von Wiedertäufern inhaftiert wurde und den Ausbund verfasste, ein Gesangbuch, das v.a. in den Amish-Gemeinden (USA) bis zum heutigen Tage tradiert wird. Im historischen Bereich der Universität, nämlich in der Kirche St.Nikola, fand ein Abendgottesdienst mit A-capella-Gesängen statt: Von der Gruppe Stimmwerck wurden Lieder des Komponisten Leonhard Paminger vorgetragen5 – im Rahmen der Tagung war dies ein ‚musikalischer Kontrapunkt‘ zur wissenschaftlichen ‚Sprechveranstaltung‘. Leonhard Paminger war aber nicht nur Tonkünstler, zu dessen musikalischem Wirken die beiden Gastredner David Burn und Grantley McDonald Vorträge hielten,6 sondern auch Rektor der Klosterschule St.Nikola – ein Schulrektor also an einer Bildungseinrichtung, in deren Gemäuern später die Passauer Universität angesiedelt wurde – aber das geschah erst bei der Neugründung 1978; eine 400-jährige Tradition dagegen geht bereits auf das Jesuitenkolleg in der Passauer Altstadt zurück. Ein emblematisches Zeichen aus dieser Zeit, die Maria vom Siege, sollte dann, als Universitätssiegel gewählt, für große Kontroversen sorgen.
2. Überblick zu den Beiträgen
Die Beiträge des Tagungsbandes widmen sich zunächst diesen Themen, die Stadt und Universität Passau unmittelbar betreffen: Zunächst skizziert Mario Puhane (Archivar der Universität Passau) den sog. ‚Madonnenstreit‘. Auf das Schicksal der inhaftierten Wiedertäufer von der Veste Oberhaus und deren Gesangbuch Ausbund gehen André Rottgeri und Tomas Sauer näher ein. Luther als Marke wird sodann im sprachwissenschaftlichen Beitrag von Sandra Reimann aufgegriffen, indem sie die Werbekommunikation der Evangelischen Kirche Deutschland im Luther-Jahr analysiert.
Im Anschluss steht ein literaturwissenschaftlicher Beitrag von Hans Krah, er nimmt die Fiktion des historisch angelegten Jugendbuches Das Kloster der Ketzer (2008) von Rainer M. Schröder unter die Lupe, das im Passau des beginnenden 16.Jahrhunderts und dessen Umland spielt. Dabei geht es auch um die Verbrennung des Märtyrers Leonhard Kaiser in Schärding am Inn im Jahr 1527.
Die nächsten Aufsätze werden von Geschichtswissenschaftlern beigetragen: Zunächst zeigt Marc von Knorring, wie konfessionelle Verstöße in der Stadt Passau um die Mitte des 16. Jahrhunderts geahndet wurden und wie sich dabei das Verhältnis von Strafmaß und Nachsicht gestaltete. Eine regionale Ausweitung in den süddeutschen Raum nimmt Martin Hille vor, indem er Sintflutprognosen zu Beginn des 16.Jahrhunderts analysiert, nach Ursachen forscht, den Diskurs im religiös-politischen Kontext verortet und die Flugschriften als Medienereignis erfasst. Winfried Becker widmet seine Ausführungen dem Passauer Vertrag von 1552 und dem Augsburger Religionsfrieden von 1555; dabei geht es ihm v.a. um die komplexe Aushandlung der Grundrechte religiöser Zugehörigkeit und Meinungsfreiheit im Dualismus zwischen Staat und Kirche. Bezüge der Ereignisse der Reformationszeit zur jüngeren Geschichte und der Gegenwart lassen erkennen, dass das Zusammenleben religiöser Kulturen im deutschen Staat als eine Erfolgsgeschichte geschrieben werden könne.
Thomas Frenz bietet mit seinem Beitrag aus dem Bereich der Historischen Hilfswissenschaften einen Beitrag zur Urkundenforschung, indem er den Zusammenhang des Ablasshandels der Reformationszeit mit der Finanzpolitik der Medici verdeutlicht und aufzeigt, dass der finanzielle Zugewinn durch den Ablasshandel überbewertet werde. Im Anhang seines Beitrags findet sich die Edition einer Ablass-Urkunde des Klosters Vornbach aus der näheren Umgebung Passaus (Gemeinde Neuhaus am Inn) aus dem Jahr 1484.
Die nächsten drei Beiträge widmen sich der Paminger-Familie. Zunächst beleuchtet Fritz Wagner das ‚Wanderleben‘ von Sophonias Paminger, einem Sohn des eingangs genannten Musikers und Schulrektors Leonhard Paminger. Dieser detailreiche Beitrag zur Biographie desjenigen Paminger- Sprosses, der maßgeblich für die Edition der musikalischen Schriften seines Vaters verantwortlich zeichnet, zeigt eindrucksvoll, wie unstet das Leben in der Frühen Neuzeit sein konnte und welch immenser Aufwand für notwendige Wohnortswechsel in Kauf genommen wurde. Der Aufsatz von Markus Eberhardt stellt zum einen die Biographie Leonhard Pamingers dar, zum anderen werden die konfessionellen Anschauungen dieser wichtigen Persönlichkeit herausgearbeitet. Dabei wird unter anderem auch die Widmung erörtert, die Martin Luther für Leonhard Paminger verfasste und die auch auf einer Gedenktafel im Eingangsbereich der Kirche St.Nikola zu lesen ist. Dass Leonhard Paminger nicht nur musikalische Werke verfasste, sondern sich auch zu Kernfragen der Reformation äußerte, legt Walter Schmitz mit einer Interpretation der Schrift Von den Corruptelen aus dem Jahr 1567 vor: Dabei geht es um das Verständnis der Kelchkommunion und der Wesenswandlung während der Kommunion; die Ansichten Pamingers werden u.a. mit den Meinungen von Ökolampad, Zwingli und Calvin in Verbindung gesetzt.
Die nächsten Beiträge sind dem Bereich der Deutschen Sprachwissenschaft zuzuordnen. Zunächst geht Hans-Werner Eroms auf die Person Georg Rörer ein, der eine zentrale Funktion, nämlich die des Correctors der Bibel Martin Luthers, ausübte und dabei diese Schrift wesentlich mitgestaltete. Damit leistete auch er letztlich einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung der neuhochdeutschen Schriftsprache. Auch der berühmte Thesenanschlag von 1517 wird in diesem Zusammenhang erörtert. Manuela Krieger und Christina Böhmländer zeigen anhand von Lehensbriefen der Passauer Fürstbischöfe aus dem Schärdinger Stadtarchiv, wie graphematische Variation in der Frühen Neuzeit bewertet werden muss, wenn die von der Textsorte vorgegebenen Bedingungen erfüllt werden müssen. Dabei wird zunächst der formale Aufbau der Lehensbriefe analysiert, um dann konsistente oder auch abweichende graphische Darstellungen auf den Formalisierungsgrad der jeweiligen Textabschnitte rückzubinden. Um Schimpfwörter geht es im Aufsatz von Rüdiger Harnisch: Zur Kultur der Auseinandersetzung im Reformationszeitalter zählte die ‚schmähende Fremdbezeichnung‘. Dass es sich dabei nicht einfach nur um herkömmliche Beleidigungen handelte, sondern häufig um Sprachspiele, die zum einen lautliche Bedingungen, zum anderen aber auch semantische Beziehbarkeiten voraussetzen, können durch die Theorie einer Remotivierung aufgedeckt werden. Diese Theorie der Remotivierung greift auch Günter Koch auf, wenn Martin Luthers Sendbrief vom Dolmetschen nach Strategien des Übersetzens durchgesehen wird. Hier wird eine ähnliche Polemik ersichtlich wie bei den ‚schmähenden Fremdbezeichnungen‘. Zudem wird nach der Rolle Luthers als ‚Sprachschöpfer‘ gefragt, dabei die konzeptionelle Mündlichkeit thematisiert und für eine objektivierende Sichtweise plädiert.
Die letzten beiden Beiträge beziehen sich auf die Grafschaft Ortenburg, die im katholischen Süden eine protestantische Enklave darstellt, und gerade deshalb von Rudolf Sitzberger unter religionspädagogischen Gesichtspunkten als ein ‚Glücksfall‘ für kirchengeschichtliches Lernen im schulischen Kontext erachtet wird. Neben Ort und Persönlichkeiten werden historische Ereignisse skizziert, die durch ihre regionale Eingebundenheit ermöglichen, im Unterricht geschichtliche Prozesse von europäischem Ausmaß unmittelbar erfahrbar zu machen. Der letzte Beitrag dieses Bandes widmet sich der Architekturgeschichte der Grafschaft Ortenburg: Irmhild Heckmann zeichnet die Geschichte der kirchlichen Baudenkmäler des Marktes Ortenburg wie auch der Umgebung nach, deckt bauliche Bezüge zu anderen Denkmälern (z.B. Schlosskapelle Torgau) auf und problematisiert den Umgang mit Dekoration und Inventar der Kirchenräume. Historische Bauten können durch Aquarelle von Graf Friedrich Casimir von Ortenburg belegt werden.
3. Geschichte interdisziplinär – Geschichte neu schreiben
Geschichte hat sich nicht einfach irgendwann zugetragen und wird dann in einer Rückschau einmalig und endgültig be- und geschrieben, sie wird vielmehr stetig neu geschrieben, zwangsläufig aus der Zeit der Verfasser heraus, sodass eine Deutungsvielfalt auch zu dem hier zentral gesetzten Ereignis, der Reformation, unumgänglich ist – „[j]ede Gegenwart könnte sich eine neue Geschichte schreiben“7. Und unter dieser Perspektive lässt sich der Schulterschluss zu anderen Disziplinen finden, wie etwa der Sprachwissenschaft. Denn: Genauso wenig, wie es die deutsche Sprache gibt, so wenig gibt es die Reformation. Andere Disziplinen können sich dieser Sichtweise anschließen, indem kulturelle wie auch fachwissenschaftlich gesetzte ‚Mythen‘ hinterfragt und aufgebrochen werden.
Es stellt sich nicht zuletzt auch die Frage, wie sich Wissen substanziiert. Sprache ist primärer Träger von Informationen, aber mit der Sprache selbst verändern sich auch die Informationen, die durch sie transportiert werden. Das heißt, dass sprachwissenschaftliche Einsichten für historische Betrachtungen an sich unentbehrlich sind – umgekehrt aber gilt das genauso, Sprachgeschichte ohne Kulturgeschichte ist schlichtweg undenkbar. Was in der Diskurslinguistik als ‚linguistic turn‘ bezeichnet wird,8 also die Integration von Sprachwissenschaft in Sozialwissenschaften, ist deshalb nicht einseitig zu sehen, vielmehr ist der akademischen Fächerdifferenzierung durch interdisziplinäres Zusammenarbeiten entgegenzuwirken. Einen wertvollen Beitrag können lokale Geschichtsvereine leisten, da hier Kompetenzen aus unterschiedlichsten Richtungen gebündelt werden können. Im Grunde wäre das ein ‚Kontrapunkt‘ zum wörtlich genommenen ‚universalen‘ Anspruch der Universitäten, doch sollen keine Gegensätze konstruiert werden, sondern vielmehr gesellschaftliche Themen mit unterschiedlichen ‚Stimmen‘ aufgenommen werden – so gelangt man, wie bei der harmonischen Hinzufügung einer Melodie zu einer anderen, immer wieder zu neuen ‚Geschichtskompositionen‘.
1 Abbildung in Peter Burschel: Instamatic History. Statt eines Grußwortes. In: Hole Rößler (Hg.): LUTHERMANIA. Ansichten einer Kultfigur. Katalog zur Ausstellung der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel im Rahmen des Forschungsverbunds Marbach Weimar Wolfenbüttel vom 15. Januar bis zum 17. April 2017. Wiesbaden: Harrassowitz 2017 (= Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek; 99). S. 11–12, hier S. 11, Abb. 1. Vgl. hierzu auch im selben Ausstellungskatalog den Beitrag von Hole Rößler: Luther, die Marke, S. 250–256, mit Abb. 133 auf S. 250, sowie den Beitrag von Sandra Reimann im vorliegenden Band.
2 Vgl. hierzu den Beitrag von Hans-Werner Eroms in diesem Band.
3 Sonja Asal: Grußwort. In: Rößler (Hg.), LUTHERMANIA (wie Anm. 1), S. 9–10, hier S. 10.
4 Rößler, LUTHERMANIA (wie Anm. 1).
5 Höre hierzu die Audio-CD: Leonhard Paminger (1495–1567). Geistliche Vokalwerke. (CHRISTOPHORUS, Deutschland 2010). Franz Vitzthum (Countertenor), Klaus Wenk (Tenor), Marcus Schmidl (Bass), als Gast: David Erler (Countertenor).
6 Publikationen von David J.Burn und Grantley McDonald, die in Zusammenhang mit einem musikwissenschaftlichen Projekt zu Leonhard Paminger an der Universität Leuven erschienen, sind in diesem Band im Beitrag von Markus Eberhardt, Anm. 14, verzeichnet.
7 Luise Schron-Schütte: Die Reformation. Vorgeschichte, Verlauf, Wirkung. 6., überarbeitete Aufl., München: Beck 2016, hier S. 7.
8 Jürgen Spitzmüller/Ingo H.Warnke: Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin, Boston: de Gruyter 2011, hier S. 79.
Mario H. Puhane
Der „Madonnenstreit“ als Erbe der Jesuiten in Passau
1. Vorbemerkung
Betrachtet man das Thema des Bandes, machen wir jetzt einen historischen Spagat vom 16. ins 20.Jahrhundert. Allseits bekannt ist, dass die heutige Universität Passau ihre Bildungstradition auf die Jesuitenhochschule des 17.Jahrhunderts zurückprojiziert.1 Die Jesuiten selbst müssen hier im engeren Sinne als Kampforden der katholischen Gegenreformation thematisiert werden. Und damit sind wir beim Kern des Themas, nämlich der symbolischen Darstellung der Passauer Jesuiten, bei der sogenannten „Madonna vom Siege“ und damit beim Streit um die Bedeutung dieser Darstellung für die moderne Universität, der als sogenannter „Madonnenstreit“ in die Universitätsgeschichte eingegangen ist.2
Diese sehr emotionale, auf beiden Seiten – neutral gesprochen – mit harten Bandagen geführte akademische Auseinandersetzung ist für Außenstehende nicht immer nachvollziehbar oder erkennbar. Professor Gordon Smith von der London School of Economics stellte auf einem Passauer Symposion pointiert die Frage an Professor Dr. Alf Mintzel: „Alf, Passau is a beautiful city. But what is under the surface?“3
Um die Fakten dieses Disputes darstellen zu können, werden hier die Dokumente und greifbaren Quellen aus dem Universitätsarchiv angeführt. Dabei kommen beide Parteien mit Zitaten zu Wort. Gegebenenfalls kann auch die eine oder andere bisher neue Quelle oder Sichtweise aufgeführt werden. Das Thema wird aus der Sicht des Archivars mit historischer Ausbildung, nicht als Kunsthistoriker, Soziologe oder Theologe beleuchtet, wobei natürlich der Hauptakteur Professor Dr. Alf Mintzel und seine Ausführungen als Quelle des „Madonnenstreits“ zentral angeführt werden.
Das Thema ist „facettenreich und mehrdimensional“, es gibt Innen- und Außenansichten, es spielt sich in den „Spannungsfeldern zwischen Wissenschaft, Politik und Religion“ ab, hat eine „historische Dimension“, ist aber mehr als nur eine, wenn auch herausragende, „universitätsgeschichtliche Episode“:4 Ein derartiger Logostreit ist auch nicht alleine ein Passauer Phänomen, es gibt auch andere Beispiele, wie etwa in Augsburg.
Im Rahmen dieser Ausführungen soll erläutert werden, wie aus dem Symbol der Jesuiten in Passau zuerst ein Emblem der Philosophisch-Theologischen Hochschule und schließlich das Siegel und zeitweise das Logo der modernen Universität in Passau wurde. Aber diese doppelte Funktion bestand nur gut zehn Jahre lang, denn durch den akademischen „Madonnenstreit“ in Passau kam es zur Trennung zwischen Siegel und Logo, denn seit 2003 präsentiert sich die Passauer Hochschule vollends mit dem aktuellen, modernen Logo.
Details
- Pages
- 438
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631912959
- ISBN (ePUB)
- 9783631912966
- ISBN (Hardcover)
- 9783631912942
- DOI
- 10.3726/b21461
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (July)
- Keywords
- Reformation Luther Paminger Rörer Transsubstantiation Universitätssiegel Theologie regionalgeschichtliche Perspektiven auf die Reformationszeit Geschichtswissenschaft Literaturwissenschaft Sprachwissenschaft Musikgeschichte Bibelübersetzung Werbesprache Sprachwandel Papst Leo X. Passau Ortenburg
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 438 S., 11 farb. Abb., 66 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG