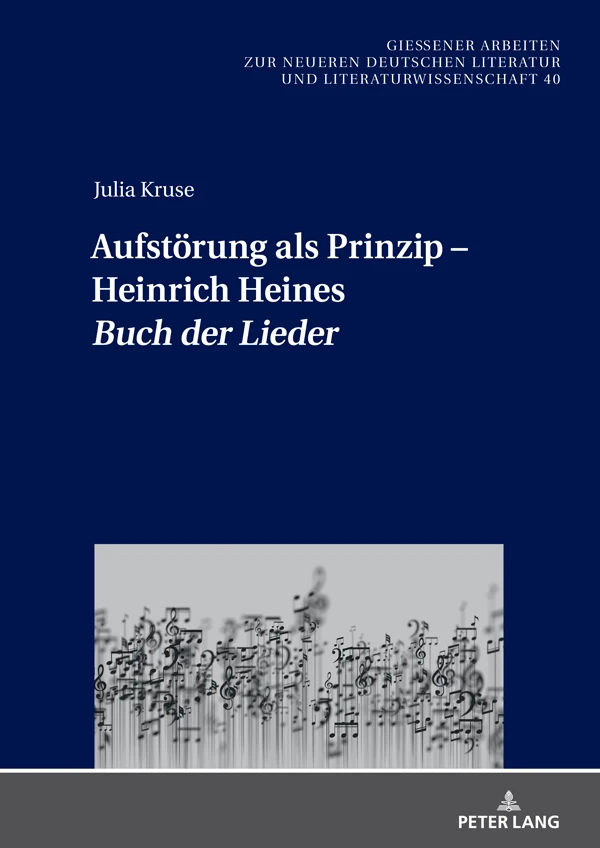Aufstörung als Prinzip – Heinrich Heines «Buch der Lieder»
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Title
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Hinweise zur Zitierweise und zum Genus-Gebrauch
- Einleitung
- Teil I Theoretische Grundlagen
- 1 Störungen
- 2 Emotionen
- 2.1 Emotionen auf der Textebene
- 2.2 Emotionen auf der Rezeptionsebene
- 2.3 Lyrik und Emotionen
- 3 Störungen und Emotionen
- 3.1 Erwartungen in der literarischen Kommunikation
- 3.2 Erwartungsbrüche mit ‚Störungspotenzial‘
- 3.3 Kriterien bei der Untersuchung von Störungen auf der Textebene und ihr möglicher Bezug zur Moderne
- Teil II Störungen auf der Symbolebene
- 1 Traumbilder II
- 2 Traumbilder X
- 3 Lieder I
- 4 Lieder XI
- 5 Romanzen II: Die Bergstimme
- 6 Romanzen IV: Der arme Peter
- 7 Sonette: An H. S.
- 8 Lyrisches Intermezzo XIV
- 9 Lyrisches Intermezzo XVI
- 10 Lyrisches Intermezzo L
- 11 Heimkehr II
- 12 Heimkehr III
- 13 Aus der Harzreise: Prolog
- 14 Die Nordsee XI (Erster Cyklus): Reinigung
- 15 Die Nordsee X (Zweiter Cyklus): Epilog
- Teil III Störungen auf der Rezeptions- und Handlungsebene
- 1 Die widersprüchliche Rezeption und Bewertung der Gedichte
- 1.1 Neuartigkeit und Originalität
- 1.2 Stimmigkeit und Harmonie
- 1.3 Hinwendung zum Irdischen und Reiz der „Nervenerschütterung“
- 1.4 Ironie und Zerstörung
- 2 Einordnung des Buchs der Lieder in die (moderne) Romantik
- 2.1 Zwischen Identitätsstiftung und -erschütterung
- 2.2 Neue Dichterrollen und Lesertypen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Hinweise zur Zitierweise und zum Genus-Gebrauch
Der Quellennachweis erfolgt mit Hilfe der deutschen Zitierweise. Alle Hervorhebungen im Original werden übernommen und nicht als solche gekennzeichnet. Von mir hervorgenommene Textpassagen erfolgen in Kursiv und werden als [Hervorhebung J. K.] im Zitat sichtbar.
Die Zitation der Texte Heines folgt der Düsseldorfer historisch-kritischen Gesamtausgabe der Werke Heinrich Heines von Manfred Windfuhr mit dem Kürzel DHA und der Nennung des jeweiligen Bands. Die Zitate von Textpassagen aus Briefen sind mit dem Kürzel HSA versehen. Die Gedichte werden aus der Fünften Auflage (Hamburg, bei Hoffmann und Campe) von 1844, der sogenannten „Ausgabe letzter Hand“, zitiert. Die Verse der analysierten Gedichte sind als Zahl hinter der zitierten Textpassage in Klammern angegeben. Alle zitierten Erläuterungen von Pierre Grappin aus dem Apparat zum Buch der Lieder sind mit dem Kürzel DHA, Bd. 1/2 gekennzeichnet. Bibelzitate folgen der Übersetzung von Martin Luther (rev. 2017).
Der Lesbarkeit halber wird auf das Gendersternchen („Leser*innen“), das „Binnen-I“ („LeserInnen“) oder andere generische Doppelungen („Leser und Leserinnen“) verzichtet. Alle verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche, männliche und nichtbinäre Personen.
Einleitung
Im vergangenen Jahre fielen mir die Reisebilder von Heine in die Hand. […] Erst vor einigen Tagen entdeckte ich sein bereits im Jahr 1827 gedrucktes, mir aber bisher unbekannt gebliebenes Buch der Lieder […]. Ich entschloß mich […] gleich, diese Lieder zu lesen. Verschiedene derselben kannte ich aus den Reisebildern. Mehrere mißfielen mir, weil sie gar zu nachlässig, ich möchte sagen, gar zu liederlich hingeworfen, kaum, mehr an die Form der Poesie erinnern und einem Tischgespräch ähnlicher sehen, als Gedichten. Aber eine gewisse Anzahl wirkte auf mich mit einem unbeschreiblichen Zauber; und an diesem ergötze ich mich fortdauernd. Morgens und Abends sind sie meiner heutigen Gemüthsstimmung dergestalt homogen, daß ich mich ganz darein vertiefen, und versenken kann.1
In dieser von Friedrich von Gentz verfassten Notiz wird ein emotionales Lektüreerlebnis angesprochen, das repräsentativ für die gesamte Rezeptionsgeschichte des Buchs der Lieder ist. So zählt Heines Liederbuch zwar zu den erfolgreichsten Gedichtbänden Deutschlands, faszinierte und begeisterte das Lesepublikum nachhaltig, bot zugleich aber auch Anlass für tiefgreifende Irritationen, Hass und Ablehnung. Die frühen Gedichte deuten darauf hin, dass der junge Dichter diese Störungen auf der Textebene bewusst produzierte und so die für die Moderne konstitutive Erfahrung, dass die „Welt selbst mitten entzwey gerissen ist“2, literarisch aufzuarbeiten suchte. Dabei schien das poetische Medium adäquat, die „Ambivalenzerfahrung“3 nicht nur zu kommunizieren, sondern auch sinnlich erfahrbar zu machen, und zugleich einen Lösungsvorschlag im Umgang mit den Ambivalenzen4 der Moderne anzubieten, ganz im Sinne eines Entwurfs ästhetischer Bildung.
Gerade diese Störung, die sich in Heines Texten als Zwiespalt von sinnlicher Gestaltung und rationaler Widersprüchlichkeit, Kunst und Realität, Fiktion und Gesellschaftskritik, Poesie und Politik manifestiert, hat zu Reaktionsweisen im Publikum geführt, die sich sowohl in ihren Interpretationsansätzen widersprechen, wie etwa in der Frage nach der Echtheit oder Verlogenheit des dargestellten emotionalen Erlebnisses,5 als auch in ihrem leibgetragenen Umgang mit diesem Widerspruch:
Eine weit verbreitete Variante war bis in die 60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts die Trennung des ‚poetischen‘ vom ‚politischen‘ Heine: Während der erste als Verfasser romantischer Lieder und ironischer Reiseberichte geduldet, gelegentlich auch verehrt wurde, lehnte man den zweiten, den politischen Heine ab.6
Dass ein Buch mit dem liebevollen Namen „Buch der Lieder“, eine „auserlesene Gedichtesammlung“ der bereits veröffentlichten Gedichte Heines, „chronologisch geordnet und streng gewählt“7, wesentlich zu diesen Reaktionen beigetragen hat, mag für die große Ironie sprechen, die für Heine so charakteristisch ist und sich selbst durch die gesamte Rezeptionsgeschichte der Texte zieht. Die Paradoxität zeigt aber auch, dass es im Fall Heine kein „Entweder – Oder“ bzw. Dichter oder Politiker8 gibt, jegliche Grenzen, die der Autor auch in seinen Gedichten zieht, vielmehr fließende Übergänge darstellen, so dass eine einseitige Konzentration auf den Zeichenbegriff dem Werk und der Dialektik Heines kaum gerecht werden kann.9 Denn, indem einige Gedichte nicht das emotionale Erleben selbst, sondern die Unzulänglichkeit der Sprache, die Diskrepanz zwischen Inhalt und Ausdruck sowie den begrenzten sprachlichen Ausdruck von Emotionen in den Vordergrund stellen und damit auch die gängigen Vorstellungen von Autorschaft und lyrischem Ich dechiffrieren und problematisch erscheinen lassen, geraten die Gedichte, in denen Subjektivität und Unmittelbarkeit suggeriert werden, in den Verdacht der Verlogenheit.10 Die Störung betrifft, so lässt sich mit Sousa konstatieren, im Wesentlichen die Rezeptionsebene, auf der es zu einer „Verwechslung von Sprache und Wirklichkeit“11 kommt. Aus diesem Grund müsse nach der Bedeutung der textimmanenten Störung für den Rezeptionsprozess gefragt werden.12
Obwohl das Buch der Lieder seine Leserschaft dazu verführte, es dem Bereich der Poesie zuzuordnen und seine textimmanenten Störungen zu ignorieren, so dass es wohl auch deshalb zu einem der erfolgreichsten und populärsten Lyrikbände wurde,13 blieb der erste Gedichtband Heines ebenso wenig von Ablehnung und Hass verschont, gerade weil die textuell produzierten Störungen massiv an dem Denkgerüst der Rezipienten rüttelten. Dass Heine Jude war, kam vielen da gerade Recht: „In zahlreichen Eigenarten von Heines Person und Schreibart sahen Gegner fortan ‚typisch Jüdisches‘ […].“14 In dem mittlerweile zum Exempel negativer Kritik an Heine gewordenen Aufsatz „Heine und die Folgen“ (1910) von Kraus, nicht zuletzt aber mit dem Verbot und Verbrennen seiner Werke im Nationalsozialismus, erreichten die Anfeindungen gegen den Dichter in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt.15 Adorno spricht 1956 von der „Wunde Heine“, „von dem, was an ihm schmerzt und seinem Verhältnis zur deutschen Tradition, und was zumal in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg verschwiegen ward.“16 Wie tief die Wunde ist, die Heine hinterlassen hat, mag nicht nur der Streit um die Benennung der Düsseldorfer Universität17 gezeigt haben, sondern auch die Tatsache, dass erst im Jahr 2010 Heines Büste in die Walhalla aufgenommen wurde, obwohl – und das war der ausschlaggebende Punkt, der gegen die Aufnahme der Dichterbüste in die bayerische Ruhmeshalle sprach – in den „Lobgesänge[n] auf König Ludwig“18 eine Kritik an der Walhalla deutlich werde.19 Der Konsens, der sich ab den 1980er Jahren allmählich abzubilden scheint, der „Streit um Heine“ seitdem nahezu ins Gegenteil umgeschlagen ist,20 macht Heines Geschichte der Ausgrenzung und Diffamierung jedoch nicht vergessen.21 Zwar sind polarisierende Werke in der Literatur nicht selten; eine neben der paradoxen Wirkung auftretende und dermaßen emotional-leibgetragene Reaktionsweise auf einen Schriftsteller und dessen Werk, wie sie sich im Fall des Buchs der Lieder als Abwehr, Verehrung und Faszination widerspiegelt, lässt Heines Werk allerdings zu einem Sonderfall der deutschen Literatur werden. „Es gibt den Streit um Heine. Und es gibt den Streit über die frühe Lyrik Heines“22, fasst Höhn in seinem Heine- Handbuch die Rezeption des Dichters und seiner Lieder zusammen.
Der Streit scheint zunächst auf die textuell gestalteten Widersprüche zurückzugehen. Nach Höhn kommt dem Kontrast die Funktion zu, „real existierende Widersprüche störend bewusst zu machen [Hervorhebung J. K.]“23 und einen „Erkenntnisprozess“ in Gang zu setzen. Die textimmanente Störung in Form von Kontrasten, Antithesen, Gegensätzen und Dissonanzen führe insofern zu einer Provokation oder einem Ärgernis24 bzw. zu einer Aufstörung.25 Sie kristallisiere sich insbesondere ab den 1830er Jahren im Kontext des politischen Engagements des Autors in seinem Prosawerk heraus.26 Der Streit um Heines frühe Lyrik zeigt jedoch, dass sich die Verbindung von Dichtung und Politik auch im Buch der Lieder manifestiert, auch wenn ihm der Stellenwert der „frühen Dichtung“ zukommt, die von Bierwith als „Orientierungssuche und Hinwendung zum gesellschaftlichen Selbstverständnis“27 charakterisiert wird. Allerdings zeigt die Autorin auch, „daß die Forderung nach Menschenrechten und Demokratie Grundlage von Heines dichterischem Auftrag ist“ und „sich auch schon in der Zeit vor dem französischen Exil herausbilde[t].“28
Der Erfolg des Liederbuchs zeigt aber auch, dass der Streit nicht allein auf die Textebene zurückgeführt werden kann, zumal Höhn auch darauf aufmerksam macht, dass das Buch der Lieder in der Anordnung seiner Gedichte als Geschichte des Übergangs vom Dissens zum Konsens verstanden werden kann29 und dementsprechend viele Gedichte keine Brüche, Dissonanzen, kein Widerspiel von Sentimentalität, Pathos, „Innigkeit“ und ironischer Brechung aufweisen.30 Und wie die ersten Leseberichte deutlich werden lassen, war das faszinierte Publikum durchaus in der Lage, die Dissonanzen wahrzunehmen. Deshalb bleibt dann auch die Frage unbeantwortet, warum es einigen Lesern gelingt, sich voll und ganz mit dem Dargestellten zu identifizieren, während andere die Gedichte rigoros ablehnen. Die „Kontrastästhetik“31 lässt demnach, so ist zu vermuten, auch Raum für ästhetische Emotionen wie Faszination und Anziehung. Insofern reagierten die Leser nicht nur mit Ablehnung auf das Buch. Im Gegenteil: Das Buch der Lieder ist Heines erfolgreichste Gedichtsammlung, wenn nicht sogar der erfolgreichste Lyrikband in der deutschen Literaturgeschichte.
Im Anschluss an Bierwirth bleibt zunächst zu fragen, inwiefern sich die Synthese von Kunst und Politik und die damit einhergehende Funktion des Bewusstmachens realer Störungen im Sinne eines Erkenntnis- und Wahrheitsinteresses in Heines Buch der Lieder manifestiert, das offenkundig kein politisches Werk darstellt. Es ließe sich fragen, inwiefern der Dichter das Konzept ästhetischer Erziehung für sich weiterentwickelt und damit die Synthese aus Kunst und Engagement, aber auch Geist und Materie in seinem Liederbuch anstrebt, um im Sinne des Hellenismus auch den Leib in das ästhetische Erlebnis einzubeziehen. Dass Heine für die (Wieder-)Belebung des Leibes plädiert, der durch die christliche Betonung der Seele seit dem Mittelalter in den Hintergrund gerückt war, kommt auch in seinen literarischen Texten selbst zum Ausdruck. Mit Wortmann lässt sich in diesem Kontext sagen, dass Heines Schreibart auf Präsenzeffekte hin angelegt ist. Ziel dieser Effekte sei es, „den Leser für das Erfahrungspotential des Körpers im Zeichen einer allgemeinen und grundlegenden Krise zu sensibilisieren und ihn auf die […] historische Misere der verdrängten menschlichen Sinnlichkeit aufmerksam zu machen.“32 Insofern haben die Körperinszenierungen das Potenzial, die moderne ‚Krise‘ künstlerisch produktiv zu machen und weiterzugeben.33 Auch wenn Wortmann seine Überlegungen in erster Linie vor dem Hintergrund von Heines Prosawerk entwickelt, spiegele sich die inszenierte Präsenz des Autors als „Augenzeuge“, damit einhergehend dessen sinnlich-leibliche Erfahrungen, nicht nur in Heines Prosatexten wider, „sondern ist grundlegendes ästhetisches Merkmal“34 all seiner Texte. Die Frage, die sich demnach stellt, ist, wie Heine eine solche Unmittelbarkeit im Buch der Lieder erzeugt und inwiefern dessen textuell angelegte Störungen im Zusammenhang mit der paradoxen Aufarbeitung der Gedichte stehen.
Die Heine-Forschung hat wiederholt gezeigt, dass der Dichter die Differenzen und Störungen seiner Zeit in besonderem Maße erlebte35 und diese vor allem in seinen Prosaschriften als moderner Zeitschriftsteller und Intellektueller, der aktiv in den Geschichtsprozess eingreift, weitergeben wollte.36 In der Verortung der literarischen Dissonanzen betont die Forschung vor allem die Modernität des Autors, etwa wenn sie ihn als „Dichter der Zeitwende“37, „Vater des europäischen Modernismus“38, „Grenzgänger“39 oder „Wegbereiter der Moderne“40 bezeichnet. Der literarischen Störung kommt aus dieser Perspektive die Funktion der Vermittlung einer „Ambivalenzerfahrung“41 zu, welche mit dem allgemeinen Gefühl der „Zerrissenheit“42, der „missglückten Erlösung“43 zu Beginn des 19. Jahrhunderts einhergeht und ihren Ausgangspunkt auf der Textebene nimmt. Sie stellt sich in Form einer Inszenierung eines ‚Stachels‘ dar, der sich der literarischen und auf Zeichen basierenden Darstellung entzieht und für die Widersprüche der Moderne steht, die in ihrer Neuartigkeit das Potenzial besitzt, sowohl Faszination als positive als auch Abwehrmechanismen als negative Reaktionen zu evozieren. Die Störung, die nicht an Sinn gebunden ist und aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit eine Verunsicherung und schließlich eine emotional-leibliche Reaktion einfordert, dient im Anschluss an Oesterle dann der Wahrheitsfindung, weil die Transformation „mehr gesellschaftliche und ästhetische Wahrheit schafft als scheinbar natürliche Gefühlsgedichte“44, die auf Bildlichkeit und Thematisierung von Gefühlszuständen ausgerichtet sind. Insofern lässt sich die Störung, die den Leib des Lesers in den Mittelpunkt der sinnlichen Wahrnehmung rückt, als den eigentlichen Ort des Subjektiven beschreiben.
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, sowohl die produktions- als auch die rezeptionsästhetische Funktion der Dissonanzen45 und der damit verbundenen Störungen unter Berücksichtigung der Besonderheit der literarischen Sprache zu beleuchten. In diesem Zusammenhang gilt es, die Leibgebundenheit der Störung und deren emotionale Basis in den Fokus zu stellen. Meine These lautet, dass den Gedichten ein besonderer Reiz oder vielmehr eine sprachlich- kommunikativ gestaltete Störung zugrunde liegt, die als eine „Poetik der Störung“ im Sinne Gansels46 das Potenzial hat, den Leser zu ‚stacheln‘, aufzustören47 und auf diese Weise auf die Haltung des Lesepublikums einzuwirken.48 Über die von Sousa formulierte These, dass die „‚Unruhe‘-Struktur“49 auf dem Nebeneinander von Echtheits- und Fiktivitätssignalen im Buch der Lieder, vor allem im Heimkehr-Zyklus, basiere, geht diese Arbeit hinaus. Ich möchte den Grund für den Streit, der sich nicht nur in einer Verwirrung hinsichtlich der Frage nach der Echtheit der Gedichte äußerte, sondern in emotionale, insbesondere leibgebundene Reaktionen wie Faszination und Irritation oder Affinität und Aversion mündete, auf den gesamten Gedichtband ausweiten, um dessen Erfolgs- und Diffamierungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Produktivität der Störung in den Blick zu bringen. Es geht dabei weniger darum aufzuzeigen, wie Heine mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln der literarischen Sprache versucht, den „Weltriss“, die Diskrepanz zwischen Ausdruck und Inhalt, zu schließen, denn das weiß er, kann er ebenso wenig wie seine romantischen Vorgänger. Vielmehr soll der emotionale Umgang mit dieser Störung, wie er sich in den Gedichten manifestiert, als Sinnangebot neu bestimmt werden.
Insgesamt wird die Störung im Anschluss an Kortländer und Singh, die das dialektische Denken Heines in den Mittelpunkt ihrer Herausgeberschrift stellen, in einen umfangreicheren Zusammenhang gebettet: „Aus dem Kontrast von Wachen und Träumen, Nüchternheit und Rausch, Leben und Tod, Sein und Nicht-Sein, Sinnhaftem und Sinnlosen schlägt Heine die zwar ironischen und sarkastischen, aber immer lachenden Funken seines literarischen Spiels.“50 Demnach verweist die Konfliktsituation von Liebe und Verzicht und der daraus resultierende Schmerz in den Gedichten auf die tiefgreifende Störung zwischen semiosis und aisthesis.51 Diese Störung entzieht sich der Sprache, womit die Leibgebundenheit der Reaktionen auf Heines Gedichte in Form von Faszination und Abwehr52 in den Fokus rückt. Das mit der Störung einhergehende Gefühl des Unheimlichen, aber auch Faszinierenden, zeigt sich in aller Deutlichkeit bereits in den Traumbilder-Gedichten des ersten Zyklus, deren Bedeutung von der Forschung mittlerweile trotz des Status der „frühen Gedichte“ anerkannt wird.53 Die Kanonisierung und Vertonung einzelner Gedichte, darauf verweist Altenhofer, hat maßgeblich zur Ignoranz der textimmanenten Störung beigetragen.54 Aus diesen Gründen scheint mir eine Untersuchung aller Zyklen unausweichlich.
Die Arbeit nimmt ihren Ausgangspunkt also auf der Gestaltungs- und Darstellungsebene der Störung und zeigt anhand textnaher Interpretationen, die, wie Höhn bereits 2009 den Forschungsstand in der Untersuchung der Sprache Heines bemängelt, oft vernachlässigt werden,55 die sprachlichen Mittel auf, mit denen sich weit mehr sagen lässt, als im Medium ‚Text‘ explizit gesagt werden kann. Demnach ist der Grund für die paradoxe Rezeptions- und Wirkungsgeschichte des Buchs der Lieder als Stachel bzw. Reiz auf der Textebene, der auf den Leser irritierend wirkt und dabei sowohl positiv- als auch negativ- leibgetragene Reaktionen zulässt, zu suchen. Die literarische Sprache erlaubt es dabei, die vom Dichter intendierte Aufstörung nicht nur mit Blick auf die Unzulänglichkeit des Literatur- und Sprachsystems, sondern auch den „Weltriss“ in seiner emotionalen Leibgebundenheit weiterzugeben und ein Bewusstsein für die Moderne zu schaffen. Die Erzeugung und Vermittlung von Emotionen findet nach diesem Ansatz nicht in der codierten und auf Konventionen beruhenden Präsentation von Emotionen auf der rein thematisch-inhaltlichen oder darstellerischen Ebene statt, sondern gerade in den Störungen der literarischen Kommunikation als „Leerstellen“ im Sinne Isers.56 Diese begegnen dem Leser als bedeutungsoffener Raum, in dem der Leser den für romantische, andere traditionelle Texte und für das Literatursystem insgesamt greifenden Code nicht mehr anwenden kann, so dass keine Verknüpfung mit dem Bekannten mehr möglich ist, was zu einer Aufstörung oder Verunsicherung führt. Denn der für die Erlebnislyrik charakteristische metaphorische Ausdruck von „Subjektive[m], Empfindungen, Stimmungen, Liebe, Schmerz, Verzweiflung, Enttäuschung usw.“ in den Gedichten erscheint, wie Heißenbüttel betont, „durchkreuzt von dem, was dann als Ironie oder gar Zynismus Heine den jahrhundertlangen Tadel einbrachte.“57 Der Bruch mit den Konventionen von Erlebnislyrik und Volkslied und das Entlarven von Stereotypen als bloße Reizkonfigurationen im Buch der Lieder stellen dabei nur einen Teil der Störung dar. Diese Störungen wurden an anderer Stelle bereits untersucht.58 Zu bedenken sind auch die sich mit der Moderne entwickelnden Neuerungen im literarischen Kommunikationssystem – etwa die sich herausbildende Rolle des Berufsschriftstellers oder die Weiterentwicklung der literarischen Ironie. Insofern versteht die Untersuchung die literarische Störung nicht als eine Kritik59 des Dichters an der romantischen bzw. traditionellen Dichtung, die von der Forschung ohnehin zunehmend bezweifelt wird,60 sondern als literarischen Versuch ihrer Neubestimmung in der Moderne.
Den Zugang zu einem solchen Ansatz bietet die aus medientheoretischer Perspektive und vor dem Hintergrund der Systemtheorie sowie der daraus hervorgegangenen konstruktivistischen Literaturtheorie von Schmidt entwickelte Kategorie ‚Störung‘ von Gansel und Ächtler.61 Das Modell nimmt insbesondere hinsichtlich seiner Unterscheidung von Störungen in der Literatur als Symbolsystem und als Handlungssystem62 für diese Arbeit eine Leitfunktion ein. So erfolgt die Untersuchung der Störungen in der literarischen Kommunikation zwischen Heines Gedichtband und dessen Leserschaft sowohl auf der Textebene als auch auf der Ebene der Produktion und Rezeption. Unter dem Aspekt der Produktivität von Störungen wird das Literatursystem als ein Diskurs- und Aushandlungsfeld begriffen, in welchem die Störung die Funktion übernimmt, positive Veränderungen hervorzurufen. In diesem Kontext ließe sich Heine als „Ruhestörer“63 verstehen.
Der folgenden Frage soll dabei Rechnung getragen werden: Inwiefern ist die literarische Störung in der Lage, etwas zu kommunizieren, was sich der Kommunikation eigentlich entzieht und nicht in Worte fassen lässt? Zwar spricht die Emotionsforschung Emotionen eine wichtige kommunikative Seite zu,64 doch wie sich eine bestimmte emotionale Situation anfühlt, wissen wir erst, wenn wir sie selbst erlebt haben.65 Zudem wird die Kommunikation von Emotionen dadurch erschwert, dass sie auf subjektiven Empfindungen, sowohl körperlichen als auch seelischen, beruht, die nicht mit Sinn zu vereinbaren sind. Die Fragestellung dieser Arbeit ließe sich dann so formulieren: Wie gelingt es Heine, mittels einer Poetik der Störung eine Emotion weiterzugeben, die sich rational nicht erklären und somit auch eigentlich gar nicht kommunizieren lässt?66 Um diese Frage zu beantworten, wird die Ebene der sinnlichen Gestaltung, wie sie etwa von Wortmann als Inszenierung einer unmittelbaren Gesprächssituation begriffen wird, in den Blick genommen. Die von den Gedichten ausgehende Aufstörung wird dabei als eine von der Konvention abweichende (Kommunikations-)Störung verstanden, welche eine Irritation bzw. Aufstörung beim Leser hervorrufen kann und zu jener widersprüchlichen und emotionalen Aufarbeitung des Liederbuchs geführt hat. Dabei zeigt sich, dass der auf De- und Encodierung basierende Kommunikationsbegriff für die Literatur nur bedingt geeignet ist, wenn wir davon ausgehen wollen, dass gerade in der Abweichung von der alltagssprachlichen Konvention, wie sie für den Ausdruck von Literatur ohnehin charakteristisch ist, eine Kommunikation von Emotionen möglich ist. Das betrifft auch die „‚kommunikativen‘ Instanzen“ wie „Sender“ und „Empfänger“67. Die Annahme, dass dem Lyrikband eine Poetik der Störung zugrunde liegt, eine bestimmte Machart also, die in Darstellung und Thematik gestört ist, lässt den Schluss einer vom Dichter ganz bewusst inszenierten Aufstörung zu.68 Dass dies möglich ist, „verdankt sich der komplexen Struktur der Sprache […].“69 In diesem Sinne wird das Buch der Lieder im Kontext seiner literarischen Kommunikation als literarisch gestörte Rede untersucht, die dem Leser ein Gefühl der Verunsicherung und Nervosität vermittelt, das die Begegnung mit dem Unbekannten und von der Konvention Abweichenden mit sich bringt, weil der bisherige Code für die traditionelle Literatur außer Kraft gesetzt wird. Insofern stellt der Text in seinem Bruch mit dem Erwarteten selbst eine Art ‚Krise‘ her, verknüpft gleichsam das allgemeine Krisenbewusstsein mit der im Text erzeugten Unsicherheit, die auch Raum für Faszination lässt. Damit folgt die Arbeit einem emotionalen Ansatz, der den Text in erster Linie als Resonanzraum70 versteht:
Wenn Verkörperung, also die Empfindung der sie begleitenden physiologischen Prozesse, elementarer Bestandteil menschlicher Emotionen ist, so bietet sich das Korpus des Textes als imaginäres Äquivalent solch physiologischer Resonanz an – und zwar sowohl auf der Ebene der Fantasien, die er ermöglicht, als auch in seinem ‚So-Sein‘ als gestaltetes, rhythmisiertes Massiv aus Zeichen.71
Der erste Teil der Arbeit wird die Grundlage für einen solchen Ansatz bilden. Dass die Arbeit der immensen Definitionsvielfalt, die wohl auch bedingt wird durch das wissenschaftliche Streben, sich den Termini aus verschiedenen Forschungsperspektiven anzunähern, nicht gerecht werden kann, steht außer Frage. Aus diesem Grund sehe ich mich vor die Aufgabe gestellt, aus der Definitionsvielfalt nur jene Definitionen herauszugreifen, die sinnvoll für eine theoretische Zusammenführung dieser sowie für die Beantwortung der Fragestellung insgesamt erscheinen. Eine Annäherung an den Untersuchungsgegenstand erfolgt demnach vor dem Hintergrund, dass es sich lediglich um eine Auswahl von Definitionen aus einem breiten Forschungs- und Definitionsspektrum handelt. Der Theorieteil geht primär folgenden Fragen nach:
- Inwiefern kann Literatur als Ort bzw. Medium von Störungen begriffen werden?
- Wie erzeugt Literatur Emotionen?
- Welche Folgen hat ein Bruch mit Erwartungen für die ästhetische Wahrnehmung?
Ziel des Grundlagenteils ist es, ein Modell zu entwickeln, mit dem sich textuell angelegte Störungen greifen und analysieren lassen.
Im zweiten Teil wird der Versuch unternommen, der Poetik Heines auf den Grund zu gehen, die eine widersprüchliche Aufarbeitung der Gedichte zulässt. Mit Hilfe der im Grundlagenteil aufgestellten Kriterien zur Untersuchung literarischer Störungen werden anhand einer textnahen Analyse Grundzüge einer solchen Poetik herausgearbeitet, mit der sich sowohl die literarische Gestaltung einer realen (Auf)Störung als auch deren Weitergabe durch den literarischen Text als Produkt der Störung in den Blick bringen lassen. Für die Untersuchung wurden insgesamt 15 Gedichte ausgewählt, wobei aus jedem Zyklus und Unterzyklus mindestens ein Gedicht stammt, um einen umfassenden Blick auf das Buch zu ermöglichen. Neben der Einzelanalyse werden die jeweiligen Zyklen und die Beziehung der Gedichte zueinander untersucht, da dem zyklischen Arrangement im Buch der Lieder eine wesentliche Bedeutung zukommt.72 Welche Bedeutung die Zyklen und die Beziehung der Gedichte zueinander haben, soll mit Blick auf literarisch inszenierte Störungen ausgearbeitet werden.
Der dritte Teil widmet sich schließlich der kontextuellen Verortung der literarisch inszenierten Störung auf der Handlungsebene und stellt Verbindungslinien zwischen den im Text festgemachten Störungen und der widersprüchlichen Rezeptionsgeschichte des Gedichtbands her. Damit verortet die Arbeit Heines Modernität nicht auf der Textebene allein, sondern sucht diese ausgehend vom Reiz bzw. ‚Stachel‘ auf der Textebene im komplexen Verhältnis zwischen Text und Leserschaft greifbar zu machen. Der Streit um Heine, der heute in eine mehr oder weniger voraussetzungslose Wertschätzung, die aber gerade der Widerspenstigkeit und dem Aufstörungspotenzial, damit auch der spezifischen Kunstform der Texte Heines zu wenig Rechnung trägt, umgeschlagen ist, lässt sich auf diese Weise nicht als Akt „moralischer Wiedergutmachungspflicht“73, dessen Fatalität Heißenbüttel betont, verstehen, sondern als einen Aushandlungsprozess bezüglich eines neuen und für die moderne Literatur charakteristischen Codes, sofern wir Literatur einen Code geben können. Denn zweifelsohne bezogen sich die Reaktionsweisen des Publikums, darauf verweist Heißenbüttel ebenfalls, nicht auf die Erscheinungsform des Werks, sondern auf das, „was sonst das Übliche und Gewohnte der Epoche darstellt.“74 Dabei wird eine Antwort auf die Frage nach der emotional-psychologischen Funktion und Bedeutung der literarischen Störung im Handlungssystem zu geben versucht.75
1 Zit. n. Eberhard Galley/Alfred Elstermann (Hrsg.): Heinrich Heines Werk im Urteil seiner Zeitgenossen, Bd. 3: Rezensionen und Notizen zu Heines Werken aus den Jahren 1835 und 1836, Hamburg 1987, S. 545.
2 DHA, Bd. 7/1, S. 95.
3 Wolfgang Preisendanz: Der Ironiker Heine. Ambivalenzerfahrung und kommunikative Ambiguität, in: Gerhard Höhn (Hrsg.): Heinrich Heine. Ästhetisch-politische Profile, Frankfurt/Main 1991, S. 101–115, hier: S. 101.
4 Ambivalenz soll hier unter Rückgriff auf Bauman verstanden werden als eine Situation, in der „die sprachlichen Werkzeuge der Strukturierung sich als inadäquat erweisen; entweder gehört die Situation zu keiner der sprachlich unterschiedenen Klassen oder sie fällt in verschiedene Klassen zugleich. Es könnte sich erweisen, daß keines der erlernten Muster in einer ambivalenten Situation richtig ist – oder mehr als eines der erlernten Muster angewendet werden kann […].“ Zygmunt Baumann: Moderne und Ambivalenz, 2. Aufl., Hamburg 2005, S. 12.
5 Vgl. dazu den Forschungsüberblick von Karin Sousa: Heinrich Heines „Buch der Lieder“. Differenzen und die Folgen, Tübingen 2007, S. 171–208.
6 Bernd Kortländer: Heinrich Heine, Stuttgart 2003, S. 75.
7 Heine in einem Brief an Merckel vom 16. November 1826. HSA, Bd. 20, S. 275.
8 Vgl. Kortländer, Heinrich Heine, S. 84: „Er [Heine] hat diesen gemeinsamen Nenner von Politik und Poesie nicht nur wieder und wieder beschworen, er hat ihn in seinen Texten ständig aufs Neue zum Thema gemacht und bis zum Schluss an ihm festgehalten.“
9 So kommt Sousa in der Untersuchung des Heimkehr-Zyklus sowie des Vorworts der zweiten Auflage des Gedichtbands von 1837 zu dem Ergebnis, „dass den Zeichen keine festen Bedeutungen inhärent sind, die es im Rahmen eines textuellen Verstehensprozesses nur mit Verstand herauszulesen und zum Gesamtsinn des Textes zusammenzufügen gilt.“ Sousa, Heinrich Heines „Buch der Lieder“, S. 218.
10 Vgl. ebd., S. 216. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Dietmar Goltschnigg/Hartmut Steinecke: Heine und die Nachwelt. Geschichte seiner Wirkung in den deutschsprachigen Ländern. Texte und Kontexte, Analysen und Kommentare, Bd. 1: 1856–1906, Berlin 2006, S. 44: „Bezweifelt wurde immer häufiger, dass den in den Gedichten ausgedrückten Gefühlen ‚echte‘ Erlebnisse zugrunde lagen, man warf Heine vor, dass die Emotionen unecht, erfunden, gelogen seien; der ironische und frivole Umgang damit, die abrupten Stimmungsbrüche galten als Belege.“
11 Sousa, Heinrich Heines „Buch der Lieder“, S. 221.
12 Vgl. ebd., S. 220–221. Sousa bezieht sich hier insbesondere auf Lehmann, die bereits 1976 den Zusammenhang zwischen der textimmanenten Kontrastierung zwischen Popularisierung und Ironie und der daraus resultierenden Spaltung in der Leserschaft untersucht hat. Vgl. Ursula Lehmann: Popularisierung und Ironie im Werk Heinrich Heines. Die Bedeutung der textimmanenten Kontrastierung für den Rezeptionsprozeß (=Europäische Hochschulschriften, Bd. 164), Frankfurt/Main; Bern 1976, S. 39.
13 Vgl. dazu Bernd Kortländer: Poesie und Lüge. Zur Liebeslyrik des „Buchs der Lieder“, in: Höhn, Heinrich Heine (1991), S. 195–213, hier: S. 196: „Seine Leser tappen mit Genuß in die ihnen gestellten Gefühlsfallen, ohne sich im geringsten unbehaglich zu fühlen; sie machen ohne Besinnung Gebrauch von jenem Sentiment, das Heine ihnen in subversiver Absicht anbietet, und scheren sich keinen Deut darum, ob es sich dabei um bloße Fluchtreaktionen handelt.“ Ähnlich kommentiert Mauthner 1897 die Rezeption des Gedichts „Leise zieht durch mein Gemüth“ als sentimentales Volkslied, das zwar nicht Teil des „Buchs der Lieder“ ist, aber durchaus dort hineinpassen würde, dass „kaum jemand“ bemerkt hätte, „daß dieses Gedicht keinen einzigen Reim enthält, und daß gerade durch diese absichtliche Regellosigkeit das Volksliedmäßige hervorgezaubert ist.“ Zit. n. Goltschnigg/Steinecke, Heine und die Nachwelt, Bd. 1, S. 367.
Details
- Seiten
- 366
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631918913
- ISBN (ePUB)
- 9783631918920
- ISBN (Hardcover)
- 9783631918906
- DOI
- 10.3726/b21825
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (Oktober)
- Schlagworte
- Studienliteratur Komparatistik Literaturwissenschaft Germanistik Gedichtanalyse Rezeptionsanalyse Rezeptionsästhetik gestörte Rezeption ästhetische Emotionen Romantik Moderne Lyrik Buch der Lieder Heinrich Heine Geisteswissenschaften
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 366 S., 7 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG