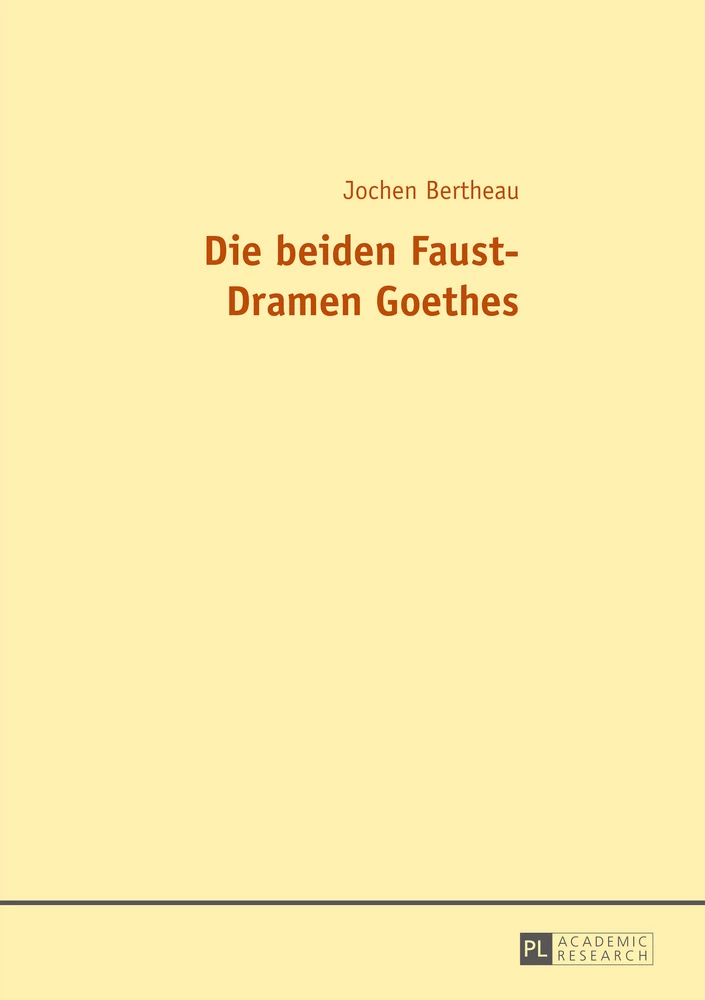Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsangabe
- A. Kritische Untersuchung der von Goethe veröffentlichten Faust-Texte
- 1. „Faust. Ein Fragment“
- 2. „Faust I“
- 3. Der Nummernplan und der Buchstabenplan
- 4. „Faust II“
- 5. Der „Ur-Faust“
- 6. Die Paralipomena
- B. Die Entwürfe zum „Ur-Faust“
- C. Struktur und Konzeption des „Ur-Faust“
- D. Struktur und Konzeption im Römischen Plan
- E. Die Vorlagen der Faust-Oper
- F. Vorlagen für den „Ur-Faust“
- G. Ur-Faust (Text)
- H. Faust. Eine Oper von Johann Wolfgang von Goethe (Text)
- I. Texthistorischer Kommentar zu den ergänzten Szenen der Faust-Tragödie (Ur-Faust)
- K. Texthistorischer Kommentar zu „Faust. Der Oper erster Teil“
- Bibliographie
A. Kritische Untersuchung der von Goethe veröffentlichten Faust-Texte
1. „Faust. Ein Fragment“:
Goethes erster Faust-Plan entstand, so ist aus allen Erwähnungen erschließbar, in Frankfurt. Bis zur Abreise nach Weimar arbeitete er daran und las oft Freunden daraus vor. Diese hatten den Eindruck, das Drama sei „fast fertig“, aber es wurde nicht veröffentlicht. Seit dem Einzug in Weimar arbeitete er nicht mehr daran, las es aber oft den Freunden vor. Vor der Abreise nach Italien plante er eine erste Gesamtausgabe der „Schriften“ bei Göschen und versprach auch eine Fertigstellung und Veröffentlichung des „Faust“. Freilich zeigen die Erwähnungen, dass er in Rom einen neuen Plan fasste. Tatsächlich erschien 1790 in den „Schriften“ „Faust. Ein Fragment“, das in der Leserschaft ungeheures Aufsehen erregte. Kenner der vorgelesenen Szenen wie Wieland vermissten allerdings zwei eindrucksvolle Schluss-Szenen, eine Szene mit größtem Wutausbruch Fausts gegen Mephisto (die man deswegen heute Wut-Szene nennt) und eine Schluss-Szene mit offensten sexuellen Anspielungen Gretchens, offenbar die Kerker-Szene. Aber dieses Bedauern wurde nicht öffentlich. Das gilt auch für Wielands Bewertung des „Fragments“ als unzusammenhängendes Flickwerk. Ein sehr kritischer Leser war auch der Geschichtsprofessor Heinrich Luden, der 1806 ein langes Gespräch mit Goethe über den „Faust“ führte.1 Goethe war mit der Textarbeit für den „Faust I“ fast fertig, der dann 1808 erschien, und sprach aus der Kenntnis seiner neuen Fassung, Luden in Erinnerung an seine Freunde, die Romantiker in Jena und an ihre Diskussion darüber. Sie hatten mehrere Widersprüche in dem Text entdeckt. Die Romantiker gaben daher jeder Szene für sich eine symbolische Deutung, Luden zog die Konsequenz, jede Szene einzeln zu genießen, und Goethe grollte: „In der Poesie gibt es keine Widersprüche.“ Dabei waren diese Widersprüche evident: Faust berichtete, er habe seit zehn Jahren unterrichtet, ist also höchsten dreißig Jahre alt, ein noch junger Mann, aber nachher wird er um dreißig Jahre verjüngt, war also zuvor ein Greis von fünfzig bis sechzig Jahren, konnte also Genüsse nicht mehr ausschöpfen, die Mephisto in der Menschheits-Szene ihm verspricht. Auch der Erdgeist ist offenbar ein sympathischer Geist, aber in der Menschheits-Szene sagt Mephisto für sich: „Lass nur in Blend- und Zauberwerken / Dich von dem Lügengeist ← 1 | 2 → bestärken.“ Mephisto hat also einen Lügengeist aufgebaut, um in Kontakt mit Faust zu kommen. Im gleichen Monolog sagt Mephisto, dass er Faust mit allen Mitteln betrügen und ihm keinerlei Genuss verschaffen will (das zeigt er auch in den folgenden Gretchen-Szenen). In der „Hexenküche“ aber bemüht sich Mephisto um Genussfähigkeit und um größten Genuss für Faust, und das ganz offen. In den Gretchen-Szenen bemerkt man, dass Mephisto ein kleiner, fast machtloser Teufel ist, in der „Hexenküche“ ist er dagegen der Satan selber, der größte Zaubermittel anwendet, um Faust größten Genuss zu vermitteln. Das sind klare Widersprüche, die Luden bemerkt hatte, die aber die Unitarier leugnen, weil sie meist den Text des „Fragments“ aus den seltenen synoptischen Ausgaben2 gar nicht kennen.
2. „Faust I“:
So waren die Leser auf eine Fertigstellung des „Faust“ sehr gespannt, die 1808 erfolgte. Dieser galt als von Goethe so gewollter vollständiger Text, der in der Textgestalt genau auf „Faust. Ein Fragment“ aufbaut. Was der Römische Plan an Änderungen mit sich gebracht hatte, konnte man nicht erschließen. Deshalb kennen auch Faust-Forscher bis heute kaum die genaue Textgestalt des „Fragments“. Es gibt ja auch nur Neudrucke innerhalb von drei synoptischen Editionen. Eines bemerkten die Faust-Forscher sofort: „Faust I“ war kein vollständiger Text. Goethe sprach öfter von ihm als „Fragment“. Aus dramaturgischen Gründen musste zwischen den beiden Studierzimmer-Szenen ein anderes Bühnenbild erscheinen, und man merkte bald, dass da eine universitäre Disputation geplant war, auf dessen Doktorschmaus sich auch Mephisto (V.1711f.) bezieht. Die zweite große Lücke ist das Ende der „Walpurgisnacht“. Faust und Mephisto sind nicht die einzigen, die allmählich den Brocken bis zum Hexentanzplatz besteigen, von allen Seiten her kommen Hexen und Hexenmeister geflogen, die Zwischenhalte am Hang machen, um dann den Berg weiter zu ersteigen, bis zum Gipfel. Aber das erfährt man nicht, das bricht dann plötzlich ab, „Oberons Goldene Hochzeit“ wird mit Figuren gezeigt, die alle einen Vierzeiler beanspruchen. Es ist ein großer Maskenzug ohne jede Handlung und ohne jeden Faust-Bezug. Aber so hat Goethe es gewollt, die sogenannten Unitarier finden für alles eine symbolische Bedeutung.
Die Pluralisten gelten als kleinliche Krittler, etwa Friedrich Theodor Vischer. Dass ein zweiter Teil zu erwarten war, mit andern Abenteuern Fausts, das wird ← 2 | 3 → ja direkt gesagt, Aber wie in „Faust. Ein Fragment“ gibt es hier im „Faust I“ zwei verschiedene Faust-Figuren, zwei verschiedene Mephistos (einen kleinen machtlosen Teufel und den Satan höchstselbst). Es gibt zwei Erdgeist-Figuren, einen Lügengeist und einen sympathischen Welt- und Taten-Genius, der vor allem in der Natur wirkt. Man erfährt aber jetzt aus dem „Prolog im Himmel“, dass Faust „ein guter Mensch in seinem dunklen Drange“ ist, der sich „des rechten Weges wohl bewusst ist“. Es ist fraglos, dass Gott seine Wette gewinnen wird, Faust seine Wette ebenfalls. Er ist aber der Mann, der Gretchens Bruder tötet, der Gretchens Mutter durch einen giftigen Schlaftrunk umbringt, der das schwangere Gretchen sitzen lässt und im Grunde auch daran schuldig ist, dass Gretchen ihr Kind tötet und deswegen zum Tod verurteilt wird. Der ist mit dem besten Willen nicht als „ein guter Mensch in seinem dunklen Drange“ zu erklären, der „sich des rechten Weges wohl bewusst“ ist. Ihm genügt eine Nacht des Heilschlafs, um alles vergessen zu dürfen. So geht das nicht. Mehr noch als im „Faust. Ein Fragment“ werden hier zwei verschiedene Pläne zusammenredigiert, aber man weiß nicht, nach welchen Plänen jeweils einzelne Szenen zusammengefügt wurden. Es sieht ja so aus, als ob Goethe im „Faust I“ wörtlich auf dem „Fragment“ aufgebaut hat und dieses also auch auf dem einstigen „Ur-Faust“, von dem damals nichts Schriftliches bekannt war.
3. Der Nummernplan und der Buchstabenplan:
Eine ganze Reihe von Paralipomena ist mit Nummern versehen.: „ad n“. Das kommt daher, dass Goethe 1797 auf Anregung Schillers und Humboldts sein Textpaket des „Faust“ öffnete, alles abschreiben ließ und dann die Szenen durchnummerierte, um einen neuen Textzusammenhang zu schaffen. Das bezieht sich vor allem auf die Gretchen-Szenen, die einfach nicht, das sah er klar, so zum Römischen Plan passten. Einige Szenen wollte er behalten, andere neu schreiben, das heißt er wollte die ersten Gretchen-Szenen ersetzen. Aber diesen Vorsatz gab er bald wieder auf, vielleicht war er ihm zu anstrengend, vielleicht wollte er auch nicht auf die ersten Gretchen-Szenen verzichten. Aber man muss versuchen, aus den wenigen erhaltenen Nummern zu erschließen, wie dieser Faust-Text ausgesehen hätte. Die vorliegende Sekundärliteratur, von Erich Schmidt 1903, von Grumach 1957, Schulze 1970 und 1972, vor allem von Scheibe 1970 und 1972 ist praktisch ergebnislos, Scheibe gibt sogar zu, er habe aus Zeitmangel nicht die Arbeiten der letzten Jahre dazu lesen können. Daher eine erste Übersicht über die ersten Nummerntexte: ← 3 | 4 →
Die erste erhaltene Nummer ist „ad 6“ für das Par. 8:
„Und schleppe bei jedem freien Schritt
Das lange Kleid, die weiten Ärmel mit.“
Inhaltlich gehört das ans Ende von „Studierzimmer II“, als Mephisto dann Faust den Talar abnimmt und ihm dafür schlankere Kleider überreicht. Daraus ergibt sich folgender erster Teil des Nummernplans:
1.Prolog im Himmel
2.Nacht (Fausts Studierzimmer, bis zum Ostermorgen)
3.Vor dem Tor (Osterspaziergang)
4.Studierzimmer I
5.Disputation
6.Studierzimmer II.
Dann wäre Nr. 7 die „Hexenküche“. Danach folgen die Gretchen-Szenen, von denen man erst wieder die Nummern für 16e (die Valentin-Szene) und die Nummer für 16f (die Dom-Szene) kennt – die Reihenfolge entspricht jener in „Faust I“, ist aber unlogisch aus „Ur-Faust“ umgestellt, denn Valentin gehört zu „alle Verwandte“ Gretchens und muss ihre Ohnmacht im Dom miterleben und bewerten. Die Buchstaben nach den Nummern sind wohl erst nachträglich eingesetzt. Neu und selbständig wäre dann „Wald und Höhle“, wohl die Nummer 16 ohne Zusatzbuchstaben. Wenn man das probeweise einsetzt, wären die Nummern 8 bis 15 die teilweise ersetzten Gretchen-Szenen. Die erste Szene war Gretchens Kirchgang (Straße). Diese sollte wohl durch Par. 24 ersetzt werden: „Kleine Reichsstadt. Das Anmutige, Beschränkte des bürgerlichen Zustands. Kirchgang. Neugetauftes Kind. Hochzeit.“ Faust sollte also bei diesem „Kirchgang“ Gretchen in ihrer Welt erleben, bei einer Taufe (als Patin) und/oder bei einer Hochzeit (als Trauzeugin?). Strukturell würde diese Szene wohl dem Osterspaziergang ähneln. Das wäre also die Nummer 8.
Nicht mehr durch Mephistos Besuch sollte Gretchen dann Faust als künftigen Liebhaber sehen, sondern im Wasserspiegel bei einer Hexe in der Vorstadt, in der „Andreas-Nacht“. Diese Figur der Hexe war schon im Osterspaziergang vorbereitet (V. 837-883), die den Mädchen anbietet, den künftigen Geliebten im Wasserspiegel zu zeigen. Das wird im Par. 25 „Andreas-Nacht“ geplant: In einer ersten Szene würde Gretchen zu dieser Hexe geführt, die eben nur in der Andreas-Nacht (29. November) den Zauber vollführen kann. Das wäre dann Nr. 9. Aber Goethe plante zwei Szenen, eine „Doppelszene: Andreas-Nacht. Feld und Wiesen. Faust. Vorstadt oder Platz.“ Es braucht etwas Phantasie dazu, sich vorzustellen, dass Gretchen auf dem Heimweg aus der Vorstadt auf einem Platz ← 4 | 5 → Faust erneut sieht und in ihm den künftigen Geliebten erkennt. Das wäre dann die Nummer 10.
Vor der Gartenszene wären dann weitere unbekannte Mephisto-Szenen einzufügen, wohl als Nummern 12 und 13. Hans-Gerhard Gräf zitiert einen Szenenentwurf nach Friedrich Matthison3: „Mephistopheles entsteigt dem Schlunde der Hölle, gefolgt von einer Schar schwarzer Teufelchen, die ihn anfangs brutmäßig umwimmeln, sodann aber, einer nach dem andern, mündliche Verhaltensregeln erhalten und nun als Missionäre über den Erdball ausgesandt werden.“ Darunter werden also zwei Teufelchen auf Faust und Gretchen angesetzt. Der Nummer 12 folgt dann logisch die Nummer 13 „Zwei Teufelchen und Amor“ als Einleitung zur Garten-Szene, wie es im Text heißt. Dieser ausgeführte Text hat eine besondere Geschichte: Goethe schickte ihn am 11.4.1814 dem Fürsten Radziwill in Berlin zu. Dieser hatte Goethe in Weimar am 1.April besucht, drei Tage später vermerkt Goethe im „Arbeitstagebuch“: „Paralipomena zu Faust“. Das bedeutet doch wohl, dass er ältere Texte aus der Paralipomena-Tasche hervorholte und nach Berlin schickte, mit dem Vermerk: „Ich wünsche, daß die Scene Gartenhäuschen, in ihrer gegenwärtigen Form, der Musik mehr geeignet sein möge, als sie bisher in ihrem Laconismus gewesen. […] Noch eine andere Scene liegt bey, welche bestimmt ist, der Gartenscene vorauszugehen.“ Das ist zweifelsfrei die Szene „Zwei Teufelchen und Amor“, die dann direkt in die Gartenszene münden sollte, in welcher Faust und Gretchen sich ihre Liebe gestehen, diesmal aber kommentiert von dem Gott der himmlischen Liebe Amor und den Teufeln der irdischen Liebe.4 Wenn Goethe 1814 diesen Wunsch ausdrückt, den Text seines „Faust I“ endgültig zu erweitern, wäre also der Text von 1808 als nicht endgültig anzusehen. Aber in den folgenden Editionen des „Faust I“ hat Goethe offenbar diesen Wunsch vergessen. Für die Szene „Gartenhäuschen“ fügte Goethe für Radziwill dann ein Gesangsquartett ein. (Nummer 15).
Eine weitere Folgerung ergibt sich aus Nr. 6 für „Hexenküche“, die direkt auf „Studierzimmer II“ folgt. Dazwischen stehen noch im „Fragment“ die Schülerszene und „Auerbachs Keller“. Wenn es dafür keine eigenen Nummern gibt, fallen sie im Nummernplan weg. Dafür gibt es noch einen zweiten Beleg: Im Gedicht „Antepirrhema“5 wird ein größeres Textstück aus der Schülerszene übernommen:
„So schauet mit bescheidnem Blick
Des ewigen Webers Meisterstück, ← 5 | 6 →
Wie ein Tritt tausend Fäden regt,
[…]Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt etc.“
Das bedeutet, dass Goethe bei der Einarbeitung des Textstücks in das Gedicht die Vorlage, die Schülerszene nicht mehr im „Faust“ verwenden wollte, ähnlich wie er Textstücke der Valentin-Szene in „Wald und Höhle“ verwendete und damit klar machte, dass er im „Fragment“-Plan auf die Valentin-Szene verzichtete. Auf jeden Fall muss Nr. 16 „Wald und Höhle“ sein. Faust flieht also nach der Gartenszene von Gretchen weg, um ihr nicht zu schaden. Stattdessen geht er direkt danach mit Mephisto zur „Walpurgisnacht“, eindeutig Nr. 17, Damit ergibt sich eine Antwort auf die Frage, ob überhaupt Faust aus „Wald und Höhle“ zu Gretchen zurückkehren sollte, um sie dann tatsächlich zu gefährden. Die Antwort ergibt sich direkt aus dem Nummernplan: Mit der Nummer 17 (mit Buchstaben) folgt nämlich die „Walpurgisnacht“, die also direkt auf „Wald und Höhle“ folgt. Faust kehrt also in der Planung des Nummernplans nicht zu Gretchen zurück und richtet sie deswegen nicht zugrunde. So hätte Goethe im Nummernplan die Gretchenhandlung widerspruchsfrei in den „Faust I“ integriert. Die Szene „Wald und Höhle“ ist der einzige neue fertige Text im Nummernplan und steht so schon im „Fragment“ als Feststellung, dass Faust von „Wald und Höhle“ nicht mehr zurückkehrt. Allerdings zeigen dort die Szenen „Zwinger“ und „Dom“, dass Gretchen schwanger ist. Fallen im Nummernplan diese Szenen weg, ist Faust diskulpiert.
Aber dann änderte er seinen Plan wieder: Alle Gretchen-Szenen, selbst die in „Faust. Ein Fragment“ gestrichenen Szenen, wurden wieder aufgenommen, um sie zu erhalten, aber jetzt mit allen Widersprüchlichkeiten. Goethe musste dafür den Nummernplan erweitern, nämlich mit Buchstaben. Das ist dann ein weiterer Plan, der dann wieder mit der Szenenfolge von „Faust I“ übereinstimmt und scheinbar nur eine Erweiterung von „Faust. Ein Fragment“ darstellt. So ergibt sich logisch zuerst der Nummernplan selbst von etwa 1797:
1.Prolog im Himmel
Details
- Pages
- VI, 236
- Year
- 2015
- ISBN (PDF)
- 9783653053722
- ISBN (ePUB)
- 9783653971422
- ISBN (MOBI)
- 9783653971415
- ISBN (Hardcover)
- 9783631660478
- DOI
- 10.3726/978-3-653-05372-2
- Language
- German
- Publication date
- 2015 (March)
- Keywords
- Paralipomena Faust-Oper Nummernpläne Ur-Faust
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. VI, 236 S.