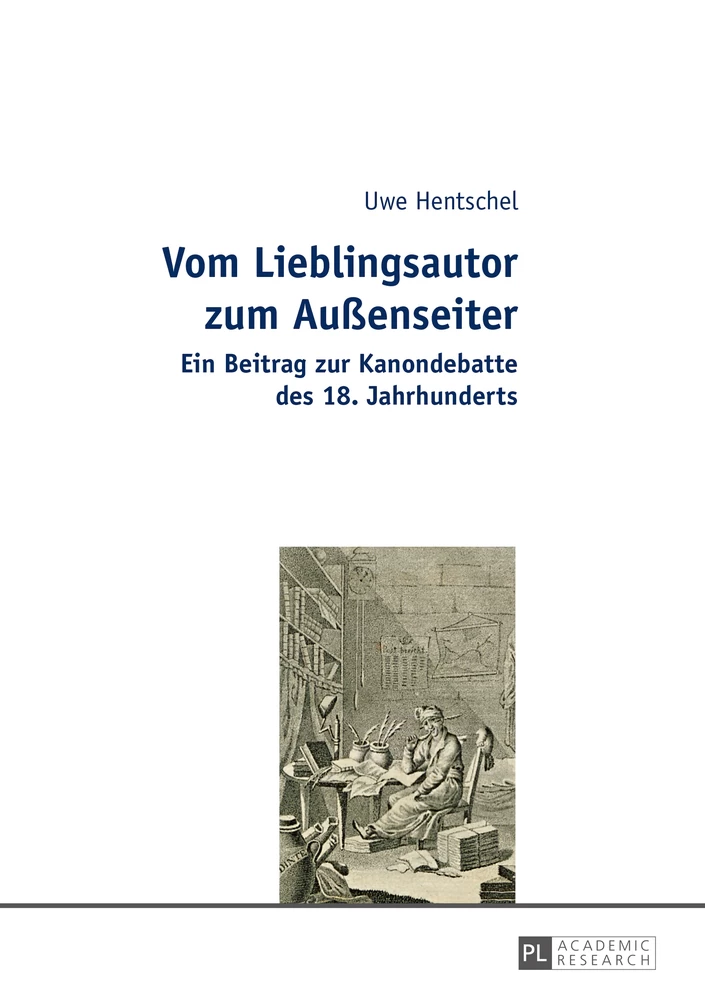Vom Lieblingsautor zum Außenseiter
Ein Beitrag zur Kanondebatte des 18. Jahrhunderts
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Kampf um das „Classenwesen“
- Die Querelle des Anciens et des Modernes
- Das Ringen um die ‚wahre‘ und die Ware Literatur
- Rückblick auf ein ‚goldenes‘ Zeitalter
- Berlin und Weimar im Streit um die Vorherrschaft auf dem Buchmarkt
- Johann Jakob Bodmer – der dichtende Patriarch
- Bodmers Aufstieg zum Literaturmäzen
- Klopstocks Auftritt in Zürich und Bodmers Abstieg zum (belächelten) Patriarchen
- Johann Christoph Rost – ein zu Unrecht vergessener Verserzähler
- Originelle Schäfererzählungen
- Zeitgenössische Kritik zwischen Begeisterung und moralischer Abweisung
- Im Schatten Wielands vergessen
- Christian Ludwig Liscow – der zu früh gekommene Pasquillant
- Goethes kritisches Urteil
- Vom Makel und Nutzen der Personalsatire
- Liscows begeisterte Fürsprecher
- Eine moderne Form öffentlicher Rede
- Ansätze einer Aufwertung im 19. Jahrhundert
- Johann Wilhelm Ludwig Gleim – der verkannte Briefschreiber
- Die vergessenen ‚Freundschaftlichen Briefe‘
- Zur Propagierung einer neuen Lebens- und Schreibkultur
- Eine Vorwegnahme von Gellerts Brieftheorie
- Das Ende des empfindsamen Briefes
- Christian Fürchtegott Gellert – der empfindsame Moralist
- Ein populärer Autor in der Kritik
- Für die Nachgeborenen ein Volksschriftsteller
- Gellerts Platz in der Literaturgeschichte
- Salomon Geßner – Modeautor mit „StubenMoral“
- Vom Malen idyllischer Landschaften
- Der Vorwurf der Wirklichkeitsferne
- Von der Schweiz- zur Idyllenbegeisterung und zurück
- Der Weg zum Vergessen
- Johann Georg Hamann – „Grillenfänger“ oder „Prophet“?
- Anführer einer ‚Sekte‘
- Von den Schwierigkeiten, einen Autor vor dem Vergessen zu bewahren
- Goethes Aufruf zu einer Werkausgabe
- Hamanns Platz in der Literaturgeschichte
- Scheffner, Heinse, Wieland – vom Makel erotischen Dichtens
- ‚Gedichte im Geschmack des Grecourt‘
- Wieland: Vom Tugendwächter zum Sittenverderber
- Scheffners ‚Bekenntnis‘ zur erotischen Dichtung
- Heinses Erotikon und Wielands Reaktion
- Wielands Verteidigung der ‚Comischen Erzählungen‘
- Garlieb Helwig Merkel – Aufklärer und Kunstverächter
- Mit den ‚Letten‘ zum Erfolg
- Mit den ‚Briefen an ein Frauenzimmer‘ gegen die ‚schöne‘ Literatur
- Begründer des deutschen Feuilletons
- Literaturverzeichnis
Ueberhaupt soll ja das Classenwesen nur ein kleiner Wink für die Kenner sein.1
Der Kampf um das „Classenwesen“
Was Zentrum ist und damit den Mittelpunkt geistesgeschichtlicher Zuwendung darstellt, und was zur Peripherie gehört, die aus dem kulturellen Gedächtnis ausgeblendet werden kann, wird immer wieder neu verhandelt werden müssen. Die Deutschen hatten sich für lange Zeit angewöhnt, in der Nachfolge von Gervinus und der nationalliberalen Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts von der Klimax Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik/Romantik zu sprechen, was dazu führte, dass bestimmte literarische Erscheinungen an den Rand gedrängt wurden oder mit Bezug auf die Gipfelleistungen von Schiller und Goethe abgewertet worden sind. Das Ergebnis war „eine Geschichtsschreibung der Sieger“.2 Ohne die Leistungen unserer klassischen Dichter schmälern zu wollen, so ist doch offensichtlich, wieviel man, da sich die Forschung zunächst auf sie orientierte, unbeachtet ließ.
Es hat lange gedauert, bis man sich z. B. wieder einem Gottsched zuwandte,3 den bereits Lessing wirkungsmächtig mit seiner bissigen Abfertigung in dem berühmt-berüchtigten 17. Literaturbrief in den Orkus der ← 9 | 10 → Literaturgeschichte versenkt hatte.4 Ähnliches ließe sich über Johann Christian Günther, Christian Ludwig Liscow oder Jakob Michael Reinhold Lenz sagen, die zunächst einer Beschäftigung für unwürdig gehalten wurden, weil Goethe sie in Dichtung und Wahrheit für charakterlich labil und so gänzlich unklassisch erklärte.5 Wie lange bedurfte es, um die Leistungen eines Georg Forster zu erkennen?6 Ihm schadete, dass er im Koalitionskrieg 1792 auf der anderen Seite stand als Goethe und sich zudem publizistischer Textformen wie dem Reisebericht bediente, der noch vor einem halben Jahrhundert für poesiefern gehalten und ästhetisch abgewertet wurde. Und so konnte in einer Sozialgeschichte der Literatur 1987 der Satz stehen: „Das Kernstück der zeitgenössischen Reiseliteratur ist Goethes Italienische Reise.“7 Sieht man einmal davon ab, ob Goethes Text überhaupt ein Reisebericht ist oder nicht eher ein autobiographisches Werk, das sich reiseliterarischer Mittel bedient,8 so zeugt doch eine solche Wertung von einer lang andauernden Ignoranz gegenüber einer Literatur, die als (spät-)aufklärerische zeitgleich neben der Klassik entstanden ist und wirkte.9 Solcherart Verwerfungen gab und gibt es. ← 10 | 11 →
Und wahrscheinlich ist noch so mancher kleine Schatz zu heben, auch wenn seit mehreren Jahrzehnten auf diesem vermeintlich randständigen Felde schon tüchtig gegraben wird, was beispielsweise die Konferenzbände zu August Lafontaine10 oder Friedrich von Matthisson11 aus jüngster Zeit eindrucksvoll belegen.
Außenseiter meint in diesem Sinne die Unbeachteten, Gescholtenen und Verworfenen, die den Kriterien einer Ästhetik, die sich an der Klassik orientierte, nicht entsprachen und es damit schwer hatten, in den Kanon aufgenommen zu werden, der sich im 19. Jahrhundert etablierte. Dass dies so war, ist evident und zudem materialreich beschrieben worden.12 Interessanter und nicht weniger aufschlussreich ist die Beschäftigung mit der Zeit, in der noch nicht unter nationalen Auspizien auf die Literatur zurückgeblickt, sondern im Vorfeld von Gervinus an einem (Prä-)Kanon gearbeitet wurde, ohne dass dies den Akteuren selbst bewusst gewesen wäre.13 Zu beschreiben ist ein „Prozeß der Auswahl literarischer Werke, denen eine musterhafte, normbildende, gewissermaßen zeitüberdauernde Kraft zuerkannt wird“.14 Das gesamte 18. Jahrhundert, angefangen von der Leipzig-Zürcher-Literaturdebatte bis zum Xenien-Streit, ist ein Ringen um solch einen Korpus gewesen ist,15 zumeist nur von Einzelpersonen oder kleineren Gruppen getragen und bezogen auf eine noch überschaubare Literaturgesellschaft, jedoch von großer meinungsbildender Wirkung – bis in das 19. Jahrhundert hinein.
Die Kanonforschung, insbesondere was den Untersuchungszeitraum vor Einsetzen der deutscher Selbstfindung im Umkreis der Nationalromantik ← 11 | 12 → betrifft, ist erst in ihren Anfängen begriffen.16 Eine erste bedeutsame Annäherung ist mit dem Sammelband Der Kanon im Zeitalter der Aufklärung aus dem Jahre 2009 gelungen.17 Abgesehen von einigen größeren Arbeiten zur Debattenkultur im 18. Jahrhundert,18 fehlt es noch immer an der Beschreibung von Kanonisierungspraktiken in Bezug auf einzelne Autoren. Erst mit der Erforschung dieser In- und Exklusionsvorgänge kann eine verlässliche Kanontheorie entstehen.19
Die Querelle des Anciens et des Modernes
Der wohl entscheidende, weil grundsätzliche Streit wurde darüber ausgetragen, ob bzw. inwieweit die antike Kunst als mustergültig anzusehen sei.20 Wer den Mut aufbrachte, sich von den Vorgaben zu lösen, konnte damit rechnen, als ein Neuerer zu gelten.
Als Eugen Wolff 1886 für eine Literatur votierte, die sich den Erscheinungen modernen Lebens zuwendet – er nennt sie „die Moderne“ –, ist es noch immer das Vorbild der Klassik, nun auch in der Form der ihm gegenwärtigen „Epigonen-Klassicität“21, von der man sich absetzen musste:22 ← 12 | 13 →
Ist unser jetziges Kunstideal und das höchste Zukunftsideal noch gleich demjenigen, welches man bisher in der Antike als klassisch feierte? Treten wir in einen Tempel, unmittelbar vor das Bild der antiken Göttin hin: alsbald werden wir in Andacht niederknieen, wortlos, wunschlos, gedankenlos …. Da tönt von Aussen ein Tosen und Brausen an unser Ohr, erschreckt fahren wir aus unserer Andacht auf, wir stürmen hinaus: Und siehe! Ueberall Bewegung, Handlung, das Bild des modernen Lebens. Nein, die stille, kalte Antike ist nicht mehr unser höchstes Ideal.23
Möglicherweise ist hier etwas zuende gekommen, was nahezu exakt zweihundert Jahre zuvor begonnen hatte: das Abschiednehmen von der Antike als bewertungsrelevanter Größe.
1687 hatte Charles Perrault in einer Sitzung der Académie français das Siècle de Louis le Grand mit dem Augustinischen Zeitalter verglichen und es ihm an die Seite gestellt – damals ein Affront. Bernard Le Bovier de Fontenelle unterstützte ein Jahr später Perrault mit der Schrift Digression des anciens et des modernes, in der er dessen These ausführlich begründete. Er beginnt mit einem naturgeschichtlichen Vergleich. Die Bäume, die es früher gegeben habe, seien keineswegs größer gewesen als die heutigen, denn die „Natur hat einen bestimmten Stoff zur Verfügung, der immer der gleiche ist, den sie in tausend Formen unablässig um und um wendet und aus dem sie die Menschen, Tiere und Pflanzen bildet“.24 Das heißt: „Die Jahrhunderte bewirken keinen naturgegebenen Unterschied zwischen den Menschen […].“25 Ein solcher ergebe sich allein durch die verschiedenen Umgebungsvoraussetzungen, unter denen der Einzelne wirke; sie können ihm Schranken setzen oder förderlich sein.26 Das Entscheidende sei aber die menschliche Fähigkeit der Wissensanreicherung über Generationen und Jahrhunderte hinweg. „[…] wir haben von anderen übernommene Erkenntnisse, die sich denen aus unserem eigenen Erfahrungsschatz hinzugesellen, und wenn wir den ursprünglichen Erfinder übertreffen, so hat er selbst uns dabei geholfen […].“27 ← 13 | 14 →
Fontenelle hatte beschrieben, was man heute mit dem Begriff Fortschritt umreißt. Natürlich blieben seine Aussagen nicht unwidersprochen. Mächtig war die Partei derer, die nach wie vor allein in der Antike „die Quellen des guten Geschmacks“28 suchten; für sie lebten allein dort die Dichter und Denker, „die dazu bestimmt seien, alle anderen Menschen aufzuklären“; „nur in dem Maße habe man Geist, wie man sie bewundere“.29
Das gesamte 18. Jahrhundert wurde bestimmt von der Querelle des Anciens et des Modernes. Besonders nachdrücklich führte man den Streit auf dem Felde der Kunst, da hier Fortschritt, so wie er sich in Wissenschaft und Technik nachweisen ließ, nicht plausibel begründet werden konnte, selbst in Frankreich nicht, wo es Perrault versucht hatte. Denn mit dem Ende der Regierung Ludwig XIV. und dem Tod seiner Hofkünstler Racine, Corneille und Moliere war die Literatur ohne große Nachfolger geblieben. Die starke Partei der Altertumsfreunde mit dem Theoretiker Nicolas Boileau an der Spitze empfahl weiterhin die antiken Muster. In Deutschland wuchs mit Gottsched sogar ein weiterer bedeutender Verfechter des Klassizismus heran:30 „Indessen kann ich es nicht unterlassen, […] zu gestehen, daß ich im Absehen auf die Beredsamkeit und die Poesie, die alten Griechen und Römer weit höher halte, als alle heutige Scribenten, so viel mir deren bekannt sind.“31
Gottsched veröffentlichte zwar 1738 Fontenelles Abhandlung der Frage, vom Vorzuge der Alten oder Neuern im Absehen auf Künste und Wissenschaften, machte jedoch bereits in der Vorrede des Uebersetzers deutlich, dass er dessen Thesen ablehnte: „Da aber Herr von Fontenelle gar zu sehr die Partey der Neuern gehalten, und die Alten lächerlich zu machen gesuchet: So habe nicht unterlassen können, in einigen Anmerkungen die Ursachen anzuzeigen, warum ich nicht seiner Meynung beypflichten können.“32 ← 14 | 15 →
Schien die Fortschrittsthese im Bereich der Dichtung zunächst auch nicht durchsetzbar zu sein, so erbrachte doch die Auseinandersetzung, die darüber geführt wurde, in der Folge tiefere Einsichten in das Wesen der Kunst. Den Unterschied zu anderen Formen geistiger Tätigkeit sah bereits Fontenelle darin, dass „Beredsamkeit und Dichtkunst […] nur eine bestimmte, recht beschränkte Zahl von Erkenntnissen“ erforderten; zudem hingen diese Künste „hauptsächlich von der lebhaften Einbildungskraft ab“.33 Diese brauche „keine lange Folge von Erfahrungen und auch keine große Mengen von Regeln, damit sie die ganze Vollkommenheit erreicht, deren sie fähig ist“.34 Fontenelle erweist sich hier als früher Vertreter einer modernen Literaturauffassung. Indem er stärker auf Gefühl und Phantasie setzt, spricht er sich gegen eine Regelpoetik aus, welche mit Hilfe überkommener formaler Kriterien klassizistische Kunstwerke präjudiziert. Damit ist ein literaturgeschichtlich bedeutsamer Paradigmenwechsel eingeleitet, der sich im deutschen Kulturraum mit der Debatte um eine zeitgemäße Kunst zwischen dem Klassizisten Gottsched und seinen Gegnern, den Zürchern Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger, vollzog. Veranlasst wurde sie durch mehrere Schriften der beiden Schweizer Autoren zu Beginn der vierziger Jahre, in denen sie ein literarisches Konzept vorstellten, das der dichterischen Phantasie größere Freiräume ließ. Breitinger schrieb 1740 mit deutlichem Bezug auf Gottsched eine eigene Critische Dichtkunst,35 und Bodmer veröffentlichte im gleichen Jahr eine Critische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie und dessen Verbindung mit dem Wahrscheinlichen, die eine Vertheidigung des Gedichtes Joh. Miltons von dem verlohrnen Paradiese enthielt. Insbesondere diese Übersetzung Bodmers brachte die Gegensätze zwischen Gottsched und den Zürchern zutage. Stellte für diese Miltons Paradise lost ein Muster epischen Dichtens dar, war dagegen für Gottsched dieses Werk, das einem christlichen Wunderglauben huldigte, eine unwahre und damit aufklärungsschädliche literarische Arbeit. Bodmer verteidigte, dass „Milton die Engel in cörperlichen und zwar in menschlichen Gestalten vorgestellet ← 15 | 16 → hat“, damit, dass dieser den Zweck der Dichtkunst mit Recht darin sehe, „die Phantasie mit wohlerfundenen und lehrreichen Vorstellungen auf eine angenehme Weise einzunehmen“.36
Von überall her wuchsen den Schweizern die Anhänger zu. Georg Friedrich Meier und Alexander Gottlieb Baumgarten entwickelten in Halle eine Ästhetik, in der der Sinnlichkeit erstmals eine wichtige Funktion im Schaffen und Aneignen von Kunstwerken beigelegt wurde. Die anakreontischen Dichter mit ihren Liedern von Wein, Weib und Gesang gaben dem Sinnlichen einen weiten Spielraum, und Klopstock war es dann vergönnt in Leipzig, am Wirkungsort des Präzeptors Gottsched, die ersten Gesänge seines christlichen Epos Der Messias zu veröffentlichen.
Klopstock war es dann auch, der mit einem neuartigen freirhythmischen Sprechgestus das strenge Metrum des Alexandriners sprengte und seine Zeitgenossen auf nationale Stoffe hinwies und so zum Vorbild für die Stürmer und Dränger avancierte. Spätestens jetzt, so schien es, hatte die Querelle in Deutschland zu einer Entscheidung geführt. Im Namen des Originalgenies wurden die antiken Muster in ihrer Wertigkeit relativiert, der germanische „Hain“ verdrängte den olympischen „Hügel“,37 das Herz den Verstand, die Originalpoesie das Regelwerk.
Nicht weniger deutlich zeigte sich der Paradigmenwechsel auf dem Gebiete der Dramatik, wo Gottsched seine klassizistischen Reformbemühungen in einen eigenen Dramentext, den Sterbenden Cato, münden ließ und mit der Theaterprinzipalien Friederike Neuber die praktische Umsetzung seiner Propädeutik betrieb. Als Gottsched 1724 nach Leipzig gekommen war, hatte er ein Kulturniveau vorgefunden, das sich weit unter dem Wohlanständigen bewegte:
Vorzeiten redeten die Poeten die Sprache der Götter; itzo sprechen sie wie Gassenjungen. Sonst trug sie Pegasus über Berge und Hügel weg, itzo kriechen sie wie Schnecken im Staube. Sonst wohnte Apollo auf dem erhabenen Parnaß, itzo will man uns bereden, daß er in ein sumpfiges Thal gezogen sey.38 ← 16 | 17 →
Neben den seichten italienischen Opern39 waren es vor allem „schwülstige und mit Harlekins-Lustbarkeiten untermengte Haupt- und Staatsaktionen“, die Gottscheds Zorn erregt hatten und ihn zu reformerischem Handeln bewegten.40 Er antwortete 1730 auf diese Verwahrlosung der Kultur mit einer Regelpoetik, die sich an den antiken Vorgaben und den Werken der Franzosen des 17. Jahrhunderts orientierte – ein Entschluss, der auch heute angesichts der Ausgangssituation41 gewürdigt werden muss.
Gottscheds Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen fußt auf dem Konzept der Naturnachahmung; die Fabel müsse zumindest eine „hypothetische Wahrscheinlichkeit“42 besitzen. Denn erst, wenn der Leser oder Zuschauer davon überzeugt sei, dass die Handlung auch wirklich geschehen sein könne, würde er sich erzieherisch beeinflussen lassen. Wahrscheinlichkeit allein reiche aber nicht aus, der Poet müsse sich eines moralischen Lehrsatzes bedienen, den er durch eine Handlung exemplarisch ← 17 | 18 → zu veranschaulichen habe.43 Auf diese Weise könne man den Menschen eine abstrakte Lehre wirkungsvoll näherbringen. Im Trauerspiel sollte „eine wichtige Handlung vornehmer Personen […] nachgeahmet und vorgestellet“ werden. „Die Tragödie ist […] ein Bild der Unglücksfälle, die den Großen dieser Welt begegnen. […] Sie ist eine Schule der Geduld und Weisheit, eine Vorbereitung zu Trübsalen, eine Aufmunterung zur Tugend, eine Züchtigung der Laster.“44
Verlangt werden vom Tragödienschreiber die Einhaltung der drei Einheiten (des Ortes, der Zeit und der Handlung), strenge Mimesis, eine eindimensionale Fabel mit einer nachvollziehbaren Kausalität, das Erzielen kathartischer Wirkung und die Beachtung der Ständeklausel – kurzum: Der Dichter ist gehalten, Aristoteles’ Poetik entsprechend den Bedürfnissen der Aufklärung auszulegen und sich zudem an den antiken und klassizistischen Musterdramen zu orientieren.45
Gottscheds literaturgeschichtliche Bedeutung besteht nun nicht allein darin, dass er ein grundlegendes Regelbuch erstellt hat, auf das sich nachfolgende Dichtergenerationen beziehen konnten, sondern vor allem in dem Sachverhalt des Praxisbezugs. Die festgesetzten Vorgaben sollten das Theater erreichen. Zu diesem Zwecke entstand ein sechsbändiges Werk, Die Deutsche Schaubühne nach den Regeln und Mustern der Alten (Leipzig 1746–1750), eine Handreichung von spielbaren Werken für die Theater. Gottsched beließ es nicht bei Übersetzungen, er bot auch Originalstücke an. Das wohl meistgespielteste Drama aus seiner Feder ist Der sterbende ← 18 | 19 → Cato, das er 1732 seiner Critischen Dichtkunst nachschob. Gottsched erläutert in der Vorrede, wie die Tragödie entstanden sei. Er habe sich die unlängst erschienenen Cato-Dramen des Franzosen Michel Chrétien Deschamps und des Engländers Joseph Addison „zu Nutze gemachet“,46 was heißt, dass er aus beiden Werken entnommen hat, was ihm annehmbar erschien, in der Hoffnung, so das mustergültige Werk schlechthin schaffen zu können. Den Engländer fand er im Gestalten der Charaktere und „in Gedanken und Ausdrückungen sehr glücklich“47, zudem sei es ihm gelungen, „die Sitten der Menschen glücklich nachzuahmen“,48 jedoch versagte er wie alle Engländer vor ihm, „was die ordentliche Einrichtung der Fabeln anlangt“.49 Hierin wiederum überzeuge der Franzose Deschamps.
Obgleich sich Gottsched durchaus bereit zeigte, sich der englischen Literatur zu öffnen und demnach nicht so borniert war, wie ihn z. B. ein Lessing sehen wollte, so blieben für ihn doch die antiken Dichter und deren französische Adepten die maßstabsetzenden Größen.
Die Partei der Neueren, die sich im fernen Zürich konstituiert hatte, etablierte sich auch in Gottscheds unmittelbarem Leipziger Umfeld. Gellert hatte begonnen in der Nachfolge von Philippe Destouches, Pierre Carlet de Marivaux und Pierre Claude Nivelle de La Chaussée Lustspiele zu schreiben, in denen der Bürger in seiner Lebenswelt agiert,50 jedoch nicht, um ihn im Sinne der Ständeklausel dem Spotte preiszugeben, sondern ihn nun mit seinen empfindsamen Tugenden zu zeigen (Das Loos der Lotterie, 1746 u. Die zärtlichen Schwestern, 1747). Indem er auf diese Weise das Drama verbürgerlichte, verließ Gellert die normierte Gattungstradition; er hatte wie alle Neueren erkannt, dass die gegenwärtigen Erfordernisse, denen sich die Literatur stellen musste, die Aufnahme und Fortführung antiker Formvorgaben verbot. Und so verteidigt Gellert 1751 in seiner ← 19 | 20 → Promotionsschrift Pro Comoedia Commovente Commentatio seine Entscheidung für das neue Lustspielgenre vehement:
Wenn man keine andre Komödien machen darf, als solche, wie sie Aristophanes, Plautus und selbst Terenz gemacht haben; so glaube ich schwerlich, daß sie den guten Sitten sehr zuträglich seyn, und mit der Denkungsart unsrer Zeiten sehr übereinkommen möchten. Sollen wir deswegen ein Schauspiel, welches aus dem gemeinen Leben genommen und so eingerichtet ist, daß es zugleich ergötze und unterrichte, als welches der ganze Endzweck eines dramatischen Stücks ist; sollen wir, sage ich, es deswegen von der Bühne verdammen, weil die Erklärung, welche die Alten von der Komödie gegeben haben, nicht völlig auf dasselbe passen will?51
Bekanntlich geht Lessing, indem er „wahre Komödien“ verfasst, noch einen Schritt weiter. Diese sollen „so wohl Tugenden als Laster, so wohl Anständigkeit als Ungereimtheit schildern, weil sie eben durch diese Vermischung ihrem Originale, dem menschlichen Leben, am nächsten kommen“.52 Sein Lustspiel Minna von Barnhelm wird dann erstmals ein zeitgenössisches politisches Ereignis, den Siebenjährigen Krieg, zur stofflichen Grundlage eines Dramas neuen Zuschnitts wählen.
Im selben Jahr, 1767, ist es dann nochmals Gellert, der, die Argumente Fontenelles aufgreifend, davon ausgeht, „daß die Natur in unsern Tagen noch eben die Fähigkeit austheilet, die sie vor tausend und mehr Jahren den Sterblichen schenkte“53, und dass es demzufolge an den Zeitgenossen selbst liege, wenn sie nicht mit den antiken Künstlern gleichzögen oder sie gar überträfen. Gellert sieht die Ursache des Scheiterns in einer falsch verstandenen Nachahmungslehre. Anstatt die Alten zu kopieren, sollten die Nachgeborenen lernen, die Natur wie jene zu begreifen: „Die Natur war ihre Lehrmeisterinn, und so soll sie auch die unsrige seyn!“54 Im Modus ← 20 | 21 → dieser Aneignung müsse man mit den Alten in einen Wettstreit treten – mit der Maßgabe, „sie zu übertreffen“.55
Als Gellert diese Rede in Leipzig hielt, war Gottsched, der Präzeptor der klassizistischen Kunstdoktrin, gerade verstorben. Seit den vierziger Jahren hatten sich nicht nur im fernen Zürich mit Bodmer und Breitinger Verfechter einer neuen Literatur eingestellt, sondern auch in Berlin, Halle, Leipzig und Dresden. Dennoch bzw. gerade deshalb hatte Gottsched 1751 die Critische Dichtkunst nochmals in einer vierten, sehr vermehrten Auflage erscheinen lassen, ohne dass er darin von seinen Grundsätzen abgerückt wäre. Justus Friedrich Wilhelm Zachariä, einst dessen Anhänger, nun auch sein Kritiker, dichtete 1755 über den sächsischen Literaturpapst:
In Leipzig thront und herrscht ein blinder Aristarch,
Der Reime Patriot, der Prosa Patriarch.
Vergebens zeichnen ihn des strengen Satyrs Schläge,
Er achtet Striemen nicht und bleibt auf seinem Wege […].56
Mit Lessing stand Gottsched in dessen letzten Lebensjahren der mächtigste Gegner gegenüber. Nicht zuletzt der Schlag, den der junge Aufsteiger und Begründer des Bürgerlichen Trauerspiels in dem berühmten Siebzehnten Briefe, die neueste Literatur betreffend, gegen den schon angeschlagenen, fast sechzig Jahre alten Mann führte, war wohl (mit-)entscheidend für dessen literaturgeschichtliche Ausgrenzung bis in das 20. Jahrhundert hinein:
‚Niemand‘, sagen die Verfasser der Bibliothek [der schönen Wissenschaften und freyen Künste, Bd. 3, St. 1, S. 85], ‚wird leugnen, daß die deutsche Schaubühne einen großen Teil ihrer ersten Verbesserung dem Herrn Professor Gottsched zu danken habe.‘
Ich bin dieser Niemand; ich leugne es gerade zu.57
Mit dieser apodiktischen (und durchaus ungerechtfertigten) Verurteilung der Person,58 die wie keine andere in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ← 21 | 22 → für das (klassisch) Alte stand, geht die Suche nach dem Neuen einher. Entscheidend dabei ist die Kritik an der allgegenwärtigen Frankophilie und die Hinwendung zur angelsächsischen Kultur. Gottsched habe Corneille, Racine u.a. zu Vorbildern erklärt, „ohne zu untersuchen, ob dieses französierende Theater der deutschen Denkungsart angemessen sei, oder nicht.“59
Lessing nutzt imagologische Stereotype, wenn er den Franzosen „das Artige, das Zärtliche, das Verliebte“ und den Engländern „das Große, das Schreckliche, das Melancholische“ zuweist, um deutlich zu machen, dass allein die Mentalität der Letzteren dem Wesen der Deutschen entspricht. „Wenn man die Meisterstücke des Shakespear […] übersetzt hätte, ich weiß gewiß, es würde von bessern Folgen gewesen sein, als daß man sie mit dem Corneille und Racine so bekannt gemacht hat.“60
Es sollte nur wenige Jahre dauern, bis Wieland und Johann Joachim Eschenburg bereitstellten, was Lessing gefordert hatte. Deren Übersetzungen bildeten dann die Voraussetzung für die Shakespeare-Begeisterung im Sturm und Drang der siebziger Jahre. Mit Worten, die dieser Euphorie bereits sehr ähneln, ermisst Lessing das Wirkungspotential des Engländers: „[…] ein Genie kann nur von einem Genie entzündet werden; und am leichtesten von so einem, das alles bloß der Natur zu danken zu haben scheinet […].“61
Der 17. Literaturbrief ist ein wichtiges Dokument des Aufbruchs, in dem das Paradigma Gottsched und der (französische) Klassizismus im Namen der Natur und mit Verweis auf dass Genie Shakespeare verabschiedet werden. Dass dieser Prozess der Ab- und Zuwendung ein längerer gewesen ist, zeigt der Text zudem. Denn Lessing beurteilt das englischen ← 22 | 23 → Genie immer noch „nach den Mustern der Alten“ – mit dem Ergebnis, dass „der Engländer […] den Zweck der Tragödie fast immer“ erreiche, „so sonderbare und ihm eigene Wege er auch wählet“, der Franzose dagegen „fast niemals, ob er gleich die gebahnten Wege der Alten betritt“.62
Der Aufbruch, den der 17. Literaturbrief so deutlich macht, ist auch ein literaturgesellschaftlicher gewesen, der von Bodmer, Gellert, Klopstock und auch von vielen Minores gleichermaßen mitgetragen wurde und an den sich noch Goethe 1811 erinnern sollte, wenn er in Dichtung und Wahrheit von einer „literarische[n] Epoche“ schrieb, die „sich aus der vorhergehenden durch Widerspruch“63 entwickelt habe.
Indem man sich allmählich vom klassisch Normativen abwandte und die Regelpoetiken hinter sich ließ, dem Gefühl, der Phantasie und Einbildungskraft einen größeren Spielraum zugestand, neue Ausdrucksformen entwickelte und aktuelle und vor allem einheimische Stoffe aufgriff – sich also in eine weithin größere Gestaltungsfreiheit entließ, musste sich auch eine Unsicherheit in der Bewertung des Neuen einstellen.
Details
- Pages
- 314
- Year
- 2015
- ISBN (PDF)
- 9783653051377
- ISBN (ePUB)
- 9783653975246
- ISBN (MOBI)
- 9783653975239
- ISBN (Softcover)
- 9783631657829
- DOI
- 10.3726/978-3-653-05137-7
- Language
- German
- Publication date
- 2015 (January)
- Keywords
- Deutsche Literaturgeschichte 18. Jahrhundert Literarischer Kanon Literaturgesellschaft Literaturgeschichtsschreibung
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. 314 S.