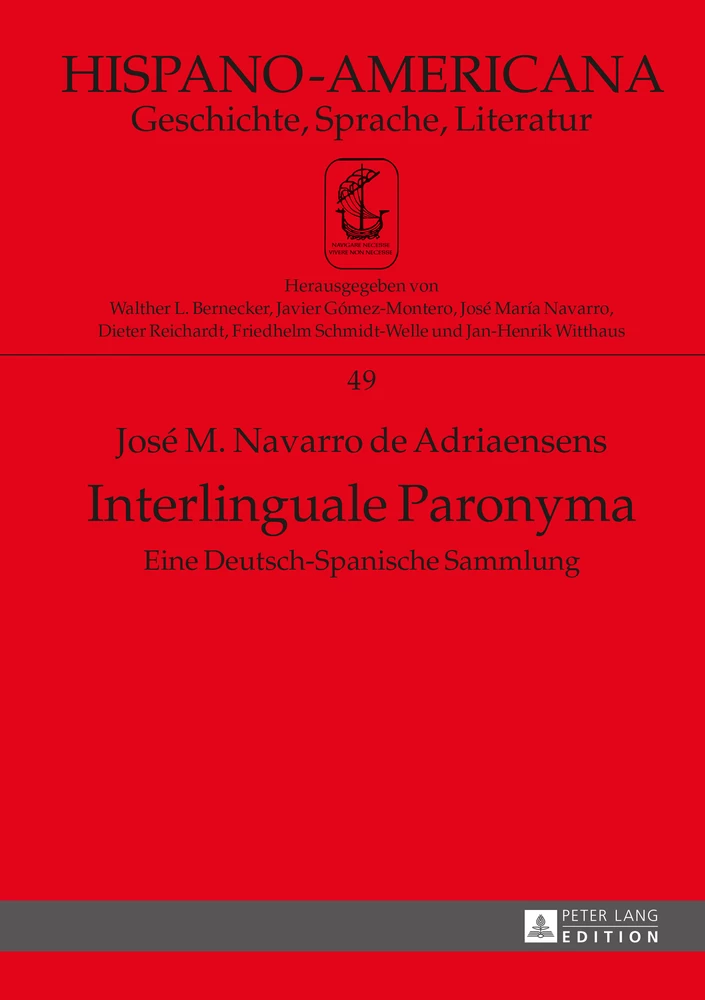Interlinguale Paronyma
Eine Deutsch-Spanische Sammlung
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- II. Vorwort
- III. Interlinguale Paronyma
- IV. Übersicht der verwendeten Abkürzungen (Deutsch)
- V. Übersicht der verwendeten Abkürzungen (Spanisch)
- VI. Bibliographie
- VII. Auf ein Wort
Ein wichtiges Thema in dem Bereich der kontrastiven Lexikologie und auf dem Gebiet der Fremdsprachendidaktik sowie der Traduktologie bilden Wortpaare aus zwei verschiedenen Sprachen, in unserem Fall Deutsch – Spanisch, mit relativer Homophonie und Homographie, jedoch unterschiedlicher Bedeutung in jeder Sprachen.
Seit langem beschäftigt sich die komparative Lexikologie mit diesem Thema, so auch Marc Koessler und Jules Derocquigny in ihren Veröffentlichungen „Les faux amis ou les Trahision Du (sic) Vocabulaire Anglais“ und „Les Pièges Du Vocabulaire Anglais“ (1928)1.
Trotz der Auseinandersetzungen vor allem über das Oxymoron ‚faux amis‘ hat es sich verbreitet und wurde in vielen Sprachen übersetzt und verwendet. Das Merkmal ‚homophonisch/ homographisch‘ soll nicht allein über die entscheidenden Auswahl der Paradigmen bestimmen.
Bei den interlingualen Paronyma greifen wir oft auf die Etymologie zurück, auch wenn sie nicht immer die richtige Lösung liefert. In einigen Beispielen stellen wir fest, dass diastratische Funktion wichtiger als die lexikalische Bedeutung ist, selbst die Hauptfunktion der Aussage übernimmt. Ein Beispiel: Dt. Appendizitis (Med.) entspricht dem spanischen ‚apendicitis‘ (Med. und andere Synonyma). Bei der Anzahl an Synonymen ist hier darauf hinzuweisen, dass die Verwendung wenig geläufig ist. So z.B. für ‚apendicitis‘, ‚apéndice vermicular del ciego‘ (Med.).
Als didaktisches Problem sollen hier Paronyma erwähnt werden, die eine formale Ähnlichkeit aufweisen, aber eine sehr unterschiedliche Bedeutung auf Deutsch bzw. Spanisch haben. Das deutsche Wort ‚Rakete‘ (auf Span. ‚cohete‘) würde wörtlich übersetzt auf Spanisch, ‚raqueta‘2 bedeuten, heißt aber, ‚Tennisschläger‘. ← 7 | 8 →
Bei der Untersuchung der Paronyma (Deutsch/ Spanisch) soll auch die wichtige Arbeit der Linguisten Gerd Wotjak und Ulf Herrman „ Kleines Wörterbuch der falschen Freunde“ Deutsch-Spanisch, Spanisch-Deutsch berücksichtigt werden.3
Wotjak beschäftigt sich zunächst mit den semantischen ‚falschen Freunden‘ (FF) und erstellt nach eigenen Auswahlprinzipien ein deutsch-spanisches Wörterverzeichnis. Hierbei stellt er fest: Je geringer der Bedeutungsunterschied zwischen zwei Termini ist, umso größer die Gefahr, eine falsche Wortwahl zu treffen. Diese Unsicherheit ist eher ein didaktisches als ein linguistisches Dilemma. In den Sprachen Deutsch/ Spanisch ist die Anzahl der zweisprachigen ‚Wortpaare‘, die nur geringe lexikalische Abweichungen, aber große Bedeutungsunterschiede aufweisen, nicht sehr hoch.
Erst eine fundierte Analyse, die zu der Unterscheidung der jeweiligen Termini mit ihrer ähnlichen Form, aber unterschiedlichen Bedeutung, verschafft uns Klarheit über die adäquate, kontextuelle Verwendung. Das Veralten einiger Ausdrücke muss bei diesem Problem Berücksichtigung finden.
Noch heute sind diese und spätere Arbeiten des Hispanisten Wotjak eine große Hilfe.
In den letzten Jahrzehnten erleben wir die starke Präsenz der Technik und ihrer Sprache im Alltag. Es ist nicht leicht, die richtige Dosierung zwischen gemeinsprachlichen und alltagssprachlichen Ausdrücken für ein allgemeinsprachliches Wörterbuch zu finden. Breitkreuz/ Wiegand schlagen in ihrer Arbeit4 (1989: 100f) den Terminus diaphasisch vor.
Bei der Frage nach der Terminologie bietet uns Jürgen Mertens in seinem Werk, „Die sogenannten faux amis in schriftlichen Textproduktionen von Lernern des Französischen der Sekundarstufe I“5, eine beachtliche Untersuchung über Fachterminologie sowie eine kritische Auffassung über den Begriff und die Funktion des Terminus bei Koessler und Derocquigny in ihrem gemeinsamen ← 8 | 9 → Werk (S. 26–55)6. Letztere Autoren liefern einen ironischen Standpunkt, den Mertens zitiert (Op. cit. S. 26–27) und wir hier kurz zusammenbringen:
Vom Standpunkt des Übersetzers: „Il est victime de la ressemblance verbal qu’offrent avec notre vocabulaire certains mots anglais d’origine latine et française, et ne s’avise pas que la similitude de forme n’entraine pas nécessairement la similitude de sens. En présence de deux mots, qui de fait de leur communauté d’origine, semblent avoir été créé a l’image l’un de l’autre. Le traducteur conclut automatiquement du même au même et commet un quiproquo c’est a dire un faux sens, voire un contresens.“
Mit Sicherheit bleibt der Terminus ‚faux amis‘ als meist benutzter in vielen Übersetzungen. Ein besonderes Problem bei der Untersuchung der interlingualen Paronyma liegt bei der Unterscheidung zwischen den ‚faux amis‘ in der Umgangssprache und in der Fachsprache. Mertens erwähnt hier den wichtigen Beitrag von Breitkreuz und Wiegand über dieses Problem.7
Details
- Pages
- 130
- Publication Year
- 2016
- ISBN (Softcover)
- 9783631638651
- ISBN (PDF)
- 9783653065435
- ISBN (MOBI)
- 9783653997026
- ISBN (ePUB)
- 9783653997033
- DOI
- 10.3726/978-3-653-06543-5
- Language
- German
- Publication date
- 2015 (December)
- Keywords
- Falsche Freunde Traduktologie Fremdsprachendidaktik Lexikologie
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. 130 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG