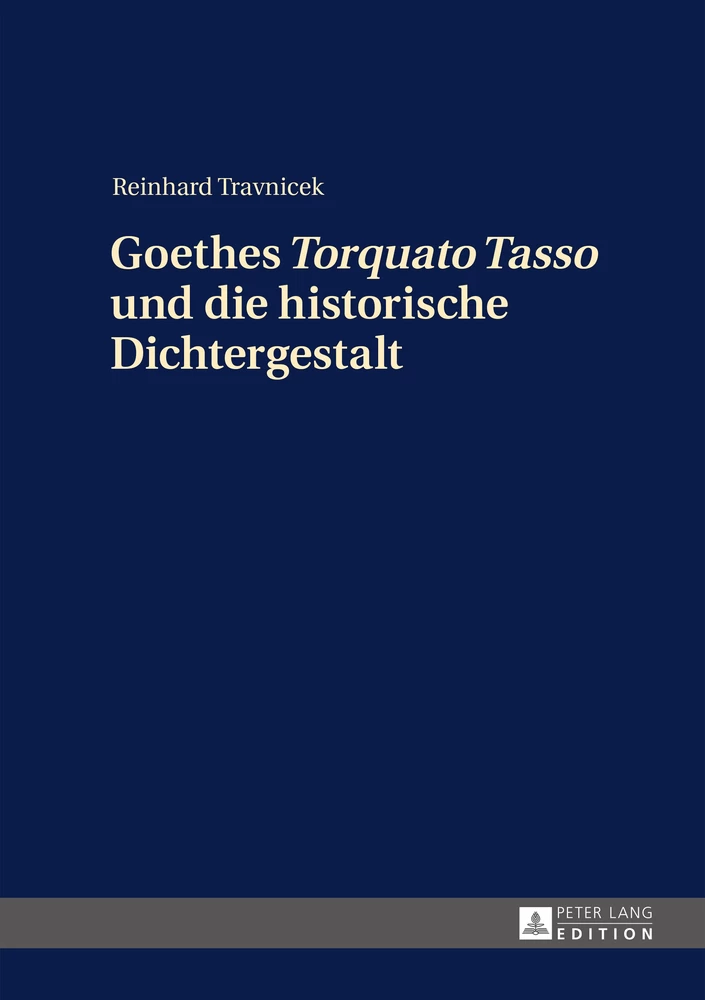Goethes «Torquato Tasso» und die historische Dichtergestalt
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- 1. Die Wiederkunft Arkadiens
- 1.1 Bukolische Tradition und modernistischer Liebesbegriff
- 1.2 Das Urbild der goldenen Zeit und die Einheit von Dichtung und Liebe
- 2. Dichtung als Totalerfahrung der Welt
- 2.1 Der Mythos vom Heldendichtertum und die Großform des Epos
- 2.2 Repräsentation des Weltganzen und subjektivistische Vereinzelung
- 2.3 Das „große Ganze der Natur“ und die klassisch-geschlossene Kunstform
- 3. Zerrissenheit als epochale Befindlichkeit
- 3.1 Krise und Identitätsdiffusion
- 3.2 „Tutto e nulla“: Existenzmasken als Formen des Ich-Erhalts
- 3.3 Elend des Dichters, Glanz der Dichtung
- 4. Literaturverzeichnis
- I. Textausgaben
- II. Forschungsliteratur
Torquato Tasso war dem Publikum der Goethezeit als Dichter von weltliterarischem Rang vertraut. Vor allem sein Hauptwerk Gerusalemme liberata (Das befreite Jerusalem)1 wurde noch gelesen und war überdies ein beliebter Stoff der Opernbühne.2 Auch über die außergewöhnliche Lebensgeschichte des Dichters war man unterrichtet.3 Heute ist der historische Tasso nahezu vergessen, und selbst germanistische Fachpublikationen zeichnen häufig ein undifferenziertes Bild der zeit- und ideengeschichtlichen Ausgangslage.
Goethes Drama zeugt von großer Detailkenntnis des historischen Dichters und seines Umfelds, es muss also eine nicht unwesentliche Affinität ← 9 | 10 → des deutschen Klassikers zu Gestalt und Epoche bestanden haben.4 Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem geistesgeschichtlichen Kontext der späten Renaissance dürfte daher auch interessante Aspekte für das Verständnis Goethes erbringen. Dabei soll es nicht nur um Quellenstudien5 gehen, das vorrangige Anliegen der Arbeit besteht darin, jene Epochenstrukturen aufzuzeigen, die einerseits den historischen Tasso als Repräsentanten der Spätrenaissance bestimmen, andererseits Goethes Tasso als Produkt der frühen Weimarer Klassik und ihrer ideengeschichtlichen Konfiguration ausweisen. Dabei soll der historische Tasso mehr als nur Stoffmaterial im Sinne einer Vorgeschichte des Goetheschen Dramas liefern. Im Mittelpunkt der Überlegungen wird zwar der Tasso-Text und seine Auslegung stehen; in die Deutung soll aber zugleich der jeweils relevante historische Befund mit einfließen, sodass Goethes Figur in einer Zusammenschau mit dem Dichter der Renaissance gelesen werden kann. Idealiter entstehen dabei zwei unterschiedliche Epochenprofile mit teils konvergierenden, teils divergierenden Merkmalen. Viele Ideen, die in der Renaissance grundlegend entwickelt wurden, hinterlassen in der Goethezeit, ja bis in die Moderne, ihre Spuren, auch wenn die Renaissance nicht, wie es Burckhardt6 etwas vereinfacht sehen wollte, in linearer Entwicklung die Moderne antizipiert.
Am deutlichsten lassen sich ideengeschichtliche Kontexte wohl am Beispiel prägnanter Einzelthemen darstellen. Im Zusammenhang mit dem Tasso-Drama, das zum ersten Mal in der Weltliteratur den Dichter selbst zum Gegenstand der Literatur erhebt,7 bietet sich als Leitfrage für die ← 10 | 11 → Arbeit an, welche Vorstellungen von Dichtung in Goethes Schauspiel auszumachen sind und wie sie sich im Dichtungsverständnis und Selbstbild des Dichters niederschlagen. In weiterer Folge ist zu fragen, inwiefern jene Vorstellungen für die Episteme der Epoche insgesamt charakteristisch sind. Über den Dichtungsbegriff lässt sich auch ein Zugang zum historischen Tasso gewinnen; auch ihm geht es vorrangig um die Bestimmung von Sinn und Funktion der Dichtung und des Dichters in seiner Zeit. Die zu erwartenden diskursgeschichtlichen Querschnitte liefern nicht nur einen allgemeinen, sondern auch einen detaillierten Erkenntnisgewinn, zumal sich die skizzierte Vorgangsweise nicht in theoretischen Annahmen erschöpft, sondern in erster Linie, der philologischen Tradition verpflichtet, konkrete Textarbeit ist. ← 11 | 12 → ← 12 | 13 →
1Goethe kannte das Werk in der Übersetzung Johann Friedrich Koppes schon seit seiner Jugendzeit, wie entsprechende Hinweise in Dichtung und Wahrheit (I, 1) sowie im Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre (I, 7) belegen. Vgl. hierzu: Johann Wolfgang Goethe, Torquato Tasso. Erläuterungen und Dokumente, hrsg. von Christian Grawe, Stuttgart 2003, S. 55. Tassos Aminta dürfte Goethe erst in Italien kennen gelernt haben. Im Mai 1788 hat er eine Ausgabe in Mailand erworben. Vgl. Lieselotte Blumenthal, „Arkadien in Goethes »Tasso«“, in: Goethe, Neue Folge des Jahrbuchs der Goethe-Gesellschaft 21 (1959), S. 1–24, hier: S. 2. Die Lyrik des italienischen Dichters wurde kaum rezipiert, und es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, in wie weit Goethe Tassos Gedichte kannte. Vgl. hierzu: Hartmut Köhler, „Tassos Lyrik in deutscher Übersetzung“, in: Torquato Tasso in Deutschland. Seine Wirkung in Literatur, Kunst und Musik seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, hrsg. von Achim Aurnhammer, Berlin, New York 1995, S. 537–553, bes. S. 539. Allerdings finden sich in Goethes Hauptquelle: Pierantonio Serassi, La vita di Torquato Tasso, Rom 1785 (Reprint:Viareggio 1996 ) einige Gedichte eingestreut.
2Besonders beliebt war das Armida-Sujet. Vgl. dazu: Albert Gier, „Ecco l’ancilla tua…Armida in der Oper zwischen Gluck und Rossini“, in: Torquato Tasso in Deutschland, S. 643–660. Goethe selbst verfasste nach diesem Stoff die Kantate Rinaldo.
3Über die wichtigsten Lebensbeschreibungen informiert: Albert Meier, „»Und so ward sein Leben selbst Roman und Poesie«. Tasso-Biographien in Deutschland“, in: Torquato Tasso in Deutschland, S. 11–32.
4Darauf weist Lawrence Ryan hin: „[D]er historische Tasso ist ein durchaus geeigneter Träger der von Goethe anvisierten dichtungsgeschichtlichen Problematik einer bestimmten Epoche.“ Lawrence Ryan, „Die Tragödie des Dichters in Goethes »Torquato Tasso«, in: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft, 9. Jg. 1965, S. 283–322, hier S. 322. Zu Goethe und seinem Verhältnis zur Renaissance vgl. Angelika Jacobs, Goethe und die Renaissance. Studien zum Konnex von historischem Bewußtsein und ästhetischer Identitätskonstruktion, München 1997.
5Goethes wichtigste Quelle ist bekanntlich das umfangreiche Werk von Serassi (Anm.1). Siehe auch: Grawe, Erläuterungen und Dokumente, S. 74–82.
6Vgl. Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, Stuttgart 1976.
7Siehe Wolfdietrich Rasch, Goethes »Torquato Tasso«. Die Tragödie des Dichters, Stuttgart 1954, S. 33.
Details
- Seiten
- 124
- Erscheinungsjahr
- 2014
- ISBN (Hardcover)
- 9783631651940
- ISBN (PDF)
- 9783653049084
- ISBN (MOBI)
- 9783653985658
- ISBN (ePUB)
- 9783653985665
- DOI
- 10.3726/978-3-653-04908-4
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Januar)
- Schlagworte
- Renaissance Gegenreformation Epostheorie Schäferthematik Arkadien
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. 124 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG