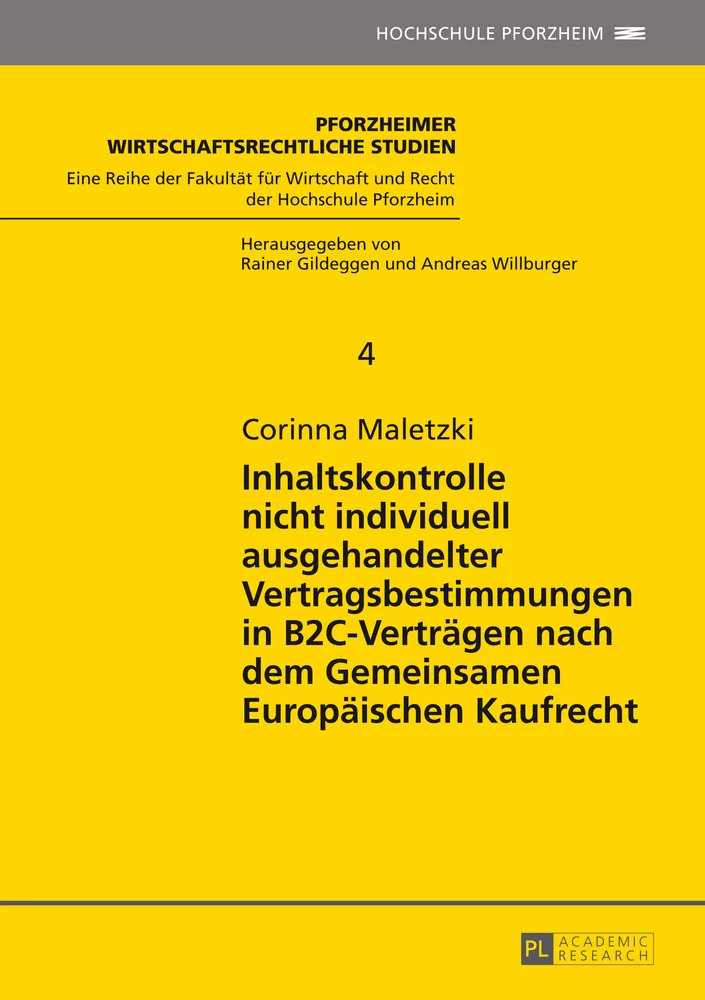Inhaltskontrolle nicht individuell ausgehandelter Vertragsbestimmungen in B2C-Verträgen nach dem Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Vorwort
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1. Definitionen
- 2.1.1. Nicht individuell ausgehandelte Vertragsbestimmung, Standardvertragsbestimmungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen
- 2.1.2. Verbraucher und Unternehmer
- 2.2. Einbeziehung von nicht individuell ausgehandelten Vertragsbestimmungen in den Vertrag
- 2.3. Pflicht zur Transparenz, Art. 82 GEKR
- 2.4. Verwendete Sprache
- 2.5. Auslegung nicht individuell ausgehandelter Vertragsbestimmungen
- 3. Inhaltskontrolle nicht individuell ausgehandelter Vertragsbestimmungen
- 3.1. Notwendigkeit der Inhaltskontrolle
- 3.2. Aufbau der Inhaltskontrolle im GEKR
- 3.2.1. Aufbau des Kapitel 8 GEKR zu unfairen Vertragsbestimmungen
- 3.2.2. Grundsätzliches zu schwarzen und grauen Listen in Verbindung mit einer Generalklausel
- 3.2.3. Regelungen zu Vertragsbestimmungen außerhalb des Kapitel 8 GEKR
- 3.3. Welche Vertragsbestimmungen unterliegen der Inhaltskontrolle
- 3.3.1. Inhaltskontrolle individuell oder nicht individuell ausgehandelter Vertragsbestimmungen?
- 3.3.2. Keine Inhaltskontrolle bei deklaratorischen Klauseln
- 3.3.3. Keine Inhaltskontrolle bezüglich des Hauptvertragsgegenstands und der Angemessenheit des Preises
- 3.3.4. Vertragsbestimmungen mit Regelungsbereich außerhalb des GEKR
- 3.4. Ausschluss der Inhaltskontrolle
- 4. Klausellisten in Art. 84 und 85 GEKR
- 4.1. Klauseln zum Vertragsschluss
- 4.1.1. Preiserhöhungsklauseln, Art. 85 k GEKR
- 4.1.2. Klauseln zu einer überlangen Bindungsfrist an das Angebot, Art. 85 o GEKR
- 4.2. Klauseln zur Wirkung von Verträgen
- 4.2.1. Klauseln zu Vorleistung bzw. Leistungsverweigerung, Art. 84 g, 84 j und 85 s GEKR
- 4.2.2. Klauseln zur Übertragung von vertraglichen Rechten und Pflichten, Art. 85 m GEKR
- 4.3. Klauseln zur Nichterfüllung
- 4.3.1. Klauseln zur Haftungsbegrenzung, Art. 84 a und 84 b GEKR
- 4.3.2. Klauseln zur Einschränkung von Abhilfen bei Nichterfüllung, Art. 85 b GEKR
- 4.4. Klauseln zur Beendigung und Verlängerung von Verträgen
- 4.4.1. Verlängerungsklauseln, Art. 85 h GEKR
- 4.4.2. Klauseln zur Laufzeit von Verträgen zur regelmäßigen Lieferung von Waren, Art. 85 w GEKR
- 4.5. Klauseln zu Streitigkeiten aus dem Vertrag
- 4.5.1. Gerichtsstandsklausel, Art. 84 e GEKR
- 4.5.2. Klauseln zur Einschränkung der Beweislast, Art. 85 a GEKR
- 5. Generalklausel, Art. 83 GEKR
- 6. Folgen unfairer Vertragsbestimmungen
- 6.1. Rechtsfolgen unfairer Vertragsbestimmungen
- 6.2. Gerichtliche Überprüfung
- 7. Fazit
- Anhang: Gegenüberstellung GEKR, KlauselRL, BGB und DCFR
- Quellenverzeichnis
- Rechtsprechungsverzeichnis
- Rechts- und Rechtserkenntnisquellenverzeichnis
← XIV | 1 → 1. Einleitung
Seit der Industriellen Revolution und der damit einhergehenden Serienproduktion1 sind standardisierte Vertragsbestimmungen aus dem Wirtschaftsleben nicht mehr hinweg zu denken. Die Serienproduktion führte zu einer Vielzahl gleichartiger Rechtsgeschäfte, die es unmöglich machten, für jedes einzelne Rechtsgeschäft einen neuen Vertrag zu entwerfen und auszuhandeln.2 Es wurden daher vorformulierte, nicht individuell ausgehandelte Vertragsbestimmungen verwendet, die bei Vertragsschluss gestellt und mit der anderen Vertragspartei vereinbart wurden.3 Auch heute ist es in Zeiten von Massengeschäften und Internetversandhandel undenkbar, die Rahmenbedingungen eines Vertrags für jedes einzelne Rechtsgeschäft zwischen den Vertragsparteien aufwendig neu auszuhandeln. Stattdessen kann eine Partei – in Verbraucherverträgen ist dies in der Regel der Verkäufer – seine vorformulierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Vertrag einbringen und so für eine Vielzahl von Verträgen ein einheitliches Regelwerk nutzen.
Solche vorformulierten, nicht individuell ausgehandelten Vertragswerke bieten den Vorteil, dass alle während des Vertragsverhältnisses möglicherweise auftretenden Probleme im Voraus umfassend geregelt werden können,4 ohne dass langwierige und kostenintensive Verhandlungen nötig sind. Die Vertragsverhandlungen können sich so auf die essentiala negotii – Vertragsgegenstand, Vertragsparteien und Vergütung – konzentrieren.5 Dies führt zu einer Beschleunigung der Vertragsabschlüsse und zu einer Senkung der Transaktionskosten,6 wodurch die Ware dem Kunden zu niedrigeren Preisen angeboten werden kann. Auch die Kalkulation von Kosten7 und Risiken8 des Verwenders ← 1 | 2 → von standardisierten Vertragsbedingungen wird erleichtert. Durch die Verwendung eines standardisierten Vertragswerks kann so die Abwicklung von Massenverträgen vereinfacht und optimiert werden.9 Während durch standardisierte Vertragsbedingungen grundsätzlich das Vertragsrisiko angemessen auf die Vertragsparteien verteilt werden kann, findet in der Praxis häufig eine Abwälzung des Vertragsrisikos durch den Verwender auf seinen Kunden statt.10 Dies ist möglich,11 da der Verwender die standardisierten Vertragsbedingungen in aller Ruhe und notfalls mit fachlicher Hilfe ausarbeiten kann. Der Verbraucher nimmt die Bedingungen dagegen häufig ungelesen bzw. ohne sie verstanden zu haben an. In der Regel ist er zudem tatsächlich nicht in der Lage, einzelne Bedingungen individuell aushandeln zu können.
Der Verbraucher kann jedoch darauf vertrauen, vom Gesetzgeber durch eine Kontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen12 nach §§ 305 ff. BGB vor missbräuchlichen Klauseln geschützt zu werden. Dem Unternehmer wiederum bieten die §§ 305 ff. BGB bei der Erstellung seines Vertragswerks dazu eine Orientierung, welche Klauseln zulässig sind und welche nicht.13
Details
- Pages
- 166
- Publication Year
- 2014
- ISBN (Hardcover)
- 9783631654729
- ISBN (PDF)
- 9783653047110
- ISBN (MOBI)
- 9783653980752
- ISBN (ePUB)
- 9783653980769
- DOI
- 10.3726/978-3-653-04711-0
- Language
- German
- Publication date
- 2014 (July)
- Keywords
- GEKR AGB Rechtsvergleich BGB Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. 166 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG