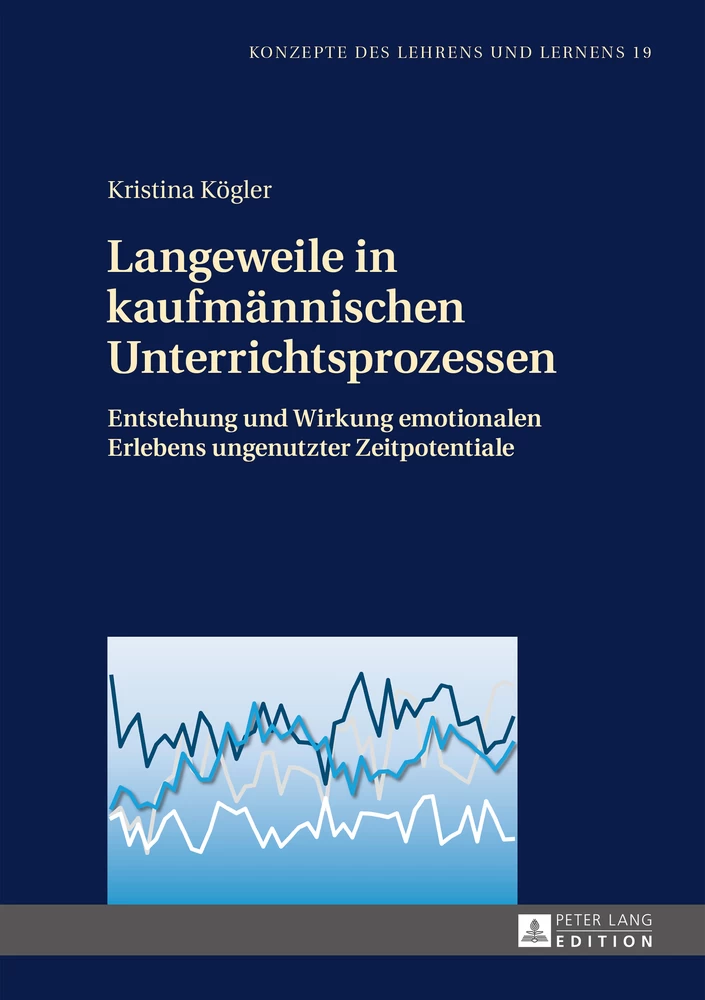Langeweile in kaufmännischen Unterrichtsprozessen
Entstehung und Wirkung emotionalen Erlebens ungenutzter Zeitpotentiale
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1. Problemstellung und Gang der Untersuchung
- 1.1 Zum Stellenwert emotionaler Erlebensqualitäten in Lehr-Lern-Prozessen und bei deren Erforschung
- 1.2 Institutionalisierter Zeitdruck und Langeweile im Unterricht – eine paradoxe Koinzidenz?
- 1.3 Erkenntnisinteresse und Aufbau der Untersuchung
- 2. Zeit und Emotionen als Schlüsselgrößen für schulische Lehr-Lern-Prozesse und ihre Erforschung
- 2.1 Das Problem (mit) der Zeit als Forschungsgegenstand: Systematisierungsversuche
- 2.1.1 Die konstruktivistische Deutung objektiver, subjektiver und intersubjektiver Zeit von Hasenfratz
- 2.1.2 Ebenen menschlicher Zeitlichkeit sensu Richelle
- 2.1.3 Synoptische Verdichtung mit Blick auf die vorliegende Arbeit
- 2.2 Die intersubjektive Konstruktion von Zeit in schulischen Bildungsprozessen – Historische und sozio-kulturelle Schlaglichter
- 2.2.1 Historische Meilensteine des schulischen Umgangs mit Zeit
- 2.2.2 Der pädagogische Zeitdiskurs im Spiegel der Gesellschaftsentwicklung
- 2.3 Konstruktionen „objektiver“ Zeit in schulischem Bildungsgeschehen und empirischer Lehr-Lern-Forschung
- 2.3.1 Schulbezogene Zeitkategorien und zentrale Begriffsdifferenzierungen
- 2.3.2 Die Variable Zeit in empirischer Lehr-Lern-Forschung und Theoriebildung
- 2.3.3 Zentrale Gestaltungsparameter der Unterrichtszeit und ihre empirische Bedeutung
- 2.3.3.1 Strukturelle Parameter als Oberflächenmerkmale der Unterrichtsgestaltung
- 2.3.3.2 Prozessuale Parameter als Ausdruck zeitlicher Abläufe im Unterricht
- 2.4 Subjektive Zeit als Erleben und Strukturieren individueller Wirklichkeit
- 2.4.1 Systematisierung psychologischer Zeitbegriffe und empirischer Zugänge
- 2.4.2 Chronobiologische Basismechanismen des menschlichen Zeitbewusstseins
- 2.4.3 Zeitliche Wahrnehmung von Ereignissen und Gegenwartserleben
- 2.4.4 Schätzung der Dauer von Ereignissen
- 2.4.5 Zeiterleben und emotionale Bewertung von Ereignissen und Ereignisfolgen
- 2.5 Emotionen und ihre Bedeutung für Wahrnehmung und Handeln
- 2.5.1 Definitionsheterogenität und Abgrenzung affektiver Konstrukte
- 2.5.2 Verwobenheit emotionaler, motivationaler und kognitiver Facetten in Wahrnehmungs- und Handlungsprozessen
- 2.5.3 Appraisal-Theorien der Emotionsgenese
- 2.5.4 Konsequenzen für empirische Zugänge zu Emotionskonstrukten in Unterrichtsprozessen
- 2.6 Zeit und Emotionen – Integration der Theoriestränge und Zwischenfazit
- 3. Langeweile als emotionales Erleben ungenutzter Zeitpotentiale: Konstruktverständnis, Modellierungen, Forschungsstand
- 3.1 Definition und Abgrenzung des Langeweilekonstrukts
- 3.1.1 Frühe Definitionsversuche und Minimalkonsens
- 3.1.2 Verortung des Langeweilekonstrukts im Spektrum emotional-motivationaler Regulationsinstanzen
- 3.1.2.1 Funktionalistisches Emotionsparadigma und Überlegungen zur Funktionalität von Langeweile
- 3.1.2.2 Langeweile als bewusstseinspflichtige Emotion im engeren Sinne
- 3.1.2.3 Diskussion von Langeweile als Antagonist von Interesse
- 3.1.3 Langeweile als Emotion – Klassifikationsversuch und Komponenten
- 3.2 Phänomenologie und Ausdifferenzierung des Langeweilekonstrukts
- 3.3 Referenzmodelle der Entstehung und Wirkung von Langeweile
- 3.3.1 Modell schulischer Langeweile von Robinson
- 3.3.2 Aktualgenese der Langeweile von Hill & Perkins
- 3.3.3 Personenbezogene Entstehungskonstellationen von Langeweile von De Chenne & Moody
- 3.3.4 Zusammenfassende Bewertung der Modellierungen
- 3.4 Forschungsstand zu Langeweile im Untersuchungsfeld Schule
- 3.4.1 Vorkommen und Ausmaß von Langeweile in Schule und Unterricht
- 3.4.2 Entstehungsbedingungen unterrichtlicher Langeweile
- 3.4.2.1 Situative Bedingungsfaktoren
- 3.4.2.2 Personenbezogene Bedingungsfaktoren
- 3.4.3 Strategien der Bewältigung von Langeweile im unterrichtlichen Kontext
- 3.4.4 Begleiterscheinungen und Wirkungen von Langeweile in Schule und Unterricht
- 3.5 Entstehung und Wirkung unterrichtlicher Langeweile – Zusammenfassung und mehrebenenanalytische Modellierung des Gegenstandsbereichs
- 4. Zielsetzung und Methodik der empirischen Untersuchung
- 4.1 Zielspektrum der Studie und forschungsmethodische Implikationen
- 4.2 Präzisierung der Forschungsfragen und Hypothesen
- 4.3 Methodik
- 4.3.1 Untersuchungsdesign
- 4.3.2 Stichprobe
- 4.3.3 Operationalisierung der Produktdaten
- 4.3.3.1 Erhebung individueller Eingangsvoraussetzungen
- 4.3.3.2 Erfassung von Lernleistungen
- 4.3.3.3 Erhebung von retrospektiven Bilanzierungen des Unterrichtsgeschehens
- 4.3.4 Operationalisierung der Prozessdaten
- 4.3.4.1 Systematische Beobachtung des Unterrichtsgeschehens
- 4.3.4.2 Prozessbegleitende Erhebung des Unterrichtserlebens von Lehrenden und Lernenden
- 4.3.4.3 Erhebung der außerunterrichtlichen Lernzeitnutzung
- 4.3.5 Verfahren der Datenanalyse
- 5. Empirische Befunde
- 5.1 Strukturelle und prozessuale Muster der Zeitnutzung im Rechnungswesenunterricht
- 5.1.1 Ausnutzung der Unterrichtszeit
- 5.1.2 Monotonie und Abwechslungsreichtum im Unterrichtsprozess
- 5.1.3 Interaktionsschwerpunkte
- 5.2 Ausmaß und Variabilität unterrichtlicher Langeweile im Fach Rechnungswesen
- 5.2.1 Ausmaß von Langeweile im Unterrichtsprozess
- 5.2.2 Lineare Verläufe der Langeweile im Untersuchungszeitraum
- 5.2.3 Variabilität des Langeweileerlebens
- 5.3 Bedingungsfaktoren der Schülerlangeweile in Unterrichtsprozessen
- 5.3.1 Deskriptive Charakteristika und Zusammenhänge der relevanten Prädiktoren
- 5.3.1.1 Methodisch-didaktische Facetten und subjektive Passung von Person und Situation
- 5.3.1.2 Personenbezogene Merkmale
- 5.3.2 Mehrebenenanalyse des Einflusses situativer und personenbezogener Bedingungsfaktoren auf das Ausmaß der Unterrichtslangeweile
- 5.4 Kurzfristige Wirkungen unterrichtlicher Langeweile
- 5.4.1 Wirkung auf den Wissenserwerb
- 5.4.2 Wirkung auf retrospektive Bilanzierungen des Unterrichts
- 5.4.2.1 Wirkung auf emotional-motivationale Bilanzierungen
- 5.4.2.2 Wirkung auf die Einschätzung der Unterrichtsqualität und Zufriedenheit mit der Lehrkraft
- 6. Zusammenfassung und Diskussion der empirischen Befunde
- 6.1 Zentrale empirische Befunde im Überblick
- 6.2 Limitationen der Interpretation und Generalisierbarkeit der Befunde
- 6.3 Pädagogische Implikationen
- 6.4 Forschungsdesiderate
- Literaturverzeichnis
Abbildung 1–1: Gang der Untersuchung im Überblick
Abbildung 2–1: Ebenenmodell menschlicher Zeitlichkeit
Abbildung 2–2: Vereinfachte Darstellung von Lehr-Lernzeitkategorien in frühen Erklärungsmodellen der Schulleistung
Abbildung 2–3: Schulbezogene Zeitkategorien
Abbildung 2–4: Strukturelle und prozessuale Parameter unterrichtlicher Zeitnutzung
Abbildung 2–5: Ordnungsschema zum menschlichen Zeitbewusstsein
Abbildung 2–6: Tetraeder-Modell der Einflussfaktoren auf die Schätzung von Dauer
Abbildung 3–1: Emotionskomponenten und Entäußerungsbeispiele
Abbildung 3–2: Verortung schulischer Langeweileformen
Abbildung 3–3: Modellierung unterschiedlicher Langeweileformen
Abbildung 3–4: Direkte und indirekte Einflussfaktoren schulfachbezogener Langeweile
Abbildung 3–5: Modell der Langeweileentstehung von Hill & Perkins
Abbildung 3–6: Abgrenzung von Langeweile, Abneigung und Interesse
Abbildung 3–7: Mehrebenenanalytische Modellierung des Gegenstandsbereichs
Abbildung 4–1: Design der Untersuchung im Rechnungswesenunterricht
Abbildung 4–2: Beispielhafte Multiple-Choice-Items für das Fach Rechnungswesen
Abbildung 4–3: Zentrale Bedeutungsdimensionen des Begriffs Monotonie
Abbildung 4–4: Items zur Erhebung des Unterrichtserlebens von Lernenden und Lehrkraft
Abbildung 4–5: Einschätzungen der Lernenden im Lerntagebuch
Abbildung 4–6: Skalierung der Smileys zur Erhebung der Stimmfärbung
Abbildung 5–1: Methodisch-didaktische Muster in Klasse 9A
Abbildung 5–2: Methodisch-didaktische Muster in Klasse 9B ← XVII | XVIII →
Abbildung 5–3: Methodisch-didaktische Muster in Klasse 9C
Abbildung 5–4: Methodisch-didaktische Muster in Klasse 9D.
Abbildung 5–5: Häufigkeiten überdurchschnittlich gelangweilter Lernender in Klasse 9A
Abbildung 5–6: Häufigkeiten überdurchschnittlich gelangweilter Lernender in Klasse 9B
Abbildung 5–7: Häufigkeiten überdurchschnittlich gelangweilter Lernender in Klasse 9C
Abbildung 5–8: Häufigkeiten überdurchschnittlich gelangweilter Lernender in Klasse 9D
Abbildung 5–9: Verläufe der Langeweilekurven in allen untersuchten Klassen
Abbildung 5–10: Trendanalyse des Langeweileverlaufs in Klasse 9A
Abbildung 5–11: Trendanalyse des Langeweileverlaufs in Klasse 9D
Abbildung 5–12: Linearer Zusammenhang zwischen den Maßen Wechselhäufigkeit und Wechselstärke
Abbildung 5–13: Histogramm der Verteilungsform der trait-Angst in Rechnungswesen
Abbildung 5–14: Wissensentwicklung der untersuchten Klassen im Untersuchungszeitraum ← XVIII | XIX →
Tabelle 3–1: Ausgewählte Befunde zu Vorkommen und Ausmaß schulischer Langeweile
Tabelle 3–2: Zentrale empirische Befunde zu Bewältigungsstrategien schulischer und unterrichtlicher Langeweile
Tabelle 4–1: Zusammensetzung der Stichprobe
Tabelle 4–2: Tests zur Erfassung kognitiver Eingangsvoraussetzungen
Tabelle 4–3: Skalen zur Erfassung von wirtschaftlichem Interesse und Selbstwirksamkeit
Tabelle 4–4: Interkorrelation und Beispielitems für die Skalen Interesse an wirtschaftlichen Problemstellungen und Selbstwirksamkeit
Tabelle 4–5: Skalen zur Erfassung habitualisierter Lernemotionen im Fach Rechnungswesen
Tabelle 4–6: Interkorrelationen und Beispielitems für die habitualisierten Lernemotionen in Rechnungswesen
Tabelle 4–7: Skalen zur Erfassung retrospektiver Bilanzierungen des Unterrichtsgeschehens
Tabelle 4–8: Interkorrelationen und Beispielitems für retrospektive Bilanzierungen des Unterrichtsgeschehens
Tabelle 4–9: Kategorien zur Erfassung unterrichtlicher Sichtstrukturen
Tabelle 4–10: Erfassung der Interaktionshäufigkeit der Lernenden
Tabelle 4–11: Kategoriensystem zur Kodierung der Lerngelegenheiten
Tabelle 4–12: Anzahl der verwertbaren Datensätze pro Klasse.
Tabelle 4–13: Die Verfahren der Datenanalyse im Überblick
Tabelle 5–1: Datenbasis für die Analyse des Unterrichtsgeschehens
Tabelle 5–2: Verteilung der Unterrichtszeit in den untersuchten Klassen
Tabelle 5–3: Verteilung der dominierenden Sozialformen über den Untersuchungszeitraum
Tabelle 5–4: Verteilung der dominierenden Arbeitsphasen über den Untersuchungszeitraum
Tabelle 5–5: Konstante Phasen in der Gestaltung der Sozialformen ← XIX | XX →
Tabelle 5–6: Konstante Phasen in der didaktischen Gestaltung
Tabelle 5–7: Verteilung der Redezeiten
Tabelle 5–8: Häufigkeiten für IRF-Sequenzen in den Lehrer-Schüler-Interaktionen
Tabelle 5–9: Mittlere Interaktionshäufigkeit der Lernenden im Untersuchungszeitraum
Tabelle 5–10: Aggregation der Schülerlangeweile über alle Lernenden und Messzeitpunkte
Tabelle 5–11: Häufigkeiten über- und unterdurchschnittlicher Langeweile-Messzeitpunkte
Tabelle 5–12: Häufigkeiten langeweilekristischer Messzeitpunkte
Tabelle 5–13: Deskriptiva der z-standardisierten Zeitreihen
Tabelle 5–14: Trendanalyse der Schülerlangeweile in den untersuchten Klassen
Tabelle 5–15: Zusammenhang zwischen den Maßen Wechselhäufigkeit und Wechselstärke
Tabelle 5–16: Schätzung fester Effekte für das Nullmodell
Tabelle 5–17: Schätzung der Zufallseffekte für das Nullmodell
Tabelle 5–18: Deskriptiva der Erlebensitems zur subjektiv wahrgenommenen Passung von Person und Situation
Tabelle 5–19: Interkorrelationen der situativen Prädiktoren
Tabelle 5–20: Mittelwerte und Standardabweichungen für den Prädiktor Vorwissen
Tabelle 5–21: Mittelwerte und Standarabweichungen der trait-Emotionen Angst und Langeweile in Rechnungswesen
Tabelle 5–22: Interkorrelationen der personenbezogenen Prädiktoren
Tabelle 5–23: Interkorrelation aller Prädiktorengruppen
Tabelle 5–24: Mehrebenen-Regression zur Schätzung fester Effekte für situationsnahe Prädiktoren auf Ebene der Messzeitpunkte (Modell 1)
Tabelle 5–25: Mehrebenen-Regression zur Schätzung von Zufallseffekten für situationsnahe Prädiktoren auf Ebene der Messzeitpunkte (Modell 1)
Tabelle 5–26: Devianzentest für den Vergleich des Nullmodells mit Modell 1 ← XX | XXI →
Tabelle 5–27: Mehrebenen-Regression zur Schätzung fester Effekte für die Integration personenbezogener Prädiktoren (Modell 2)
Tabelle 5–28: Mehrebenenregression zur Schätzung von Zufallseffekten für die Integration personenbezogener Prädiktoren (Modell 2)
Tabelle 5–29: Mehrebenen-Regression zur Schätzung fester Effekte auf allen Hierarchieebenen (Modell 3)
Tabelle 5–30: Schätzung von Zufallseffekten für Modell 3
Tabelle 5–31: Modellüberblick
Tabelle 5–32: Mittelwerte und Standardabweichungen für Vorwissenstest (t1) und lernzielorientierten Test (t2) in den untersuchten Klassen
Tabelle 5–33: Ergebnis der Varianzanalyse mit Messwiederholung für die Testung des Wissenserwerbs
Tabelle 5–34: Deskriptiva der unabhängigen Variablen
Tabelle 5–35: Interkorrelationen von Wissenserwerb (AV) und seinen Prädiktoren
Tabelle 5–36: Ergebnisse der Regressionsanalyse zur Aufklärung der Variabilität des Wissenserwerbs
Tabelle 5–37: Interkorrelation der unabhängigen Variablen zur Vorhersage emotional-motivationaler Bilanzierungen des Rechnungswesenunterrichts
Tabelle 5–38: Ergebnisse der Regressionsanalyse zur Aufklärung der ex post berichteten Langeweile im Unterricht
Tabelle 5–39: Ergebnisse der Regressionsanalyse zur Prüfung des Effekts prozessualer Variabilität auf die Bilanzierung von Langeweile nach dem Unterricht
Tabelle 5–40: Ergebnisse der Regressionsanalyse zur Aufklärung der ex post berichteten Interessantheit des Unterricht
Tabelle 5–41: Ergebnisse der Regressionsanalyse zur Aufklärung der ex post berichteten positiven Erlebensbilanz im Unterricht
Tabelle 5–42: Ergebnisse der Regressionsanalyse zur Aufklärung drs ex post berichteten negativen Erlebensbilanz im Unterricht ← XXI | XXII →
Tabelle 5–43: Ergebnisse der Regressionsanalyse zur Aufklärung der globalen Einschätzung der Unterrichtsqualität durch die Lernenden
Tabelle 5–44: Ergebnisse der Regressionsanalyse zur Aufklärung der globalen Zufriedenheit der Lernenden mit ihrer Lehrkraft ← XXII | 1 →
1. Problemstellung und Gang der Untersuchung
1.1 Zum Stellenwert emotionaler Erlebensqualitäten in Lehr-Lern-Prozessen und bei deren Erforschung
Details
- Pages
- XXII, 334
- Publication Year
- 2015
- ISBN (Hardcover)
- 9783631659137
- ISBN (PDF)
- 9783653052930
- ISBN (MOBI)
- 9783653969597
- ISBN (ePUB)
- 9783653969603
- DOI
- 10.3726/978-3-653-05293-0
- Language
- German
- Publication date
- 2015 (February)
- Keywords
- Zeiterleben Experience-Sampling-Methodik Unterrichtsbeobachtung Mehrebenenanalysen Rechnungswesenunterricht
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. XXII, 334 S., 34 s/w Abb., 59 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG