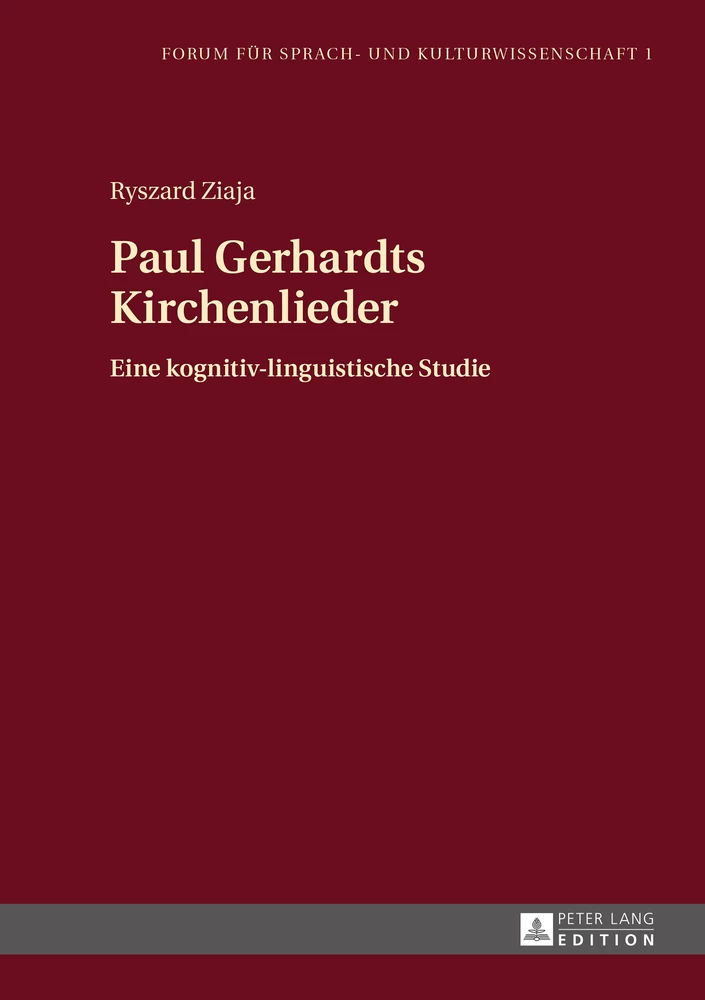Paul Gerhardts Kirchenlieder
Eine kognitiv-linguistische Studie
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- 1 Kognitive Linguistik – wissenschaftlicher Kontext
- 1.1 Modularismus vs. Holismus
- 1.2 Gestalttheorie
- 1.3 Kategorisierung, Konzeptualisierung und Protortypentheorie
- 2 Kognitive Metapherntheorie
- 2.1 Die „klassische“ Metapherntheorie
- 2.2 Die kognitive Metapherntheorie und ihre Vorläufer
- 2.3 Hauptthesen der kognitiven Metapherntheorie
- 2.3.1 Ubiquitätsthese
- 2.3.2 Domänen-These
- 2.3.3 Modell-These
- 2.3.3.1 Vorstellungsschemata und Szenarios
- 2.3.3.2 Projizierungs-IKM’s
- 2.3.3.3 IKM-Bildung
- 2.3.4 Diachronie-These
- 2.3.5 Unidirektionalitätsthese
- 2.3.6 Invarianz-These
- 2.3.7 Notwendigkeitsthese
- 2.3.8 Kreativitätsthese
- 2.3.9 Fokussierungsthese
- 3 Das Kirchenlied als Textsorte religiöser Sprache
- 3.1 Religiöse Sprache – Begriffsbestimmung
- 3.1.1 Merkmale der religiösen Sprache
- 3.1.2 Rekontextualisierung der religiösen Sprache – religiöse Sprache und kognitive Metapherntheorie
- 3.2 Das Kirchenlied – Begriffsbestimmung und Textsortencharakteristik
- 3.3 Empirische Möglichkeiten der kognitiven Metapherntheorie für die Kirchenliedforschung
- 4 Paul Gerhardt – Person und Kirchenlieddichtung
- 4.1 Das deutsche Kirchenlied – historischer Hintergrund bis auf Paul Gerhardt
- 4.2 Paul Gerhardts Lebensstationen
- 4.2.1 Gräfenhainichen
- 4.2.2 Grimma
- 4.2.3 Wittenberg
- 4.2.4 Berlin (I)
- 4.2.5 Mittenwald
- 4.2.6 Berlin (II)
- 4.2.7 Lübben
- 4.3 Paul Gerhardts Werk
- 4.3.1 Die wichtigsten Werkausgaben
- 4.3.2 Johann Crügers „Praxis pietatis melica“ 1674 Frankfurt am Main
- Empirischer Teil
- 5 Onomasiologisch-kognitiver Metaphernansatz
- 5.1 Onomasiologie versus Semasiologie
- 5.2 Korpuszusammenstellung
- 5.3 Methodologische Vorgehensweise
- 6 Korpusanalyse
- 6.1 Konzeptualisierungen bildschematischer Art
- 6.1.1 BEHÄLTER-Schema
- 6.1.1.1 Empirische Darlegung
- 6.1.1.1.1 Mensch ist ein behälter
- 6.1.1.1.2 Jesus ist ein behälter
- 6.1.1.1.3 Das herz ist ein behälter
- 6.1.1.1.4 Die seele ist ein behälter
- 6.1.1.1.5 Das wort gottes ist ein behälter
- 6.1.1.1.6 Der tod ist ein behälter
- 6.1.1.1.7 Die sünde ist ein behälter
- 6.1.1.1.8 Emotionen sind ein behälter
- 6.1.1.1.9 Die welt ist ein behälter
- 6.1.1.2 Resümee
- 6.1.2 WEG-Szenario
- 6.1.2.1 Empirische Darlegung
- 6.1.2.1.1 Die wege gottes
- 6.1.2.1.2 Die wege des bösen
- 6.1.2.2 Resümee
- 6.1.3 SEEFAHRTS-Szenario
- 6.1.3.1 Empirische Darlegung
- 6.1.3.1.1 Der mensch ist ein schiff
- 6.1.3.1.2 Gott ist wasser
- 6.1.3.1.3 Gott ist ein anker
- 6.1.3.1.4 Das böse ist ein meer
- 6.1.3.1.5 FISCHER-Konzeptualisierungen
- 6.1.3.2 Resümee
- 6.1.4 KRIEGS-Szenario
- 6.1.4.1 Empirische Darlegung
- 6.1.4.1.1 Das böse hat sein reich
- 6.1.4.1.2 Gott hat sein reich
- 6.1.4.1.3 Gott und das böse führen krieg
- 6.1.4.1.4 Der mensch und das böse führen krieg
- 6.1.4.1.5 Kriegsende: der mensch – das böse
- 6.1.4.1.6 Der mensch und die welt führen krieg
- 6.1.4.2 Resümee
- 6.1.5 VERTIKAL-ORIENTIERUNGS-Schema
- 6.1.5.1 Empirische Darlegung
- 6.1.5.1.1 Gott ist oben
- 6.1.5.1.2 Der mensch ist unten
- 6.1.5.1.3 Das böse ist unten / der mensch sinkt nach unten
- 6.1.5.2 Resümee
- 6.1.6 FARB-Schema
- 6.1.6.1 Empirische Darlegung
- 6.1.6.1.1 GOTTES-Konzeptualisierungen
- 6.1.6.1.2 BÖSE-Konzeptualisierung
- 6.1.6.1.3 TOD-Konzeptualisierungen
- 6.1.6.1.4 MENSCH-Konzeptualisierungen
- 6.1.6.1.5 BLUT-Konzeptualisierungen
- 6.1.6.2 Resümee
- 6.1.7 PFLANZEN-Schema
- 6.1.7.1 Empirische Darlegung
- 6.1.7.1.1 Jesus ist eine blume
- 6.1.7.1.2 Der mensch ist ein baum
- 6.1.7.1.3 Das wort ist eine pflanze
- 6.1.7.2 Resümee
- 6.1.8 NAHRUNGS-Schema
- 6.1.8.1 Empirische Darlegung
- 6.1.8.1.1 Der mensch
- 6.1.8.1.2 Das wort
- 6.1.8.1.3 Gott
- 6.1.8.1.4 Jesus
- 6.1.8.1.5 Das böse
- 6.1.8.1.6 Das leben
- 6.1.8.2 Resümee
- 6.1.9 ZYKLUS-Schema
- 6.1.9.1 Empirische Darlegung
- 6.1.9.1.1 Tag-nacht-zyklus
- 6.1.9.1.2 Heute-morgen-zyklus
- 6.1.9.1.3 Jugend-alter-zyklus
- 6.1.9.1.4 Gute-zeit-böse-zeit-zyklus
- 6.1.9.1.5 Leben-tod-zyklus
- 6.1.9.1.6 Jahreszyklus
- 6.1.9.1.7 Krieg-frieden-zyklus
- 6.1.9.2 Resümee
- 6.2 Konzeptualisierungen nicht-schematischer Art
- 6.2.1 GOTTES-Konzeptualisierungen
- 6.2.1.1 Gott ist mensch
- 6.2.1.2 Gott ist ein fels
- 6.2.1.3 Resümee
- 6.2.2 JESUS-Konzeptualisierungen
- 6.2.2.1 Jesus ist ein liebhaber
- 6.2.2.2 Jesus ist ein freund
- 6.2.2.3 Jesus ist ein hirte
- 6.2.2.4 Jesus ist ein lamm
- 6.2.2.5 Jesus ist eine sonne
- 6.2.2.6 Jesus ist ein arzt
- 6.2.2.7 Jesus ist ein vogel
- 6.2.2.8 Resümee
- 6.2.3 MENSCH-Konzeptualisierungen
- 6.2.3.1 Mensch ist kind
- 6.2.3.2 Mensch ist arm
- 6.2.3.3 Mensch ist schaf
- 6.2.3.4 Mensch ist krank
- 6.2.3.5 Resümee
- 6.2.4 WELT-Konzeptualisierungen
- 6.2.5 BÖSE-Konzeptualisierungen
- 6.2.5.1 Das böse ist ein drache
- 6.2.5.2 Das böse ist eine schlange
- 6.2.5.3 Das böse ist ein tausendkünstler
- 6.2.6 SEELEN-Konzeptualisierungen
- 7 Schlussfolgerungen
- 7.1 Kulturell-historisch-biografischer Zusammenhang der Konzeptualisierungen
- 7.2 Spezifische religiöse Konzeptualisierungen
- 7.3 Revidierung der Hauptthesen der kognitiven Metapherntheorie
- 7.3.1 Ubiquitätsthese
- 7.3.2 Domänen-These
- 7.3.3 Modell-These
- 7.3.4 Diachronie-These
- 7.3.5 Unidirektionalitätsthese
- 7.3.6 Invarianz-These
- 7.3.7 Notwendigkeitsthese
- 7.3.8 Kreativitätsthese
- 7.3.9 Fokussierungsthese
- Bibliographie
- I Abbildungsverzeichnis
- II Tabellenverzeichnis
- III Verzeichnis der analysierten Kirchenlieder
- Reihenübersich
Abbildung 1:Kognitionswissenschaft
Abbildung 2:Familienähnlichkeit der Kategorie VOGEL
Abbildung 3:Tassen-Experiment von Labov
Abbildung 4:Graphische Form der konzeptuellen Metapher
Abbildung 5:Klassifikation der konzeptuellen Metaphern
Abbildung 9:Semasiologie versus Onomasiologie
Abbildung 16:VERTIKAL-ORIENTIERUNGS-Schema
Abbildung 19:GOTT IST AM HÖCHSTEN im VERTIKAL-ORIENTIERUNGS-Schema
Abbildung 20:Vertikal-Relation nach Luther
Abbildung 21:VERTIKAL-ORIENTIERUNGS-Schema und vertikale Raumorientierung
Abbildung 28:GOTTES-Konzeptualisierungen
Abbildung 29:JESUS-Konzeptualisierungen
Abbildung 30:MENSCH-Konzeptualisierungen
Tabelle 1:Vertikale Dimension der Kategorisierung
Tabelle 2:Terminologische Entsprechungen in den Metapherntheorien
Tabelle 3:Metaphernarten nach dem Konventionalisierungsgrad
Tabelle 5:Merkmale der religiösen Sprache
Tabelle 6:Kirchenlied-Korpus-Analyse.
Tabelle 7:Thematische Aufteilung der Kirchenlieder Paul Gerhardts ← 231 | 232 → ← 232 | 233 →
IIIVERZEICHNIS DER ANALYSIERTEN KIRCHENLIEDER
1)„Wach auf mein Herz und singe“
2)„Lobet den Herren alle, die ihn ehren“
3)„Nun ruhen alle Wälder“
4)„Herr, höre, was mein Mund“
5)„Weg, mein Herz, mit den Gedanken“
6)„Wie soll ich dich empfangen“
7)„Warum willst du draußen stehen“
8)„Wir singen dir, Immanuel“
9)„O Jesu Christ, dein Kripplein ist“
10)„Ich steh an deiner Krippen hier“
11)„Nun lasst uns gehn und treten“
12)„Warum machet solche Schmerzen“
13)„O Welt, sieh hier dein Leben“
14)„Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“
15)„Hör an, mein Herz, die sieben Wort“
16)„O Mensch, beweine deine Sünd“
17)„Siehe, mein getreuer Knecht“
18)„Sei mir tausendmal gegrüßet“
19)„Gegrüßet seist du, meine Kron“
20)„Sei wohl gegrüßet, guter Hirt“
21)„Ich grüße dich, du frömmster Mann“
22)„Gegrüßet seist du, Gott mein Heil“
23)„O Herz des Königs aller Welt“
24)„O Haupt voll Blut und Wunden“
25)„Als Gottes Lamm und Leue“
26)„Auf, auf, mein Herz mit Freuden“
27)„Nun freut euch hier und überall“
28)„O du allersüßte Freude“
29)„Zieh ein zu deinen Toren“
30)„Gott Vater, sende deinen Geist“
31)„Was alle Weisheit in der Welt“
32)„Nun danket all und bringet Ehr“
33)„Ich preise dich und singe“
34)„Ich will erhöhen immerfort“ ← 233 | 234 →
35)„Herr, dir trau ich all mein Tage“
36)„Sollt ich meinem Gott nicht singen“
37)„Ich will mit Danken kommen“
38)„Du meine Seele, singe“
39)„Ich singe dir mit Herz und Mund“
40)„Auf den Nebel folgt die Sonne“
41)„Wer wohlauf ist und gesund“
42)„Der Herr, der aller Enden“
43)„Wohl dem Menschen, der nicht wandelt“
44)„Zweierlei bitt ich von dir“
45)„Nicht so traurig, nicht so sehr“
46)„Ich danke dir demütiglich“
47)„Warum sollt ich mich den grämen“
48)„Du bist ein Mensch, das weißt du wohl“
49)„Du liebe Unschuld du, wie schlecht wirst du geacht“
50)„Gott ist mein Licht, der Herr mein Heil“
51)„Mein Gott, ich habe mir“
52)„Hört an, ihr Völker, hört doch an“
53)„Sei wohlgemut, o Christenseel“
54)„O Gott mein Schöpfer, edler Fürst“
55)„Ich hab oft bei mir selbst gedacht“
56)„Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun“
57)„Ich hab in Gottes Herz und Sinn“
58)„Befiel du deine Wege“
59)„O Jesu Christ, mein schönstes Licht“
60)„Ein Weib, das Gott den Herren liebt“
61)„Also hat Gott die Welt geliebt“
62)„Jesu, allerliebster Bruder“
63)„Herr, aller Weisheit Quell und Grund“
64)„Geduld ist euch vonnöten“
65)„Wie lang, o Herr, wie lange soll“
66)„Nach dir, o Herr, verlanget mich“
67)„Wie ein Hirsch im großen Dürsten“
68)„Was soll ich doch, o Ephraim“
69)„Herr der du vormals hast dein Land“
Details
- Pages
- 235
- Publication Year
- 2015
- ISBN (Hardcover)
- 9783631662502
- ISBN (PDF)
- 9783653053470
- ISBN (MOBI)
- 9783653968033
- ISBN (ePUB)
- 9783653968040
- DOI
- 10.3726/978-3-653-05347-0
- Language
- German
- Publication date
- 2015 (June)
- Keywords
- historischer Korpus deutscher Kirchenlieder postmoderne Analysetheorie Rekontextualisierung kognitive Metapherntheorie
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. 235 S., 32 s/w Abb., 7 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG