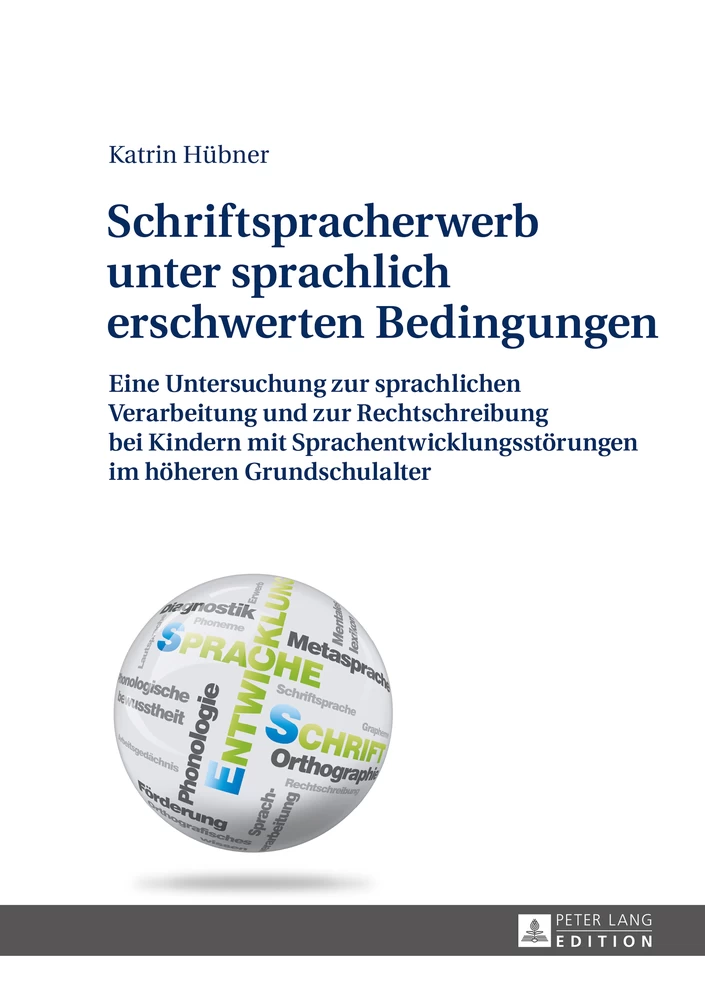Schriftspracherwerb unter sprachlich erschwerten Bedingungen
Eine Untersuchung zur sprachlichen Verarbeitung und zur Rechtschreibung bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen im höheren Grundschulalter
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungen, Fachbegriffe, Signaturen und Symbole
- 1 Einleitung
- 1.1 Vorbemerkung
- 1.2 Begründung der Ausgangsposition der Untersuchung (bisheriger Forschungsstand)
- 1.3 Konzeption und Zielsetzung
- 1.4 Aufbau der Arbeit
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Der Schriftspracherwerb
- 2.1.1 Linguistische und sprachdidaktische Grundlagen
- 2.1.1.1 Grundbausteine der Laut- und Schriftsprache: zentrale Begriffe
- 2.1.1.2 Struktur des deutschen Rechtschreib-Regelsystems (Rechtschreib-Prinzipien)
- 2.1.1.2.1 Phonologische Schreibungen (Phoneme und Grapheme)
- 2.1.1.2.2 Silbenreim- bzw. Vokaldauerschreibungen
- 2.1.1.2.3 Morphematische Schreibungen
- 2.1.2 Schriftspracherwerb und seine Beziehung zur Lautsprache
- 2.1.2.1 Zum Problem der Phonem-Graphem-Korrespondenz im Deutschen: Was heißt lauttreu?
- 2.1.2.2 Zur Verwendung des Begriffs ‚orthographisch‘
- 2.1.3 Modelle des Schriftspracherwerbs
- 2.1.3.1 Entwicklungsmodelle der Schriftsprache
- 2.1.3.1.1 Ausdifferenzierung der ‚orthographischen Stufe‘
- 2.1.3.1.2 Zusammenfassende Überlegungen zu den Entwicklungsmodellen
- 2.1.3.2 Prozessmodelle der Schriftsprache
- 2.1.3.2.1 Zwei-Wege-Modelle
- 2.1.3.2.2 Modelle des einfachen Zugangsweges: Analogie- und Netzwerkmodelle
- 2.1.3.2.3 Zusammenfassende Überlegungen zu den Prozessmodellen
- 2.1.3.3 Weitere Annahmen zum Erwerb fortgeschrittener Rechtschreibkompetenzen
- 2.1.4 Störungen des Schriftspracherwerbs
- 2.1.4.1 Terminologie: Zur Ordnung der Begriffsvielfalt
- 2.1.4.2 Ätiologie
- 2.1.4.3 Symptomatik: Typische „Legastheniker-Fehler“
- 2.1.5 Zusammenfassende Überlegungen zum Schriftspracherwerb
- 2.2 Metasprachliche Fähigkeiten
- 2.2.1 Metasprachliche Fähigkeiten – begriffliche Einordnung
- 2.2.1.1 Teilbereiche metasprachlicher Fähigkeiten
- 2.2.2 Metasprachliche Fähigkeiten auf phonologischer Ebene
- 2.2.2.1 Phonologische Bewusstheit – begriffliche Einordnung
- 2.2.2.2 Phonologische Bewusstheit in der zentralen Sprachverarbeitung
- 2.2.2.3 Konstrukte der phonologischen Bewusstheit
- 2.2.2.3.1 Dimension der phonologischen Einheit (Größe der Einheiten)
- 2.2.2.3.2 Dimension der Operation (Explizitheit der Operationen)
- 2.2.2.4 Abgrenzung zur auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung
- 2.2.2.5 Entwicklung der phonologischen Bewusstheit
- 2.2.2.6 Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb
- 2.2.2.7 Diagnostische Erhebung metaphonologischer Fähigkeiten
- 2.2.2.7.1 Erhebung der lautsprachlichen Leistungen der phonologischen Bewusstheit
- 2.2.2.7.2 Erhebung der schriftsprachlichen phonologischen Bewusstheitsleistungen – phonologisches Rekodieren
- 2.2.3 Metasprachliche Fähigkeiten auf orthographischer Ebene
- 2.2.3.1 Orthographische Bewusstheit – begriffliche Einordnung
- 2.2.3.2 Orthographische Bewusstheit und Schriftspracherwerbs (-störungen)
- 2.2.3.3 Orthographisches Lernen – bewusste und unbewusste Anteile
- 2.2.3.4 Aufbau orthographischer Intuition
- 2.2.3.5 Entwicklung orthographischer Bewusstheit
- 2.2.3.6 Diagnostische Erhebung orthographischer Verarbeitungsfähigkeiten
- 2.2.3.6.1 Orthographische Differenzierung von Pseudohomophonen
- 2.2.3.6.2 Explizites Wissen über orthographische Schreibungen
- 2.2.4 Metasprachliche Fähigkeiten bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen
- 2.2.5 Aufmerksamkeit, sprachliches Arbeitsgedächtnis sowie Struktur und Funktion des mentalen Lexikons
- 2.2.5.1 Selektive Aufmerksamkeit
- 2.2.5.2 Funktion und Arbeitsweise des sprachlichen Arbeitsgedächtnisses
- 2.2.5.3 Struktur des mentalen Lexikons
- 2.2.5.4 ‚Schnelles Benennen von Wörtern‘ als automatisierter Zugriff auf das mentale Lexikon
- 2.2.6 Zusammenfassende Überlegungen zu metasprachlichen Fähigkeiten
- 2.3 Sprachentwicklungsstörungen als Kennzeichen der Untersuchungsgruppe
- 2.3.1 Störungen der Sprachentwicklung – Überblick
- 2.3.1.1 Klassifikationen – begriffliche Einordnung
- 2.3.1.2 Ätiologie
- 2.3.1.3 Epidemiologie
- 2.3.2 Multimodale Sprachentwicklungsstörungen – Begriffsbestimmung
- 2.3.3 Erscheinungsformen von (multimodalen) Sprachentwicklungsstörungen
- 2.3.3.1 Störungen beim Erwerb pragmatischer Fähigkeiten
- 2.3.3.2 Störungen beim Erwerb semantisch-lexikalischer Fähigkeiten
- 2.3.3.3 Störungen beim Erwerb morphologisch-syntaktischer Fähigkeiten
- 2.3.3.4 Störungen beim Erwerb phonetisch-phonologischer Fähigkeiten
- 2.3.3.5 Zusammenfassender Überblick über mögliche Symptome von Sprachentwicklungsstörungen
- 2.3.4 Zusammenhang von Sprachentwicklungsstörungen und Schriftspracherwerbsstörungen
- 2.3.4.1 Auswirkungen von Sprachentwicklungsstörungen auf den Schriftspracherwerb
- 2.3.4.2 Auswirkungen des Schriftspracherwerbs auf die Lautsprache
- 2.3.5 Zusammenfassende Überlegungen zu Sprachentwicklungsstörungen
- 2.4 Schlussfolgerungen für die empirische Untersuchung
- 3 Empirische Untersuchung
- 3.1 Vorüberlegungen und Zielsetzung der empirischen Untersuchung
- 3.2 Übergeordnete Untersuchungsfrage und leitende Hypothese
- 3.3 Planungsüberlegungen zum Untersuchungsdesign
- 3.3.1 Überlegungen zur inhaltlichen Strukturierung und Vorgehensweise
- 3.3.2 Zeitlicher Untersuchungsablauf (Untersuchungszeitraum)
- 3.4 Beschreibung und Bestimmung der Eingangsstichprobe
- 3.4.1 Schüler an der ‚Sprachheilschule‘ – Exkurs
- 3.4.2 Bestimmung der Eingangsstichprobe
- 3.4.2.1 Sprachbezogene Eigenschaften
- 3.4.2.2 Vergleichbarkeit der sozio-kulturellen Faktoren
- 3.4.2.3 Absicherung der kognitiven Voraussetzungen
- 3.4.3 Die Eingangsstichprobe (UGges) im Überblick
- 3.4.4 Alters- und Geschlechterverteilung der Eingangsstichprobe
- 4 Untersuchungsteil I: Eingangsuntersuchung Erfassung der Rechtschreibleistungen
- 4.1 Zielsetzung
- 4.2 Fragestellungen und Hypothesen
- 4.3 Beschreibung der Aufgaben und Durchführung (HSP 3)
- 4.3.1 Das Untersuchungsinstrument: Die Hamburger Schreib-Probe
- 4.3.2 Durchführung
- 4.4 Datenfixierung und Auswertungsverfahren
- 4.4.1 Methoden der statistischen Auswertung
- 4.5 Darstellung der Ergebnisse und Hypothesenprüfung
- 4.5.1 Quantitative Betrachtung der Rechtschreibleistungen (Hypothese 1)
- 4.5.2 Qualitative Betrachtung der Rechtschreibleistungen (Hypothese 2)
- 4.5.3 Rechtschreib-Extremgruppen-Extraktion (Hypothese 3)
- 4.6 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- 4.6.1 Exkurs: Korrelationen zwischen Rechtschreibleistungen und kognitiver Leistungsfähigkeit
- 4.7 Ableitungen für die Fortführung der Untersuchung
- 5 Untersuchungsteil II: Hauptuntersuchung Erfassung der phonologischen und orthographischen Leistungen
- 5.1 Eingangssituation und Zielsetzung
- 5.2 Beschreibung der Untersuchungsgruppen (Extremgruppen UG„gut“ – UG„schlecht“)
- 5.3 Aufbau der Untersuchung zur Erfassung der metasprachlichen (Verarbeitungs-)Leistungen
- 5.3.1 Methoden der statistischen Auswertung – Ergänzungen zum Extremgruppenvergleich
- 6 Untersuchungsteil IIa: Erfassung der Leistungen zur phonologischen Sprachverarbeitung und Sprachbewusstheit
- 6.1 Auditiv-Kinästhetische Lautdifferenzierung und -analyse
- 6.1.1 Fragestellungen und Hypothesen
- 6.1.2 Beschreibung der Aufgaben und Durchführung (H-LAD)
- 6.1.3 Datenfixierung und Auswertungsverfahren
- 6.1.4 Darstellung der Ergebnisse und Hypothesenprüfung
- 6.1.4.1 Untersuchung auf quantitative Unterschiede (Hypothese 1)
- 6.1.4.2 Untersuchung auf qualitative Unterschiede (Hypothese 2)
- 6.1.4.3 Untersuchung des Einflusses der Komplexität der Phonemstruktur (Hypothese 3)
- 6.1.5 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- 6.1.6 Exkurs: Betrachtung der Einzelfehler
- 6.2 Phonologische Bewusstheit
- 6.2.1 Fragestellungen und Hypothesen
- 6.2.2 Beschreibung der Aufgaben und Durchführung (QUIL-D)
- 6.2.3 Datenfixierung und Auswertungsverfahren
- 6.2.4 Darstellung der Ergebnisse und Hypothesenprüfung
- 6.2.4.1 Untersuchung auf quantitative Unterschiede (Hypothese 1)
- 6.2.4.2 Untersuchung auf qualitative Unterschiede (Hypothese 2)
- 6.2.5 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- 6.2.6 Exkurs: testbedingte ‚Stolpersteine‘
- 6.3 Automatisierter Wortabruf
- 6.3.1 Fragestellungen und Hypothesen
- 6.3.2 Beschreibung der Aufgaben und Durchführung (Wortabruftest)
- 6.3.3 Datenfixierung und Auswertungsverfahren
- 6.3.4 Darstellung der Ergebnisse und Hypothesenprüfung
- 6.3.4.1 Untersuchung auf quantitative Unterschiede (Hypothese 1)
- 6.3.4.2 Untersuchung auf qualitative Unterschiede (Hypothese 2)
- 6.3.4.3 Untersuchung auf Unterschiede im zeitlichen Verlauf (Hypothese 3)
- 6.3.5 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- 6.3.6 Exkurs: Betrachtung der Einzelfehler
- 6.4 Phonologisches Rekodieren
- 6.4.1 Fragestellungen und Hypothesen
- 6.4.2 Beschreibung der Aufgaben und Durchführung (Lückendiktat)
- 6.4.3 Datenfixierung und Auswertungsverfahren
- 6.4.4 Darstellung der Ergebnisse und Hypothesenprüfung
- 6.4.4.1 Untersuchung auf quantitative Unterschiede (Hypothese 1)
- 6.4.4.2 Untersuchung auf qualitative Unterschiede (Hypothese 2)
- 6.4.4.3 Untersuchung auf Fehlerabhängigkeit von der Komplexität der Phonemstruktur (Hypothese 3)
- 6.4.5 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- 6.4.6 Exkurs: Betrachtung der Einzelfehler
- 6.5 Zusammenfassung der Ergebnisse zur phonologischen Sprachverarbeitung und Sprachbewusstheit
- 7 Untersuchungsteil IIb: Erfassung der Leistungen zur orthographischen Sprachverarbeitung und Sprachbewusstheit
- 7.1 Anwendung orthographischer Kenntnisse
- 7.1.1 Fragestellungen und Hypothesen
- 7.1.2 Beschreibung der Aufgaben und Durchführung
- 7.1.3 Prätestung der „Orthographiewörter-Liste“ an einer Kontrollgruppe ohne lautsprachliche Auffälligkeiten (KGorth)
- 7.1.4 Datenfixierung und Auswertungsverfahren
- 7.1.4.1 Fehlerkategorien zur qualitativen Fehlerauswertung in Anlehnung an die AFRA-Systematik
- 7.1.4.2 Orthographische Fokussierung: AFRA-Lupenstellen
- 7.1.5 Darstellung der Ergebnisse und Hypothesenprüfung
- 7.1.5.1 Untersuchung auf Lauttreue (Hypothese 1)
- 7.1.5.2 Untersuchung auf Regelspezifik (Hypothese 2)
- 7.1.5.2.1 Auswertung nach AFRA-Ebenen
- 7.1.5.2.2 Auswertung nach AFRA-Auswertungskategorien
- 7.1.5.2.3 Auswertung nach Mehrheits-/Minderheitsschreibungen
- 7.1.5.3 Untersuchung auf Wortspezifität (Hypothese 3)
- 7.1.5.3.1 Wortabhängige Fehlergewichtungen
- 7.1.5.3.2 Abhängigkeit der Fehlschreibungsart von orthographischen oder itemspezifischen Faktoren
- 7.1.5.3.3 Fehlerabhängigkeit von der Wortlänge
- 7.1.5.3.4 Fehlerabhängigkeit von der Komplexität der orthographischen Wortstruktur
- 7.1.5.3.5 Fehlerabhängigkeit von der Wortbekanntheit
- 7.1.5.3.6 Fehlerabhängigkeit von der Wortlänge, der Komplexität der Wortstruktur und der Wortbekanntheit
- 7.1.6 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- 7.2 Orthographische Differenzierung (implizites Wissen) und explizites Orthographiewissen
- 7.2.1 Fragestellungen und Hypothesen
- 7.2.1.1 Fragestellungen und Hypothesen zur orthographischen Differenzierungsfähigkeit (Wahlaufgabe)
- 7.2.1.2 Fragestellungen und Hypothesen zum expliziten Orthographiewissen (Begründungsaufgabe)
- 7.2.2 Beschreibung der Aufgaben und Durchführung (Wahlaufgabe mit Begründung)
- 7.2.3 Absicherung von morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten (Grammatiktest)
- 7.2.4 Datenfixierung und Auswertungsverfahren
- 7.2.5 Darstellung der Ergebnisse und Hypothesenprüfung
- 7.2.5.1 Untersuchung des impliziten Orthographiewissens (Hypothese 1 – Wahlaufgabe)
- 7.2.5.2 Untersuchung auf ‚Regelspezifität‘ der orthographischen Differenzierungsfähigkeit (Hypothese 2 – Wahlaufgabe)
- 7.2.5.2.1 Auswertung nach AFRA-Fehlerkategorien
- 7.2.5.2.2 Auswertung nach Mehrheits- und Minderheitsschreibungen
- 7.2.5.3 Untersuchung auf ‚Wortspezifität‘ der orthographischen Differenzierungsfähigkeit (Hypothese 3 – Wahlaufgabe)
- 7.2.5.4 Untersuchung des ‚expliziten Orthographiewissens‘ (Hypothese 1 – Begründungsaufgabe)
- 7.2.5.5 Untersuchung auf ‚Regelspezifität‘ des expliziten Orthographiewissen (Hypothese 2 – Begründungsaufgabe)
- 7.2.5.6 Untersuchung auf ‚Wortspezifität‘ des expliziten Orthographiewissens (Hypothese 3 – Begründungsaufgabe)
- 7.2.6 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- 7.3 Ergebniszusammenfassung der Leistungen zur orthogra-phischen Sprachverarbeitung und Sprachbewusstheit
- 8 Zusammenfassung und Ausblick
- 8.1 Ergebnisse der Untersuchung
- 8.2 Grenzen der Untersuchung (kritische Würdigung)
- 8.3 Schlussfolgerungen für Forschung und Praxis
- 9 Literatur
- 10. Danksagung
- Anhang
Abb. 1: Elemente der Lautsprache (Phon, Phonem) und der Schriftsprache (Graph, Graphem) (vgl. Reber 2009, 13)
Abb. 2: Das hierarchische Konstituentenmodell der Silbenstruktur nach Ramers & Vater (1991, 135 f.)
Abb. 3: Modellentwurf zu Ablauf und Struktur im schulischen Rechtschreiberwerb nach Naumann (2011, 33)
Abb. 4: Das ‚Haus der Orthographie‘ als Zusammenfassung der didaktisch relevanten Rechtschreib-Prinzipien nach Naumann (2011, 28)
Abb. 5: Strukturmodell des Wirkgefüges des Lernens nach Breuninger (1999, 55)
Abb. 6: Einteilung der metasprachlichen Fähigkeiten nach Tunmer & Bowey (1984, 150)
Abb. 7: Komponenten der phonologischen Informationsverarbeitung in Anlehnung an Mayer (2006, 228) und Reber (2009, 35)
Abb. 8: Beziehungsgefüge der phonologischen Bewusstheit nach Stackhouse & Wells (1997, 58)
Abb. 9: Sprachverarbeitungsrahmenmodell mit gekennzeichneten Verarbeitungsebenen (links) und den dazugehörenden Fragen zu den Verarbeitungsebenen (rechts) nach Stackhouse & Wells (1997, 79 u. 98)
Abb. 10: Basisstruktur des Laut- und Schriftsprachverarbeitungsmodells mit den angenommenen zwei Dimensionen nach Stackhouse & Wells (1997, 18)
Abb. 11: Komponenten der Lexikalischen Repräsentation (vgl. Stackhouse & Wells 1997, 158)
Abb. 12: Modell der phonologischen Bewusstheit nach Stackhouse & Wells (1997, 58) modifiziert von Schnitzler (2008, 15)
Abb. 13: Matrix des zweidimensionalen Konstrukts der phonologische Bewusstheit nach Stackhouse & Wells (1997) (aus Schnitzler 2008, 29)
Abb. 14: Sprachverarbeitungsmodell nach Stackhouse & Wells (1997) (entnommen aus Schnitzler 2008, 10)
Abb. 15: Entwicklung der phonologischen Bewusstheit nach Stackhouse & Wells (1997) (modifiziert entnommen aus Scheerer-Neumann & Hofmann 2002, 134; Schnitzler 2008, 34)
Abb. 16: Zusammenhänge zwischen Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit und Schriftsprachfähigkeiten im Grundschulalter (Schnitzler 2008, 75) ← 13 | 14 →
Abb. 17: Zwei-Wege-Modell der Bildung von Intuition als Instanz für Rechtschreibsicherheit (vgl. Nickel 2006, 190)
Abb. 18: Modell des mentalen Lexikons nach Baddeley (1990) entnommen aus Mayer (2010, 36)
Abb. 19: Modell des mentalen Lexikons nach Levelt (1989, 188) entnommen aus Reber (2009, 23)
Abb. 20: Modell eines Lexikoneintrages in Anlehnung an Luger (2006, 30) entnommen aus Reber (2009, 24)
Abb. 21: Strukturmodell zum Zusammenhang von Lautsprache und Schriftsprache modifiziert und erweitert in Anlehnung an das Modell von Stackhouse & Wells (1997) mit Erweiterungen von Schnitzler (2008)
Abb. 22: Zeitlicher Verlauf der Datenerhebung und Auswertung im Überblick (n = Probandenzahl; IQ = Intelligenzquotient; SES = Sprachentwicklungsstörungen; LG = Lehrergespräch)
Abb. 23: Grafische Darstellung der Geschlechterverteilung innerhalb der Gesamtuntersuchungsgruppe (UGges)
Abb. 24: Grafische Darstellung der Altersverteilung UGges
Abb. 25: Vergleich von T-Werten und Prozenträngen in einer Normalverteilung (vgl. May 2002, 10)
Abb. 26: Histogramm mit Normalverteilungskurve zur Häufigkeitsverteilung der Anzahl richtig geschriebener Wörter.
Abb. 27: Histogramm der Häufigkeitsverteilung T-Werte der Anzahl richtig geschriebener Wörter mit Normalverteilungskurve
Abb. 28: Histogramme der Häufigkeitsverteilung richtig geschriebener Grapheme (Graphemtreffer) mit Normalverteilungskurve; links = Rohwerte; rechts = T-Werte
Abb. 29: Histogramme der Häufigkeitsverteilungen richtig gelöster Lupenstellen zur alphabetischen, orthographischen und morphematischen Verschriftung (Rohwerte)
Abb. 30: Histogramme der T-Werte-Häufigkeitsverteilungen richtig gelöster Lupenstellen der alphabetischen, orthographischen und morphematischen Verschriftung (Normalverteilungskurven lediglich als Orientierung – Normalverteilung nicht ableitbar)
Abb. 31: Streudiagramme zum Zusammenhang zwischen der Summe der Graphemtreffer und der Summe der alphabetischen, orthographischen und morphematischen Lupenstellen
Abb. 32: Säulendiagramm der möglichen Rechtschreib-Strategieprofile der UGges; die drei rechten Säulen stellen Differenzierungen der roten Säule hinsichtlich der Art der Dominanz dar ← 14 | 15 →
Abb. 33: Streudiagramm der IQ-Werte in den HSP-Extremgruppen
Abb. 34: Gegenüberstellung der Schülerzahlen der beiden Extremgruppen (UG„gut“ und UG„schlecht“)
Abb. 35: Strukturübersicht über die Untersuchungsbereiche und Tests zur Erfassung der metasprachliche Verarbeitung (in Anlehnung an das Modell von Stackhouse & Wells 1997)
Abb. 36: Strukturübersicht über die Untersuchungsbereiche und Tests zur Erfassung der metasprachlichen Verarbeitung mit Markierung (orange) der Leistungen zur phonologischen Sprachverarbeitung und Sprachbewusstheit (IIa)
Abb. 37: Strukturübersicht über die Untersuchungsbereiche und Test zur Erfassung der metasprachlichen Verarbeitung mit Markierung (orange) der Leistungen zur auditiv-kinästhetischen Lautdifferenzierung und -analyse
Abb. 38: Mittelwertdarstellungen der korrekten Antworten in % für die einzelnen Untersuchungsbereiche (auditiv U1, kinästhetisch U1, U2) und die Gesamtauswertung (ges) im Extremgruppenvergleich der UG„gut“ und UG„schlecht“
Abb. 39: Mittelwertdarstellungen der korrekten Antworten in % für die Untertests der kinästhetischen Phonemdifferenzierung (kin. U1 a + b + c) und die Gesamtauswertung (kin. U1 ges.) im Extremgruppenvergleich UG„gut“ und UG„schlecht“
Abb. 40: Mittelwertvergleich der qualitativen Fehlerkategorien bei der kinästhetischen Phonemdifferenzierung (kin. U1) im Extremgruppenvergleich der UG„gut“ und UG„schlecht“
Abb. 41: Anteilige Fehlerverteilungen nach Fehlerkategorien in jeder der beiden Untersuchungsgruppen (kin. U1)
Abb. 42: Mittelwertvergleich (Fehler absolut) nach Fehlerkategorien bei der Phonemanalyse (U2) im Extremgruppenvergleich
Abb. 43: Anteilige Fehlerverteilungen nach Fehlerkategorien in jeder der beiden Untersuchungsgruppen (U2)
Abb. 44: Mittelwertvergleich der Fehlerhäufigkeiten bei der kinästhetischen Phonemdifferenzierung in Abhängigkeit von der Komplexität der Phonemstruktur im Extremgruppenvergleich UG„gut“ und UG„schlecht“
Abb. 45: Darstellung der Fehleranzahl absolut bei Testitems mit Konsonantenhäufung (KKV) und Einfachkonsonanz (KV) je Einzelfall in den beiden Untersuchungsgruppen UG„schlecht“ und UG„gut“ ← 15 | 16 →
Abb. 46: Mittelwertvergleich: Fehler absolut in Abhängigkeit von der Komplexität der Phonemstruktur (Konsonantenhäufung KKV links, Einfachkonsonanz KV rechts) bei der kinästhetischen Phonemdifferenzierung im Extremgruppenvergleich
Abb. 47: Mittelwertvergleich: Nachsprechfehler bei der kinästhetischen Phonemdifferenzierung im Vergleich zur auditiven Beurteilung der Itempaare für die Extremgruppen UG„gut“ und UG„schlecht“
Abb. 48: Strukturübersicht über die Untersuchungsbereiche und Test zur Erfassung der metasprachlichen Verarbeitung mit Markierung (orange) der Leistungen zur phonologischen Bewusstheit
Abb. 49: Mittelwertvergleich: korrekte Antworten in % für die einzelnen Untersuchungsbereiche und die Gesamtauswertung des QUIL-D im Extremgruppenvergleich UG„gut“ und UG„schlecht“ sowie im Vergleich zur QUIL-D-Vergleichsstichprobe
Abb. 50: Mittelwertvergleich: korrekte Antworten in % des QUIL-D im Extremgruppenvergleich der UG„gut“ und UG„schlecht“ zusammengefasst nach der Explizitheit der Operation (links) und Größe der phonologischen Einheiten (rechts)
Abb. 51: Mittelwertvergleich: korrekte Antworten in % geordnet nach der angenommenen Entwicklungsreihenfolge für phonologische Bewusstheitsleistungen (Extremgruppenvergleich; QUIL-D-Vergleichsstichprobe 2. Klasse)
Abb. 52: Mittelwertvergleich: korrekte Antworten in % des QUIL-D im Extremgruppenvergleich mit QUIL-D-Vergleichsstichprobe 2. Klasse; geordnet nach einer ergänzenden Berücksichtigung der Beanspruchung des phonologischen Arbeitsspeichers
Abb. 53: Strukturübersicht über die Untersuchungsbereiche und Tests zur Erfassung der metasprachlichen Verarbeitung mit Markierung (orange) der Leistungen zum automatisierten Wortabruf
Abb. 54: Mittelwertvergleich: automatisierter Wortabruf in den vier Abrufkategorien im Extremgruppenvergleich (UG„gut“ – UG„schlecht“) unterteilt nach Anzahl Antworten ‚gesamt‘, ‚korrekt‘ und ‚falsch‘ (Fehler)
Abb. 55: Mittelwertvergleich: korrekte Antworten pro Einzelaufgabe in UG„gut“ und UG„schlecht“ gruppiert nach Abrufkategorien
Abb. 56: Mittelwertvergleich: ‚Antworten gesamt‘ und ‚Antworten korrekt‘ im Extremgruppenvergleich, einzeln für jede Wortabrufkategorie
Abb. 57: Mittelwertvergleich: Fehlerraten absolut in den einzelnen Wortabrufkategorien im Extremgruppenvergleich ← 16 | 17 →
Abb. 58: Mittelwertvergleich: Fehler pro Aufgabe nach Wortabrufkategorien im Extremgruppenvergleich
Abb. 59: Mittelwertvergleich: prozentuale Fehlerraten nach Abrufkategorien im Extremgruppenvergleich
Abb. 60: Mittelwertvergleiche: Antworten gesamt im zeitlichen Verlauf nach Wortabrufkategorien im Extremgruppenvergleich
Abb. 61: Mittelwertvergleiche: Antworten korrekt im zeitlichen Verlauf nach Wortabrufkategorien im Extremgruppenvergleich
Abb. 62: Strukturübersicht über die Untersuchungsbereiche und Tests zur Erfassung der metasprachlichen Verarbeitung mit Markierung (orange) der Leistungen zum phonologischen Rekodieren
Abb. 63: Mittelwerte: korrekte Verschriftungen in % im Extremgruppenvergleich der UG„gut“ und UG„schlecht“
Abb. 64: Mittelwertvergleich: Verschriftungsfehlerarten für UG„gut“, UG„schlecht“ und UGges
Abb. 65: Mittelwertvergleich: phonologisches Rekodieren – Fehler in % nach Phonemstruktur (KKV, KV, ges) im Extremgruppenvergleich
Abb. 66: Mittelwertvergleich: phonologisches Rekodieren – Konsonantenverwechslungen (K-Verw.), Konsonantenreduktionen (K-Red.) und sonstige Fehler (sonst. Fehler) in % nach Phonemstruktur (KKV oder KV) im Extremgruppenvergleich
Abb. 67: Häufigkeitsverteilung der Fehler in absoluten Zahlen bei Konsonantenclusterwörtern (KKV) – Konsonantenverwechslungsfehler (links), Konsonantenreduktionsfehler (rechts) im Extremgruppenvergleich
Abb. 68: Strukturübersicht über die Untersuchungsbereiche und Tests zur Erfassung der metasprachlichen Verarbeitung mit Markierung (orange) der Leistungen zur orthographischen Sprachverarbeitung und Sprachbewusstheit (IIb)
Abb. 69: Strukturübersicht über die Untersuchungsbereiche und Tests zur Erfassung der metasprachlichen Verarbeitung mit Markierung (orange) der Leistungen zur Anwendung orthographischer Kenntnisse
Abb. 70: Mittelwertvergleich: Fehlschreibungen – unterteilt nach lauttreuen und nicht lauttreuen Fehlschreibungen (einschließlich WE, NA und fehlenden Verschriftungen)
Abb. 71: Streudiagramm der Wertepaare ‚Anteil lauttreuer Fehlschreibungen‘ und ‚Wortfehler insgesamt‘ im Extremgruppenvergleich
Abb. 72: Mittelwertvergleich: Fehler in % je Fehlerebene im Extremgruppenvergleich je Fehlerebene ← 17 | 18 →
Abb. 73: Mittelwertvergleich: Fehler in % in den Lupenstellen je Fehlerebene im Extremgruppenvergleich
Abb. 74: Mittelwertvergleich: Fehler in % in den AFRA-Auswertungskategorien in den Mehrheits- (links) und Minderheitsschreibungen (rechts) im Extremgruppenvergleich
Abb. 75: Mittelwertvergleich: Richtigschreibungen einzelner Wörter in %; links UG„gut“ – rechts UG„schlecht“
Abb. 76: Mittelwertvergleich: prozentuale Wortfehlschreibungen in Bezug auf die Wortlänge (Silbenanzahl)
Abb. 77: Mittelwertvergleich: Wortfehler in % bei unterschiedlicher AFRA-Fehlerstellenanzahl im Wort (1–8)
Abb. 78: Mittelwertvergleich: Fehlerraten pro Wort in % in der Reihenfolge des Bekanntheitsgrades (ORD-Häufigkeitswörterliste)
Abb. 79: Strukturübersicht über die Untersuchungsbereiche und Tests zur Erfassung der metasprachlichen Verarbeitung mit Markierung (orange) der Leistungen zur orthographischen Differenzierung (implizites Wissen) und zum expliziten Orthographiewissen
Abb. 80: Mittelwertvergleich: prozentual falsche Wahlentscheidungen im Vergleich zu den prozentualen Wortfehlern beim Wortdiktat
Abb. 81: Mittelwertvergleich: falsche Wahlentscheidungen in % bezogen auf die AFRA-Auswertungskategorien im Extremgruppenvergleich
Abb. 82: Mittelwertvergleich: falsche Wahlentscheidungen in % in den AFRA-Auswertungskategorien im Extremgruppenvergleich und in Gegenüberstellung von Mehrheits- (links) und Minderheitsschreibungen (rechts)
Abb. 83: Mittelwertvergleich: falsche Wahlentscheidungen in % für die einzelnen Testwörter in der Reihenfolge des abnehmenden Bekanntheitsgrades
Abb. 84: Mittelwertvergleich: falsche Wahlentscheidungen in % in der Reihenfolge des abnehmenden Bekanntheitsgrades nach HI-Punktwertgruppen der ORD-Häufigkeitswörterliste
Abb. 85: Kreisdiagramme der prozentualen Mittelwerte unterschiedlicher Begründungsstrategien bei richtiger Wahlentscheidung im Extremgruppenvergleich mit tabellarischer Erläuterung der Kategorien-Nomenklatur (darunter)
Abb. 86: Kreisdiagramme der prozentualen Mittelwerte unterschiedlicher Begründungsstrategien bei falscher Wahlentscheidung im Extremgruppenvergleich mit tabellarischer Erläuterung der Kategorien-Nomenklatur (darunter) ← 18 | 19 →
Tab. 1: Psycholinguistisch orientierte Klassifikationskriterien nach de Montford-Supple (1998, 249 ff.) u. Schrey-Dern (2006, 15)
Tab. 2: Bestimmung der Untersuchungsgruppe UGges im Überblick
Tab. 3: Geschlechterverteilung innerhalb UGges
Tab. 4: Altersverteilung der Eingangsstichprobe UGges
Tab. 5: Altersverteilung der UGges getrennt nach dem Geschlecht
Tab. 6: Kreuztabelle der zu erwartenden Rechtschreibstrategie-Extremgruppen aus der Gesamtstichprobe UG ges (A = alphabetische Strategie, O+M = orthographisch-morphematische Strategie)
Tab. 7: Statistische Kennwerte richtig geschriebener Wörter UGges und HSP-Eichstichprobe (SVG)
Tab. 8: Statistische Kennwerte der T-Werteverteilung UGges und HSP-Eichstichprobe (SVG)
Tab. 9: Statistische Kennwerte der Graphemtreffer Rohwerte (links) und T-Werte (rechts) in Gegenüberstellung von UGges und HSP-Eichstichprobe
Tab. 10: Korrelationsprüfung nach Pearson zwischen der Summe Graphemtreffer und der Summe der jeweiligen Lupenstellen
Tab. 11: Prozentuale Fallzahlenverteilung in den Perzentilen der UGges für die Rechtschreibstrategien und die Graphemtreffer
Tab. 12: Kreuztabelle der ermittelten Rechtschreibstrategie-Extremgruppen aus der Gesamtstichprobe UGges (A = alphabetische Strategie, O+M = orthographisch-morphematische Strategie)
Tab. 13: Darstellung der Mittelwertbereiche der Fehler der AFRA-Gesamt (zum gruppeninternen Trennschärfenvergleich)
Tab. 14: Tabellarische Übersicht über die Testwörter in der dargebotenen Reihenfolge (linke Spalte: Wörter mit zu begründenden Wahlentscheidungen; rechte Spalte: Wörter ohne Begründungsauswahl) ← 19 | 20 →
← 20 | 21 →
Abkürzungen, Fachbegriffe, Signaturen und Symbole1
Details
- Pages
- 504
- Publication Year
- 2015
- ISBN (Hardcover)
- 9783631664209
- ISBN (PDF)
- 9783653055665
- ISBN (MOBI)
- 9783653965216
- ISBN (ePUB)
- 9783653965223
- DOI
- 10.3726/978-3-653-05566-5
- Language
- German
- Publication date
- 2015 (July)
- Keywords
- Sprachentwicklungsstörungen (SES) Lautdifferenzierung phonologisches Rekodieren phonologische Bewusstheit
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. 504 S., 10 farb. Abb., 76 s/w Abb., 14 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG