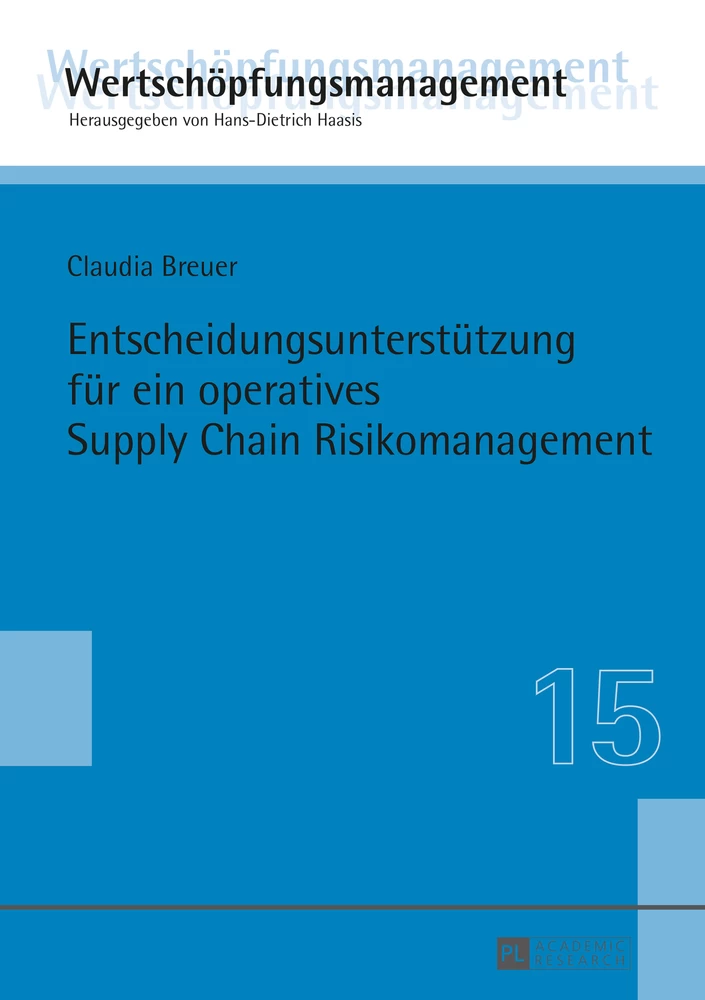Entscheidungsunterstützung für ein operatives Supply Chain Risikomanagement
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Symbolverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Lösungsweg der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Entscheidungsfindung im Supply Chain Risikomanagement
- 2.1 Entscheidungstheoretische Grundlagen
- 2.1.1 Einordnung der Entscheidungstheorie in die Betriebswirtschaftslehre
- 2.1.2 Begriff der Entscheidung
- 2.1.3 Elemente des Entscheidungsmodells
- 2.1.3.1 Entscheidungsfeld
- 2.1.3.2 Entscheidungsregel
- 2.1.4 Strukturierte Darstellung von Entscheidungssituationen
- 2.1.5 Prozess der Entscheidungsfindung
- 2.1.6 Unterstützung der Entscheidungsfindung
- 2.2 Grundlagen des Risikomanagements in Supply Chains
- 2.2.1 Supply Chain Risiken
- 2.2.1.1 Risikobegriff
- 2.2.1.2 Systematisierung von Risiken in Supply Chains
- 2.2.1.3 Risikoereignisse
- 2.2.2 Risikomanagement und Risikobewältigung in Supply Chains
- 2.2.2.1 Begriffliche Abgrenzung
- 2.2.2.2 Strategisches und operatives Risikomanagement
- 2.2.2.3 Prozess des Risikomanagements
- 2.2.2.4 Einordnung und Abgrenzung verschiedener Konzepte der Risikobewältigung
- 2.3 Risikobewältigung in sensiblen Logistikknoten
- 2.3.1 Vernetzung von Unternehmen in Supply Chains
- 2.3.2 Sensible Logistikknoten
- 2.3.3 Anwendungsbeispiel Güterverkehrszentren als sensible Logistikknoten
- 2.3.3.1 Merkmale, Funktionen und Ziele von Güterverkehrszentren
- 2.3.3.2 Beschreibung und Darstellung von Logistikprozessen in Güterverkehrszentren
- 2.4 Zwischenfazit und Formulierung der Konzeptionsbausteine
- 3 Konzeption einer Methodik zur Entscheidungsunterstützung für die Bewältigung von Risiken
- 3.1 Konzeption und Aufbau der Methodik
- 3.2 Informationsbedarfsanalyse
- 3.2.1 Risikorelevante Informationen der Beziehungsstruktur
- 3.2.2 Risikorelevante Informationen der Prozessstruktur
- 3.2.2.1 Modellierung von Logistikprozessen
- 3.2.2.2 Strukturierung von Logistikprozessen
- 3.2.3 Ergebnis der Informationsbedarfsanalyse
- 3.3 Situationsanalyse
- 3.3.1 Ausgestaltung und Zusammenhang der Entscheidungselemente
- 3.3.2 Situationsbestimmende Einflussfaktoren
- 3.3.3 Ergebnis der Situationsanalyse
- 3.4 Flussanalyse
- 3.4.1 Warenflüsse und deren Zusammensetzung
- 3.4.2 Methodische Berücksichtigung von Veränderungen im Zeitverlauf
- 3.4.3 Ergebnis der Flussanalyse
- 3.5 Maßnahmenanalyse
- 3.5.1 Elemente zur Berücksichtigung zeitlicher Maßnahmeninterdependenzen
- 3.5.2 Verfahren zur Berücksichtigung zeitlicher Interdependenzen
- 3.5.3 Ergebnis der Maßnahmenanalyse
- 3.6 Zwischenfazit und Anforderungen an ein Modell der Entscheidungsunterstützung für das operative Supply Chain Risikomanagement
- 4 Konstruktion eines Modells der Entscheidungsunterstützung für die Bewältigung von Risiken
- 4.1 Operationalisierung der Ziele
- 4.2 Prozessorientiertes Referenzmodell
- 4.2.1 Identifikation der risikorelevanten Prozesse
- 4.2.2 Auswahl der Modellierungsmethode
- 4.2.3 Aufbau des Referenzmodells
- 4.3 Aufbau des Simulationsmodells
- 4.3.1 Vorgehen und Simulationssystem
- 4.3.2 Systemanalyse und Modellbildung
- 4.3.2.1 Implementierung der Beziehungs- und Prozessstruktur
- 4.3.2.2 Implementierung der Veränderungen im Zeitverlauf
- 4.3.2.3 Implementierung der Entscheidungslogik
- 4.3.3 Datenbereitstellung
- 4.3.3.1 Akteure, Ressourcen und Infrastrukturen
- 4.3.3.2 Transportmittel
- 4.3.3.3 Entscheidungselemente
- 4.4 Interaktive Entscheidungsbäume
- 4.5 Zwischenfazit und Formulierung der Evaluationsziele
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Definition der Kennzahlen und Vorgehen der Evaluation
- 5.2 Evaluation der Auswirkungen von Risikoereignissen
- 5.2.1 Analyse der Gesamtauswirkungen
- 5.2.2 Analyse der Einflussfaktoren
- 5.2.3 Schlussfolgerungen aus den Analysen zu den Risikoauswirkungen
- 5.2.4 Interaktiver Entscheidungsbaum zur Feststellung eines Handlungsbedarfs
- 5.3 Evaluation der Handlungsmaßnahmen
- 5.3.1 Analyse der situationsabhängigen Handlungsbedarfe
- 5.3.2 Analyse der Wirkung von Handlungsmaßnahmen
- 5.3.3 Analyse zur Bestimmung der situationsgerechten Handlungsmaßnahmen
- 5.3.4 Schlussfolgerungen aus den Analysen zu den Handlungsmaßnahmen
- 5.3.5 Interaktive Entscheidungsbäume zur Feststellung der situationsgerechten Handlungsmaßnahmen
- 5.4 Evaluation der Handlungsstrategien
- 5.4.1 Analyse zur Bestimmung der Maßnahmenintervalle im Zeitverlauf
- 5.4.2 Analyse der Wirkung von Handlungsstrategien
- 5.4.3 Schlussfolgerungen aus den Analysen der Handlungsstrategien
- 5.4.4 Interaktiver Entscheidungsbaum
- 5.5 Zwischenfazit
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang 1: Tagesganglinien
- Anhang 2: Simulationsszenarien
- Anhang 3: Ausgestaltung der Handlungsalternativen
- Anhang 4: Ergebnistabellen
- Anhang 4.1: Ergebnisse zur Bewertung der Risikoauswirkungen
- Anhang 4.2: Ergebnisse zur Bewertung der Handlungsalternativen
- Anhang 4.3: Ergebnisse zur Bewertung der Handlungsstrategien
Abbildung 1: Zielsetzung der Arbeit
Abbildung 2: Aufbau der Arbeit
Abbildung 3: Entscheidungsfeld
Abbildung 4: Entscheidungsregel
Abbildung 5: Elemente des Entscheidungsmodells
Abbildung 6: Einflussdiagramm
Abbildung 7: Entscheidungsmatrix
Abbildung 8: Einstufiger Entscheidungsbaum
Abbildung 9: Mehrstufiger Entscheidungsbaum
Abbildung 10: Phaseneinteilung des Entscheidungsprozesses nach Heinen
Abbildung 11: Prozess der Entscheidungsfindung
Abbildung 12: Zusammenhang zwischen dem Informationsstand eines Entscheidungsträgers und dem Entscheidungszeitpunkt ohne Entscheidungsunterstützung
Abbildung 13: Zusammenhang zwischen dem Informationsstand eines Entscheidungsträgers und dem Entscheidungszeitpunkt mit Entscheidungsunterstützung
Abbildung 14: Übersicht zur Abgrenzung der Begriffe Risiko, Gefahr, Gefährdung und Bedrohung
Abbildung 15: Entwicklungen vor Eintritt eines Schadensereignisses
Abbildung 16: Übersicht zu verwendeten Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Risikoereignissen
Abbildung 17: Risikomanagementprozess
Abbildung 18: Zusammenhang zwischen Strategien, Maßnahmen und Risiken im Rahmen der Risikosteuerung
Abbildung 19: Phasen und Tätigkeiten des Risikomanagementprozesses
Abbildung 20: Strukturierung verschiedener Konzepte zur Bewältigung von Risiken
Abbildung 21: GVZ als Element eines logistischen Netzwerkes
Abbildung 22: GVZ-Netzwerk in Deutschland
Abbildung 23: Theoretischer Zusammenhang
Abbildung 24: Zielhierarchie der Konzeption
Abbildung 25: Einordnung und Aufbau der Konzeption
Abbildung 26: Allgemeingültige situationsbestimmende Einflussfaktoren ← XIII | XIV →
Abbildung 27: Gesamtheit der situationsbestimmenden Einflussfaktoren
Abbildung 28: Prozessorientiertes GVZ-Referenzmodell
Abbildung 29: Prozesslandkarte der ersten Ebene
Abbildung 30: Prozesslandkarte des KV-Terminals auf der zweiten Ebene
Abbildung 31: Logistischer Kernprozess auf der dritten Ebene
Abbildung 32: Prozess der vierten Ebene
Abbildung 33: Festgelegte Modellierungstiefe des GVZ-Referenzmodells
Abbildung 34: Ablauf einer Simulationsstudie
Abbildung 35: Hierarchische Verknüpfung der Simulationsebenen
Abbildung 36: Auszug der Tagesganglinien aus der Datenbank
Abbildung 37: Benutzeroberfläche eines interaktiven Entscheidungsbaumes
Abbildung 38: Graphische Darstellung der Ergebniswerte bei Simulation des Normalbetriebs im Zeitraum von fünf Tagen
Abbildung 39: Interaktiver Entscheidungsbaum zur Feststellung eines Handlungsbedarfs bei Eintritt eines Risikoereignisses
Abbildung 40: Interaktiver Entscheidungsbaum zur Ermittlung einer situationsgerechten Handlungsempfehlung
Abbildung 41: Struktur der Handlungsstrategien für Simulationslauf
Abbildung 42: Auszug eines interaktiven Entscheidungsbaumes zur Bestimmung einer Handlungsstrategie
Tabelle 1: Ausgewählte Ausprägungsmerkmale von Entscheidungen
Tabelle 2: Systematisierungsmöglichkeiten von Supply Chain Risiken
Tabelle 3: Überblick über die Ebenen in Netzwerken
Tabelle 4: Funktionen in GVZ
Tabelle 5: Symbole der verschiedenen Modellierungsnotationen
Tabelle 6: Akteure in GVZ und ihre Ressourcen
Tabelle 7: Verkehrliche Infrastrukturen in GVZ
Tabelle 8: Festzulegende Merkmale der Entscheidungselemente
Tabelle 9: Situationsbestimmende Einflussfaktoren mit ihren Charakteristika
Tabelle 10: Verkehrsmittel und Verkehrsformen des Warentransports
Tabelle 11: Merkmale und ihre Ausprägungen zur Charakterisierung von Verfahren zur Berücksichtigung zeitlicher Interdependenzen
Tabelle 12: Elemente zur Berücksichtigung zeitlicher Interdependenzen
Tabelle 13: Risikorelevante Prozesse des Warenflusses in GVZ
Tabelle 14: Vergleich semiformaler Notationen hinsichtlich ihrer Eignung für die Modellierung risikorelevanter Prozesse
Tabelle 15: Bausteine und Parameter zur Modellierung der Aufbauorganisation
Tabelle 16: Modellierungselemente der Aufbauorganisation in GVZ
Tabelle 17: Kapazitäten und Bearbeitungszeiten der Ressourcen
Tabelle 18: Kapazitäten und Fahrzeugtypverteilung in Abhängigkeit von der Tageszeit
Tabelle 19: Verteilung der Fahrzeugtypen auf die Cluster
Tabelle 20: Definierte Parameter der schienenseitigen Transportmittel
Tabelle 21: Definierte Parameter des wasserseitigen Transportmittels
Tabelle 22: Ausprägungen der Einflussfaktoren eines Risikoereignisses
Tabelle 23: Ausprägungen der Einflussfaktoren von Handlungsalternativen
Tabelle 24: Übersicht zu den Simulationsszenarien
Tabelle 25: Kennzahlenwerte im Normalbetrieb
Tabelle 26: Ergebniswerte bei Rückwirkungen auf das GVZ
Tabelle 27: Festgelegte Gruppen für die Bewertung des Eintrittszeitpunkts ← XV | XVI →
Tabelle 28: Ergebniswerte bei Variation des Eintrittszeitpunkts
Tabelle 29: Festgelegte Gruppen und Ergebniswerte für die Bewertung des Einflusses eines Wochentages
Tabelle 30: Festgelegte Gruppen für die Bewertung des Einflusses der Beeinträchtigungsdauer
Tabelle 31: Ergebniswerte bei Variation der Beeinträchtigungsdauer
Tabelle 32: Bewertung des Ausmaßes der Beeinträchtigung
Tabelle 33: Identifizierte Handlungsbedarfe
Tabelle 34: Abgrenzung der Situationen
Tabelle 35: Situationsabhängige Gruppierung der Simulationsläufe
Tabelle 36: Identifizierte Handlungsbedarfe
Tabelle 37: Faktorenabhängige Einteilung der Handlungsalternativen zur Durchführung der Wirkungsvergleiche
Tabelle 38: Ermittelte Maßnahmenwirkungen auf die Kennzahlen
Tabelle 39: Situationsbedarf und Maßnahmenwirkung für Situation 1
Tabelle 40: Situationsbedarf und Maßnahmenwirkung für Situation 2
Tabelle 41: Situationsbedarf und Maßnahmenwirkung für Situation 3
Tabelle 42: Situationsbedarf und Maßnahmenwirkung für Situation 4
Tabelle 43: Situationsbedarf und Maßnahmenwirkung für Situation 6
Tabelle 44: Situationsgerechte Handlungsmaßnahmen
Tabelle 45: Definition möglicher Umweltzustände
Tabelle 46: Entscheidungszeitpunkte der Handlungsstrategien für Simulationslauf 2
Tabelle 47: Handlungsempfehlungen zur Formulierung der Handlungsstrategien für Simulationslauf 2
Tabelle 48: Handlungsstrategien für Simulationslauf 2
Tabelle 49: Verwendete Tagesganglinien
Tabelle 50: Simulationsszenarien
Tabelle 51: Ausgestaltung der Handlungsmaßnahmen
Tabelle 52: Gesamtauswirkungen der verschiedenen Risikoereignisse
Tabelle 53: Wirkungen der Handlungsalternative 1
Tabelle 54: Wirkungen der Handlungsalternative 2
Tabelle 55: Wirkungen der Handlungsalternative 3
Tabelle 56: Wirkungen der Handlungsalternative 4
Tabelle 57: Wirkungen der Handlungsalternative 5
Tabelle 58: Wirkungen der Handlungsalternative 6
Tabelle 59: Wirkungen der Handlungsalternative 7
Tabelle 60: Wirkungen der Handlungsalternative 8
Details
- Pages
- XXI, 298
- Publication Year
- 2016
- ISBN (Hardcover)
- 9783631673881
- ISBN (PDF)
- 9783653067125
- ISBN (MOBI)
- 9783653959659
- ISBN (ePUB)
- 9783653959666
- DOI
- 10.3726/978-3-653-06712-5
- Language
- German
- Publication date
- 2016 (April)
- Keywords
- Handlungsmaßnahmen Güterverkehrszentren Simulation Logistikprozesse
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. XXII, 298 S., 42 s/w Abb., 67 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG